| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Gleichnisse Jesus | Wunder Jesu | Jesus von Nazareth | Christologie | Heiliger Geist | Trinität | Gott | Monotheismus |
|
Monotheismus |
||
| 1. Gebot | Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen
Götter haben neben mir. zur Seite
Gott/Gottesbild Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen Literatur zum 1. Gebot |
|
 |
Hermann Vorländer Ist Gott gerecht? Theodizee und Monotheismus im Alten Testament unter besonderer Berücksichtigung der Theologie Deuterojesajas Peter Lang, 2020, 234 Seiten, 978-3-631-82840-3 49,95 EUR |
Beiiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des Antiken Judentums
Band 63 Die Entstehung des Monotheismus im Alten Testament hängt eng mit der Theodizeefrage zusammen. Ihr liegen die Zweifel an Gottes Macht, Güte und Weisheit zugrunde. Auf sie antwortet Deuterojesaja, indem er JHWH als den einzigen Gott bekennt. Das Theodizeemotiv prägt die Sammlung und Redaktion der historischen und prophetischen Bücher. Die Entstehung des Monotheismus im Alten Testament hängt eng mit der Theodizeefrage zusammen. Ihr liegen die Zweifel an Gottes Macht, Güte und Weisheit zugrunde, die die Israeliten im babylonischen Exil umtrieben. Darauf antwortet Deuterojesaja in Gestalt einer «kollektiven Theodizee», indem er JHWH als den einzigen Gott bekennt. Durch sein universales Wirken in Schöpfung und Geschichte, die Wirksamkeit des prophetischen Wortes, sein rettendes Eingreifen durch Kyros und seine persönliche Nähe beweist JHWH seine Einzigartigkeit. In Verbindung mit dem Monotheismus prägt das Theodizeemotiv die Sammlung und Redaktion der historischen und prophetischen Bücher. Der Autor zieht Parallelen zur «individuellen Theodizee» im Hiobbuch und Psalter, sowie zur «universalen Theodizee» in der Urgeschichte. |
 |
Martin Repp Der eine Gott und die anderen Götter Eine historische und systematische Einführung in Religionstheologien der Ökumene Evangelisches Verlagshaus, 2. Auflage 2021, 468 Seiten, Paperback, 15,5 x 23 cm 978-3-374-05505-0 978-3-374-07023-7 68,00 EUR |
Angesichts der rapiden religiösen Pluralisierung Europas in den
letzten Jahrzehnten wurden Religionstheologien entwickelt, die meist
in die Kategorien von religiösem »Exklusivismus«, »Inklusivismus«
und »Pluralismus« auseinanderfallen. Zugleich werden im heutigen
Diskurs frühere Ansätze ignoriert. Historische Untersuchungen jedoch
zeigen erstens, dass Religionstheologien von Beginn der Kirche an
entwickelt wurden, da Christen sich ihres Glaubens immer gegenüber
anderen Religionen vergewissern mussten, und zweitens, dass sie auf
den beiden Pfeilern der Soteriologie
(Christologie) und der allgemeinen Kosmologie (Schöpfungstheologie)
basierten, welche die Gemeinsamkeiten wie auch die spezifischen
Unterschiede zu anderen Religionen klarstellten. Weitere Ergebnisse
sind, dass die theoretische Religionstheologie und der praktische
Religionsdialog einander bedingen und dass beide auf den
Religionsfrieden abzielen. Leseprobe der 1. Auflage 2018 |
 |
Reinhold Bernhardt Monotheismus und Trinität Gotteslehre im Kontext der Religionstheologie Theologischer Verlag Zürich, 2023, 342 Seiten, Paperback, 15 x 22,5 cm 978-3-290-18525-1 56,00 EUR |
Beiträge zu einer Theologie der Religionen
Band 25 Reinhold Bernhardt forscht seit Jahren nach Möglichkeiten und Modellen der theologischen Beziehungsbestimmung zwischen den Religionen. Nachdem er im Buch «Jesus Christus – Repräsentant Gottes» (2021) seine Christologie vorgelegt hat, setzt er nun die Gotteslehre jenen Anfragen aus, die sich von anderen Religionstraditionen her ergeben. Dabei etabliert er Auslegungsformen etwa der Trinitätslehre, die nicht primär durch Abgrenzungen, sondern durch Anknüpfungen bestimmt sind. Im ersten Teil geht es um die Einheit Gottes, wozu sich Judentum, Christentum und Islam bekennen. Die Frage, ob personale Gottesvorstellungen angemessen sind, wird im Blick auf buddhistische Denkformen erörtert. Im zweiten Teil steht die christliche Lehre von der Dreieinigkeit Gottes zur Debatte: Wie kann diese in einer religionsdialogischen Perspektive verstanden werden? Reinhold Bernhardts religionsdialogische Überlegungen sind in höchstem Masse theologieproduktiv: Sie führen über bisherige Denkwege hinaus und steigern damit auch die intellektuelle Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens. Leseprobe |
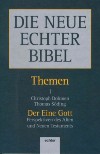 |
Christoph Dohmen / Thomas Söding Der Eine Gott Perspektiven des Alten und Neuen Testaments Echter Verlag, 2018, 144 Seiten, Broschur, 978-3-429-02142-9 14,40 EUR |
Die
Neue Echter
Bibel Themen Band 1 Der Eine Gott Perspektiven des Alten und Neuen Testaments Inhaltsverzeichnis |
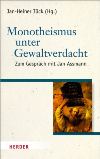 |
Jan-Heiner Tück Monotheismus unter Gewaltverdacht Zum Gespräch mit Jan Assmann Herder Verlag, 2015, 272 Seiten, Gebunden, 978-3-451-32782-7 25,00 EUR |
Unter den Stimmen, die das Unbehagen am Gewaltpotential des
Monotheismus öffentlich artikuliert
haben, verdient das Werk Jan Assmanns
besondere Aufmerksamkeit. Er hat die These vertreten, dass der
biblische Monotheismus eine neue Form von Hass in die Welt gebracht
habe - einen Hass, der durch religiöse Wahrheitsansprüche
freigesetzt werde. Der vorliegende Band dokumentiert ein
interdisziplinäres Streitgespräch, das Exegeten, Historiker,
Philosophen und Theologen zusammengeführt hat. Jan Assmann selbst
hat an dem Symposium teilgenommen und antwortet seinen Kritikern.
Das Buch kommt so zugleich einer Empfehlung von Papst Franziskus
nach, der die akademische Theologie dazu aufgefordert hat, sich mit
dem Werk Jan Assmanns konstruktiv kritisch auseinanderzusetzen Mit Beiträgen von Arnold Angenendt, Jan Assmann, Britta Mühl, Hans Schelkshorn, Ludger Schwienhorst-Schönberger, Thomas Söding, Jan-Heiner Tück, Michael Theobald Blick ins Buch |
 |
Darina
Staudt Der eine und einzige Gott Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, 360 Seiten, Gebunden, 978-3-525-55015-1 100,00 EUR |
Novum Testamentum et Orbis Antiquus /
Studien zur Umwelt des Neuen Testaments (NTOA/StUNT) Band
80 Monotheistische Formeln im Urchistentum und ihre Vorgeschichte bei Griechen und Juden Untersuchung sprachlicher »Formeln« monotheistischer Bekenntnisse aus der griechischen, hellenistischen und frühchristlichen Zeit. Inhaltsverzeichnis Blick ins Buch |
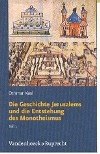 |
Keel, Othmar Die Geschichte Jerusalems und die Entstehung des Monotheismus Vandenhoeck & Ruprecht, 2007, 1424 Seiten, Zwei Teilbände mit ca. 700 Abbildungen, Gebunden, 978-3-525-50177-1 275,00 EUR |
Orte und Landschaften der
Bibel Band 4,1: Seit zwei Jahrhunderten gelten die monotheistischen Religionen vielen als besonders aggressiv. Keel rekonstruiert die Entstehung des Monotheismus im Rahmen der Geschichte Jerusalems im 1. Jtd. v. Chr. Er legt dar, auf welche Einflüsse aggressive und intolerante Züge zurückzuführen sind. Mit welchen Argumentationsfiguren versuchte man damals, sie einzudämmen und zu überwinden? Mittels biblischer und nichtbiblischer Texte sowie weiterer Daten gelingt es Keel, das Gesicht des biblischen Monotheismus nachzuzeichnen. Dabei berücksichtigt er die Traditionen der israelischen, angloamerikanischen und deutschsprachigen Forschung. |
 |
Eckhard Nordhofen Media divina Die Medienrevolution des Monotheismus und die Wiederkehr der Bilder Herder Verlag, 2022, 320 Seiten, Hardcover, 978-3-451-39746-2 34,00 EUR |
Nachdem in Jesus das »Bild des unsichtbaren Gottes« (Kol
1,15) sichtbar geworden war, hatte sich die Christenheit im ersten
Jahrtausend eine neue Lizenz zur Herstellung heiliger Bilder erkämpft.
Das war keine Kleinigkeit, denn die Kritik an der Herstellung des
Heiligen »durch Menschenhand« hatte einst dem
Monotheismus zum Durchbruch
verholfen. Israels geniale Alternative zum polytheistischen Kultbild war
seine Kultschrift. Die Heilige Schrift wurde zu seinem Gottesmedium.
Dann aber ein Quantensprung: Inkarnation, Gottes Wort im Menschenkörper
- was für ein Medienkonzept! Die Betrachtung der Gottesmedien lohnt sich. In seinem neuen Buch »Media divina« legt Eckhard Nordhofen den roten Faden frei, der sich durch die Geschichte des biblischen Monotheismus bis in die Moderne zieht. Was diesen von anderen Religionen unterscheidet, ist seine einmalige Simultaneität von Präsenz und Vorenthaltung. Darin ist er hochaktuell. Leseprobe zur Seite 1. Gebot, Bilderverbot |
 |
Lida Leonie Panov Hiskijas Geschick und Jesajas Beistand Heilstheologische Verarbeitungen der Jesajaüberlieferung in den Hiskija-Jesaja-Erzählungen Theologischer Verlag Zürich, 2019, 290 Seiten, Hardcover, 16,5 x 24 cm 978-3-290-18217-5 69,00 EUR |
AThANT, Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments
Band 110 Entstehung und Theologie der Hiskija-Jesaja-Erzählungen Beitrag zur Monotheismusdebatte in der Bibelwissenschaft Die assyrische Belagerung Jerusalems gehört zu den entscheidenden historischen Ereignissen in der Geschichte des Alten Israels. Die Erinnerung daran wurde in der biblischen und ausserbiblischen Literatur entsprechend oft bewahrt. Allein in der Hebräischen Bibel wurden die Geschehnisse sowohl im Jesajabuch wie in den Königebüchern als auch in den Chronikbüchern aufgenommen und sind forschungsgeschichtlich als die sogenannten Hiskija-Jesaja-Erzählungen bekannt geworden. Die mit dem Jahrespreis 2019 der Universität Zürich ausgezeichnete Dissertation beschäftigt sich mit der Klärung der Literatur-, Theologie- und Religionsgeschichte der Hiskija-Jesaja-Erzählungen. Da zwischen den Hiskija-Jesaja-Erzählungen und anderen Texten in den Vorderen und Hinteren Propheten auffällig viele Verbindungen bestehen, wird der Textbereich Jesaja 36–39 / 2. Könige 18–20 im Horizont der innerbiblischen Exegese interpretiert. Überdies belegen die Hiskija-Jesaja-Erzählungen Inhalte, die für die Entwicklung des biblischen Monotheismus wichtige Wegmarken darstellen. So bringt dieses Buch zugleich neue Perspektiven für die gegenwärtige Monotheismusdebatte ein. Leseprobe |
 |
Ulrich Mell Der eine Gott und die Geschichte der Völker Neukirchener Verlag, 2011, 160 Seiten, kartoniert, 12,5 x 20,5 cm 978-3-7887-2486-3 29,00EUR |
Biblisch-Theologische Studien Band 123: Studien zur Inklusion und Exklusion im biblischen Monotheismus Monotheistische Religion steht vor der Aufgabe, andersgläubige Völker und ihre Geschichte zu verstehen, sich mit fremder Religion zu verständigen und in Rückwirkung das eigene Selbstverständnis zu klären. Die dabei ablaufenden Interaktionsprozesse lassen sich mit dem Begriffspaar Exklusion - Aufrichtung von Grenzen und Ablehnung - oder Inklusion - Einschmelzung und Übernahme - beschreiben. Die Besonderheit der in diesem Band gesammelten Beiträge zu antiken Quellentexten ist, dass sie nicht nur die christliche Binnenperspektive, sondern auch eine judaistische und römische Position der religiös pluralen Antike zu Wort kommen lassen. Durch die Fragestellung der Forschergruppe, wie Texte monotheistischer Trägergruppen andersgläubige Menschen beurteilen, entsteht ein einzigartiger Fokus auf die Eignung eines monotheistischen Gottesbildes, die ganze Wirklichkeit auf den einen Gott hin zu verstehen. |
 |
Lukas Bormann Schöpfung, Monotheismus und fremde Religionen Studien zur Inklusion und Exklusion in den biblischen Schöpfungsvorstellungen Neukirchener Verlag, 2008, 240 Seiten, Paperback, 12,5 x 20,5 cm 978-3-7887-2279-1 40,00 EUR |
Biblisch
Theologische Studien Band 95: Die biblischen Schöpfungsvorstellungen werden von Menschen entwickelt, die sehr genau wissen, dass sie eine partikulare Sicht vertreten. Sie sind umgeben von "anderen", fremden Religionen. Was erfährt man über die Sicht auf die "anderen", auf diejenigen, die andere Schöpfer(innen) kennen? Wie verhält sich die Rhetorik der Gewalt, die hier oft begegnet, zur Lebenswirklichkeit der religiösen Gemeinschaften? Mit Beiträgen zu den Erträgen der Monotheismusdebatte und zu den Schöpfungsvorstellungen in Genesis, Hiob, Philo, Paulus und Johannes. Lukas Barmann geb. 1962, Dr. theol., ist Professor für Biblische Theologie an der Universität Bayreuth und Sprecher der Forscher/innengruppe der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie zu "Der eine Gott und die Völker. Transformationsprozesse im biblischen Gottesbild zwischen Exklusivität und Inklusivität". zur Seite Schöpfung / Evolution |
 |
Wiard
Popkes / Ralph Brucker Ein Gott und ein Herr Zum Kontext des Monotheismus im Neuen Testament Neukirchener Verlag, 2004, 160 Seiten, Paperback, 978-3-7887-2070-4 28,00 EUR |
Biblisch-Theologische
Studien Band 68 Die Aufsatzsammlung befaßt sich aus verschiedenen Perspektiven mit dem Kontext des Monotheismus im Neuen Testament. Die Apostelgeschichte zeigt, wie der christliche Gottesglaube im religiösen Panorama ihrer Zeit zu positionieren ist. Der Epheserbrief mit seinem Thema der "Einsheit Gottes und der Einheit der Kirche" fängt eine monarchische Tendenz durch das Motiv der Liebe auf. Die Zuordnung der Elemente des Heno-, Mono- und Polytheismus in 1Kor 8,1-6 erreicht Paulus im Blick auf Christus-Akklamation und monotheistisches Bekenntnis. Das Thema "Jesus als Gott" erhält im Neuen Testament nur selten eine eindeutige Antwort; eigentümlich ist vielmehr ein Zustand der Schwebe. Das Bekenntnis des Einzelnen zu Gott als Konstituierung des individuellen Subjekts ist ein Novum im pluralistischen Raum der hellenistisch-römischen Religion. Mit Hilfe der Systemtheorie Luhmanns wird der christliche Gottesbegriff als einerseits monotheistisch, andererseits nicht-monotheistisch differenziert. |
 |
Hans
Hübner Wer ist der biblische Gott? Fluch und Segen der monotheistischen Religionen Neukirchener Verlag, 2004, 240 Seiten, Paperback, 978-3-7887-2033-9 35,00 EUR |
Biblisch-Theologische
Studien Band 64 Gehören Intoleranz und Fanatismus zum Monotheismus? Fördert der Glaube an den einen, wahren Gott Gewaltbereitschaft? Hübner zeigt in allen drei monotheistischen Religionen das Potential von Fluch und Segen auf, das in dieser Besonderheit liegt. Monotheistische Religionen, also Religionen des Glaubens an den einen Gott, sind durch Anschläge fanatischer Islamisten in Verruf geraten. Hübner befragt vor allem Judentum, Christentum und Islam, ob ihr Gottesverständnis zum Fanatismus führen könnte. Dabei zeigt sich, daß sich innerhalb aller monotheistischen Religionen tolerante und intolerante Richtungen finden. Der jüdische und islamische Anstoß am christlichen Glauben, dem Glauben an den dreieinen Gott, entspringt vor allem einem Mißverständnis dogmatischer Aussagen, die zu einer Zeit formuliert wurden, in der viele Begriffe anders als heute verstanden wurden. |
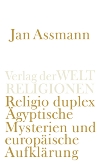 |
Jan Assmann Religio duplex Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung Verlag der Weltreligionen, 2017, 509 Seiten, Softcover 978-3-458-24051-8 28,00 EUR |
Im 17. Jahrhundert schlägt die Geburtsstunde der
Religionswissenschaft. Sie entsteht aus der Frage nach der
Herkunft der Götter, des Polytheismus, der „Idolatrie“. Der
Monotheismus, darin war man sich einig, bildete die Urreligion:
Das war nicht die Religion der Offenbarung, sondern die Religion
der Natur und der Vernunft, die allen Menschen gemeinsam und
auch in allen heidnischen Religionen aufspürbar ist. Die
Vielgötterei entstand erst mit den Staaten; denn Herrschaft
braucht die Götter, um dem Volk politische und moralische
Orientierung zu geben. Unter diesen Bedingungen zog sich die
Urreligion in den Untergrund zurück: So entstanden die
Mysterien. Grundmodell dieser Entwicklung ist das Alte Ägypten, der erste Staat der Geschichte, in dem sich diese religiöse Doppelstruktur besonders klar ausprägte. Die Ägypter hatten zwei Schriften, so las man es bei den Griechen: eine fürs Volk, eine für die Mysterien, und sie bauten über der Erde für die offizielle und unter der Erde für die geheime Religion, nämlich den Kult der verschleierten Isis, in der man Spinozas Deus sive Natura erkannte: oben also die vielen Götter, unten der Gott der Philosophen. In dieses Bild blickten die Geheimgesellschaften wie in einen Spiegel. Ende des 18. Jahrhunderts hoben Lessing, Mendelssohn und andere diese Idee der doppelten Religion auf eine neue Ebene. An die Stelle der Mysterien trat bei ihnen die Idee einer „Menschheitsreligion“ und an die Stelle der Kultur, die zwei Religionen hat, der Mensch, der sich einerseits seiner angestammten Kultur, Nation und Religion und andererseits einer menschheitlichen Verbundenheit zugehörig weiß. Keine Religion besitzt die Wahrheit, allen aber ist sie als Ziel aufgegeben. In dieser Form gewinnt die Idee der doppelten Religion im Zeitalter der Globalisierung eine ungeahnte Aktualität. Leseprobe |
 |
Ilze Kezbere Umstrittener Monotheismus Wahre und falsche Apotheose im lukanischen Doppelwerk Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, 240 Seiten, Gebunden, 978-3-525-53960-6 65,00 EUR |
Novum Testamentum et
Orbis Antiquus,
Vandenhoeck
& Ruprecht / Universitätsverlag Fribourg Band 60 Darf man Menschen vergöttlichen? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Die Antwort der Juden war ein striktes Nein. Christen übernahmen die Ablehnung aus ihrer jüdischen Tradition, schrieben aber Jesus Christus exklusiv einen göttlichen Status zu. Die Autorin zeigt auf, dass der Evangelist Lukas zwischen wahrer und falscher Apotheose unterscheidet und Kriterien für die einzig wahre Apotheose des Jesus von Nazaret entwickelt. Lk trennt zwischen der Reaktion auf erfahrene göttliche Macht und Formen der Vergöttlichung in politischen und kultischen Kontexten. Kezbere fragt nach dem korrekten Monotheismus und danach, wo der Gehorsam gegenüber dem Staat ein Ende finden muss. Dabei fließen Erfahrungen der lettischen Autorin mit dem Personenkult im Kommunismus ein. |
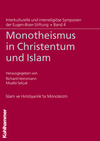 |
Prof. Dr. M. Selcuk Prof. Dr. Richard Heinzmann Monotheismus in Christentum und Islam Kohlhammer Verlag, 2011, 282 Seiten, kartoniert, 978-3-17-021314-2 22,80 EUR |
Interkulturelle und interreligiöse Symposien der Eugen Biser Stiftung,
Band 4 Die sorgsame Reflexion je eigener religionsspezifischer Bezugsetzungen und die wechselseitige Kenntnisnahme der Befunde durch Christen und Muslime sind zur weiteren ideellen und moralischen Fundierung eines zukunftsorientierten Dialogs, der Ausblicke auf mögliche Felder gemeinsamen Handelns eröffnet, unerlässlich. Da der Glaube an den einen und einzigen Gott die gemeinsame Basis der Weltreligionen Christentum und Islam bildet, ist die Bearbeitung des Themas Monotheismus für einen fruchtbaren interreligiösen Dialog von kaum zu überschätzender Wichtigkeit. Die in dem vorliegenden Band versammelten Beiträge deutscher wie türkischer Gelehrter zeigen, dass es trotz Gemeinsamkeiten auch deutliche Differenzen im Gottesbild gibt. Die Beiträge zu diesem Band sind vollständig sowohl in deutscher als auch in türkischer Sprache wiedergegeben und jeweils durch detaillierte Namen- und Sachregister erschlossen. Inhaltsverzeichnis / Vorwort / Leseprobe Prof. Dr. Richard Heinzmann, München. Prof. Dr. Mualla Selcuk, Ankara. |
 |
Reinhard Gregor
Kratz / Hermann
Spieckermann Götterbilder - Gottesbilder - Weltbilder. Polytheismus und Monotheismus in der Welt der Antike Mohr Siebeck, 2009, 2 Bände, nur zusammen, fadengeheftete Broschur, 978-3-16-149886-2 29,00 EUR |
Forschungen zum Alten Testament, 2. Reihe Band 17/18 Band 1: Ägypten, Mesopotamien, Persien, Kleinasien, Syrien, Palästina Band 2: Band 2: Griechenland und Rom, Judentum, Christentum und Islam Im Zentrum der beiden Bände steht der komplexe Zusammenhang zwischen Gottesbildern und Weltbildern in Ägypten, Persien, Mesopotamien, Syrien, Kleinasien, Israel, Griechenland und Rom, im Zoroastrismus, Judentum, Christentum und Islam.Die spannungsvolle Vielfalt hat nicht nur Weltbilder in der orientalischen und hellenistisch-römischen Antike geprägt. In veränderter Gestalt ist sie bis heute in den praktizierten Religionen Anlaß zu geistiger, im Extremfall gewaltsam ausgetragener Auseinandersetzung. Der Einfluß auf individuelle Lebensführung und religiöse sowie politische Weltanschauung ist unverkennbar. "[Es] wird eine Fülle an Material geboten und eine ganze Reihe von Einzelfragen diskutiert. Wer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen zur mesopotamischen oder phönizischen Religion ist, wird genauso fündig wie derjenige, der sich für den Zoroastrismus oder wichtige Aspekte römischer Religion interessiert."Bernd U. Schipper in Zeitschrift für Religionswissenschaft 15 (2007), S. 95 Band I und II liegen nun als Studienausgabe vor. Sie werden nur zusammen abgegeben. |
 |
Harald Strohm Die Geburt des Monotheismus im alten Iran Ahura Mazda und sein Prophet Zarathushtra Fink Verlag, 2015, 400 Seiten, Hardcover, 23,3 x 15,7 cm 978-3-7705-5929-9 66,00 EUR |
Harald Strohm verbindet die Gelehrsamkeit eines Veda-Forschers mit dem
Wissen der heutigen Psychologie über die frühkindliche Entwicklung. Seit
Mircea Eliade hat niemand die archaische Religion mit solcher Präzision
und Verve dargestellt, interpretiert und zu bedenken gegeben.“ (Bernhard
Lang, Neue Zürcher Zeitung) „So lässt uns dieses Buch aus tiefer Vergangenheit in unsere Gegenwart blicken, wo so viele Kriege im Namen von Einzelgöttern geführt werden. Zugleich erinnert Harald Strohms heiter gestimmte, ebenso gelehrt wie leicht geschriebene Darstellung. an die verlorene Epoche der kindlichen fröhlichen Götter.“ (Manfred Schneider, Deutschlandfunk) „Als Entwicklungspsychologe bringt Harald Strohm Bewegung in die Frühgeschichte der indoiranischen Religion. Ein ganz besonderes Verdienst ist die Reproduktion des dem frühen 8. Jahrhundert entstammenden Wandbilds von Pandjikent (Tadjikistan).“ (Helmut Humbach, Universität Mainz) „Strohm verfolgt die historische Entwicklung von Varuna, dem Anführer des polytheistischen indoiranischen Pantheons, und zeigt schlagend wie er zu Zoroasters monotheistischer Gottheit Ahura Mazda wurde. – Ahura Mazda hat später, zur Zeit der Babylonischen Gefangenschaft, prägend auf den Monotheismus der hebräischen Bibel und damit auf das Christentum und den Islam gewirkt.“ (Michael Witzel, Harvard University) Die Mehrzahl der damit befassten Iranisten und Indologen vertritt seit langem, dass Ahura Mazda, der von Zarathushtra um etwa 1000 vor unserer Zeitrechnung verkündete Monotheos, sich aus dem selben Gott entwickelte wie der vedische Asura Varuna des nachbarlichen Indien. Mit weiteren, insbesondere psychologischen Argumenten unterfüttert, erweist sich diese 'Gleichung' als einzigartige Chance, die Entstehungsgeschichte des altiranischen Monotheismus zu rekonstruieren. Denn das eher knappe Quellenmaterial Irans erhält dadurch Licht aus den schier unerschöpflichen Befunden zum Varuna Altindiens. Nicht nur die Narrenrolle Varunas im indischen Theater, auch Varunas gefürchteter Groll, seine Gespaltenheit in hier lichte, dort finstere Züge, seine hehren moralischen Ansprüche, seine Weltflüchtigkeit,. sein gestörtes Verhältnis zu Frauen: Alle diese Züge haben ihr klares Pendant im Ahura Mazda des iranischen Propheten. Und dennoch wurde der alte Gott in Zarathushtras Offenbarungen nun ein völlig anderer. Der einstige Sonderling in einer ansonsten illustren polytheistischen Göttergesellschaft mutierte jetzt zum schweigenden, transzendenten und streng richtenden Patriarchen und Autokraten. Da vom Bösen durchsetzt und insoweit misslungen, müsse seine Schöpfung, die jetzige Welt, dereinst mit glühendem Metall vernichtet werden – um dann endlich und im zweiten Versuch eine neue und jetzt zur Gänze geglückte Welt anbrechen zu lassen. – Auch die Mechanismen dieser Transformation erschließen sich durch die Psychologie des Varunischen. Inhaltsverzeichnis / Leseprobe |
 |
Nathan MacDonald Deuteronomy an the Meaning of Monotheism Mohr, 2012, 280 Seiten, Broschur, 978-3-16-151680-1 49,00 EUR |
Forschungen zum Alten Testament, 2. Reihe Band 1 MacDonald untersucht den Begriff Monotheismus von der ersten Verwendung 1660 an und in seiner Funktion als Kategorie zur Erforschung des Alten Testaments Nathan MacDonald examines the term 'monotheism' and its appropriateness as a category for analysing the Old Testament. He traces the use of 'monotheism' since its coinage in 1660 and argues that its use in Old Testament scholarship frequently reflects a narrowed, intellectualistic conception of religion. "Finally, MacDonald's volume is a valuable contribution to the discussion because it is also a fine example of biblical theology, a truly insightful exposition of some of the significant themes in the book of Deuteronomy, accompanied by a fine, detailed exposition of crucial passages in the book. [...] This book is highly recommended for all who are interested in the debate concerning biblical monotheism and the larger study of Israel's religious identity."Robert Gnuse in Biblica, Vol. 86 (2005), No. 4, 558-560 "This is one of the most significant and exciting books of biblical theology I have read for some time, illustrating how the Bible can come to life when critical attention is paid to the contemporary context of its interpretation."Philip Jenson in Themelios, Vol. 29 (2004), No. 2, 56-57 Content |
 |
Szabolcs-Ferencz
Kató Jhwh: der Wettergott Hoseas? Vandenheock & Ruprecht, NTH, 2019, 384 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3402-2 85,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 158 Der ursprüngliche Charakter Jhwhs ausgehend vom Hoseabuch Der Monotheismus in Israel entwickelte sich über einen längeren Zeitraum hin. Was stand am Anfang dieser Entwicklung? Was für ein Gott war Jhwh, bevor er zu „dem einen“ Gott wurde? Die Antworten auf diese Fragen variieren, je nachdem, wie man den Namen Jhwh etymologisch herleitet und wie man für literarisches Urgestein gehaltene Texte literar- und traditionsgeschichtlich einordnet. In der Regel werden als Quellen dabei fast ausschließlich poetische Texte herangezogen (v.a. Ri 5, Hab 3, Dtn 33; Ps 68). Szabolcs-Ferencz Kató geht dieser Frage auf eine andere Weise nach, indem er nämlich mit Hosea ein relativ altes prophetisches Buch motivgeschichtlich untersucht und darin ein archaisches Gottesprofil herausarbeitet. Dementsprechend dominieren bei Jhwh die Wettergottzüge des Baal-Hadad-Typs, was sich so interpretieren lässt, dass Jhwh ursprünglich selbst ein Wettergott dieser Art war. Leseprobe |
 |
Wolfgang
Schrage Unterwegs zur Einheit und Einzigkeit Gottes Neukirchener Verlag, 2001, 160 Seiten, kartoniert, 978-3-7887-1862-6 10,00 EUR |
Biblisch-Theologische Studien Band 48 Zum "Monotheismus" des Paulus und seiner alttestamentlich-jüdischen Tradition Die auf dem Hintergrund alttestamentlich-jüdischer Tradition untersuchten paulinischen Texte zeigen, daß Einzigkeit und Einheit Gottes für Paulus primär eine eschatologische Verheißung sind, die noch der endgültigen Realisierung bedarf. Das heißt: Der paulinische »Monotheismus« ist wesentlich dynamisch-eschatologisch und prozeßhaft zu verstehen. Das gilt vor allem für das Verhältnis des einen Gottes zu den Göttern, Mächten und Herren, aber in bestimmter Weise auch für sein Verhältnis zu Christus. |
| siehe auch Atheismus | ||