| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, WMANT, Neukirchener Verlag / Vandenhoeck & Ruprecht | ||||||
 |
Begründet von G. Bornkamm
und G. von Rad. |
|||||
| 178 | 978-3-525-50504-5 | Benedikt Bauernschmitt | Rache und Vergeltung im Alten
Testament. Philologische, motivgeschichtliche und erzähltextanalytische
Perspektiven auf einen umstrittenen Themenkomplex zur Beschreibung |
150,00 |
|
2024 |
| 177 | 978-3-525-50030-9 | Sebastian Ziera | Die Danielrezeption im
Markusevangelium. zur Beschreibung |
130,00 |
|
2023 |
| 176 | 978-3-525-56087-7 | Miriam von Nordheim-Diehl | Streit um Korach. Eine biblische Figur
zwischen Numeri, den Psalmen und der Chronik zur Beschreibung |
130,00 |
|
2023 |
| 170 | 978-3-525-55297-1 | Ulrike Beiroth | Facetten von Gerechtigkeit. Das Lexem Gerechtigkeit in
Spr 10,1–22,16; 25–29 zur Beschreibung |
100,00 |
|
2022 |
| 169 | 978-3-525-56074-7 | Peter Riede | Zwischen Mensch und Gott. Psalm 45 und die Bedeutung
von König und Königin im Rahmen der judäischen Herrschaftstheologie zur Beschreibung |
100,00 |
|
2022 |
| 168 | 978-3-525-56054-9 | Siegfried Bergler | Judas. Einer der nachösterlichen Zwölf zur Beschreibung |
160,00 |
|
2022 |
| 167 | 978-3-525-56088-4 | Seo-Jun Kim | Gott ist es ja, der uns für gerecht erklärt. Eine
Studie zu den verschiedenen Bedeutungen und Funktionen der im
δικαι-Termini Römerbrief zur Berschreibung |
150,00 |
|
2023 |
| 166 | 978-3-525-56079-2 | Ulrich Mell | Das Evangelium in einem rhetorischen Brief. Ein Kommentar zum
1. Thessalonicherbrief zur Beschreibung |
140,00 |
|
2022 |
| 165 | 978-3-525-56058-7 | Martina Weingärtner | Die Impertinenz Jakobs. Eine relecture der
Jakob-Esau-Erzählungen vor einer text- und metapherntheoretischen
Hermeneutik Paul Ricoeurs zur Beschreibung |
95,00 |
|
2021 |
| 164 | 978-3-7887-3527-2 | Tanja Forderer | Was Gott zusammengefügt hat...?. Eine
argumentationsanalytische Untersuchung von Ehe-Scheidung im Neuen
Testament am Beispiel von Mk 10,1–12 und 1Kor 7,10–16 zur Beschreibung |
130,00 |
|
2021 |
| 163 | 978-3-7887-3524-1 | Tobias Wieczorek | Die Nichtgläubigen. Über die Funktion abgrenzender Sprache
bei Paulus zur Beschreibung |
85,00 |
|
2021 |
| 162 | 978-3-7887-3521-0 978-3-525-50501-4 |
Heinz-Dieter Neef | Geschichte, Schuld und Rettung. Studien zur Redaktion,
Komposition und Theologie von Ri 1,1-3,30 zur Beschreibung |
95,00 |
|
2021 |
| 161 | 978-3-7887-3494-7 | Kathrin Gies | Strebe nach Schalom!. Eine biblisch-ethische Lektüre von
Psalm 34 zur Beschreibung |
110,00 |
|
2021 |
| 160 | 978-3-7887-3428-2 | Nina Meyer zum Felde | Hiobs Weg zu seinem persönlichen Gott. Studien zur
Interpretation von Psalmentheologie im Hiobbuch zur Beschreibung |
75,00 |
|
2019 |
| 159 | 978-3-7887-3412-1 | Katrin Zehetgruber | Zuwendung und Abwendung. Studien zur Reziprozität des
JHWH/Israel-Verhältnisses im Hoseabuch zur Beschreibung |
89,00 |
|
2019 |
| 158 | 978-3-7887-3402-2 | Szabolcs-Ferencz Kató | Jhwh: der Wettergott Hoseas?. Der ursprüngliche
Charakter Jhwhs ausgehend vom Hoseabuch zur Beschreibung |
89,00 |
|
2019 |
| 157 | 978-3-7887-3415-2 | Elisabeth Krause-Vilmar | Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Die ambivalente
Beschreibung der Nähe Gottes in Jer 20,7-18 und Ps 139 zur Beschreibung |
59,00 |
|
2019 |
| 156 | 978-3-7887-3341-4 | Ann-Cathrin Fiß | Lobe den Herrn, meine Seele!. Psalm 103 in seinen Kontexten
zur Beschreibung |
79,00 |
|
2018 |
| 155 | 978-3-7887-3338-4 | Michael Emmendörfer | Gottesnähe. Zur Rede von der
Präsenz JHWHs in der Priesterschrift und verwandten Texten zur Beschreibung |
75,00 |
|
2018 |
| 154 | 978-3-7887-3328-5 | Marion Christina Hauck | DYNAMIS EIS SOTERIAN. Eine Untersuchung zum semantischen
Hintergrund eines neutestamentlichen Syntagmas zur Beschreibung |
75,00 |
|
2018 |
| 153 | 978-3-7887-3325-4 | Hoby Randriambola-Ratsimihah | Wenn ein Mensch stirbt, lebt er dann wieder auf? (Hi 14,14).
Zur Frage einer Jenseitshoffnung im hebräischen und im griechischen
Hiobbuch zur Beschreibung |
65,00 |
|
2018 |
| 152 | 978-3-7887-3322-3 | Simon Schäfer | Gegenwart in Relation. Eine Studie zur präsentischen
Eschatologie bei Paulus ausgehend von Römer 5-8 zur Beschreibung |
85,00 |
|
2018 |
| 151 | 978-3-7887-3260-8 | Thomas Naumann | Ismael. Israels Selbstwahrnehmung im Kreis der Völker aus der
Nachkommenschaft Abrahams zur Beschreibung |
86,00 |
|
2018 |
| 150 | 978-3-7887-3125-0 | Monika Müller | Und der Herr wohnt in Zion (Joel 4,21). zur Beschreibung |
59,00 |
|
2017 |
| 149 | 978-3-7887-3053-6 | Chol-Gu Kang | Behemot und Leviathan. Studien zur Komposition und Theologie
von Hiob 38,1-42,6 zur Beschreibung |
79,00 |
|
2016 |
| 148 | 978-3-7887-3068-0 | Nesina Grütter | Das Buch Nahum. Eine vergleichende Untersuchung des
masoretischen Texts und der Septuagintaübersetzung zur Beschreibung |
65,00 |
|
2016 |
| 147 | 978-3-7887-3060-4 | Stefanie Schabow | Gemacht zu einem Königreich und Priestern für Gott. Eine
Auslegung der basileia-/basileuw-Aussagen in Offb 1,6; 5,10; 20,4.6 und
22,5 46,00 zur Beschreibung |
65,00 |
|
2016 |
| 146 | 978-3-7887-3045-1 | Karin Finsterbusch | MT-Jeremia und LXX-Jeremia 25-52. Synoptische
Übersetzung und Analyse der Kommunikationsstruktur zur Beschreibung |
75,00 |
|
2017 |
| 145 | 978-3-7887-2995-0 | Norbert Jacoby / Karin Finsterbusch | MT-Jeremia und LXX-Jeremia 1-24. Synoptische Übersetzung und
Analyse der Kommunikationsstruktur zur Beschreibung |
65,00 |
|
2017 |
| 144 | 978-3-7887-2962-2 | Meik Gerhards | Homer und die Bibel. Studien zur Interpretation der
Ilias und ausgewählter alttestamentlicher Texte zur Beschreibung |
89,00 |
|
2015 |
| 143 | 978-3-7887-2896-0 | Sung-Ho Park | Stellvertretung Christi im Gericht. Studien zum
Verhältnis von Stellvertretung und Kreuzestod Jesu bei Paulus zur Beschreibung |
89,00 |
|
2015 |
| 142 | 978-3-7887-2888-5 | Christine Abart | Lebensfreude und Gottesjubel. Studien zu physisch
erlebter Freude in den Psalmen zur Beschreibung |
65,00 |
|
2014 |
| 141 | 978-3-7887-2860-1 | Oliver Cremer | Das sagt der Sohn Gottes. Die Christologie der
Sendschreiben der
Johannesoffenbarung zur Beschreibung |
55,00 |
|
2014 |
| 140 | 978-3-7887-2856-4 | Bärbel Bosenius | Der literarische Raum des
Markusevangeliums. zur Beschreibung |
100,00 |
|
2014 |
| 139 | 978-3-7887-2799-4 | Michael Lichtenstein | Von der Mitte der Gottesstadt bis
ans Ende der Welt.
Psalm 46 und die
Kosmologie der Zionstradition zur Beschreibung |
89,00 |
|
2014 |
| 138 | 978-3-7887-2717-8 | Uta Schmidt | Zukunftsvorstellungen in Jesaja 49-55. Eine textpragmatische
Untersuchung von Kommunikation und Bildwelt zur Beschreibung |
79,00 | 2013 | |
| 137 | 978-3-7887-2707-9 | Meike Gerhards | Conditio humana. Studien zum
Gilgameschepos und zu Texten der biblischen
Urgeschichte am Beispiel von Gen 2-3 und 11,1-9 zur Beschreibung |
79,00 | 2013 | |
| 136 | 978-3-7887-2675-1 | Johannes Schnocks | Das Alte Testament und die Gewalt. Studien zu göttlicher und menschlicher Gewalt in alttestamentlichen Texten und ihren Rezeptionen | 35,00 | 2014 | |
| 135 | 978-3-7887-2687-4 | Christiane Zimmermann | Gott und seine Söhne. Das
Gottesbild des Galaterbriefes zur Beschreibung |
39,00 | 2013 | |
| 134 | 978-3-7887-2581-5 | Tomohisa Yamayoshi | Von der Auslösung zur Erlösung. Studien zur Wurzel PDH im Alten Orient und im Alten Testament | 85,00 | 2012 | |
| 133 | 978-3-7887-2580-8 | Uwe Rechberger | Von der Klage zum Lob. Studien zum Stimmungsumschwung in den Psalmen | 85,00 | 2012 | |
| 132 | 978-3-7887-2562-4 | Christoph Rösel | JHWHs Sieg über Gog aus Magog. Ez 38-39 im Masoretischen Text und in der Septuaginta | 85,00 | 2012 | |
| 131 | 978-3-7887-2485-6 | Antje Labahn | Levitischer
Herrschaftsanspruch zwischen Ausübung und Konstruktion. Studien zum
multi-funktionalen Levitenbild der Chronik und seiner Identitätsbildung
in der Zeit des Zweiten Tempels
zur Beschreibung |
85,00 | 2012 | |
| 130 | 978-3-7887-2511-2 | Jan Kreuch | Unheil und Heil bei
Jesaja. Studien zur Entstehung des Assur-Zyklus Jesaja 28 - 31 zur Beschreibung |
100,00 | 2011 | |
| 129 | 978-3-7887-2510-5 | Thorsten Jantsch | Gott alles in allem (1Kor
15,28). Studien zum Gottesverständnis des Paulus im
1. Thessalonicherbrief und in
der korinthischen Korrespondenz
zur Beschreibung |
89,00 | 2011 | |
| 128 | 978-3-7887-2462-7 | Markus Georg Steinhilber | Die Fürbitte für die Herrschenden im Alten Testament, Frühjudentum und Urchristentum. | 75,00 | 2010 | |
| 127 | 978-3-7887-2432-0 | Daniel Opel | Hiobs Anspruch und Widerspruch. Die
Herausforderungsreden Hiobs (Hiob
29-31) im Kontext frühjüdischer Ethik zur Beschreibung |
79,00 | 2010 | |
| 126 | 978-3-7887-2380-4 | Andreas Reinert | Die Salomofiktion. Studien zur Struktur und
Komposition des Koheletbuches
zur Beschreibung |
55,00 | 2010 | |
| 125 | 978-3-7887-2365-1 | Günther Bornkamm | Studien zum Matthäus-Evangelium
zur Beschreibung |
85,00 | 2009 | |
| 124 | 978-3-7887-2379-8 | Anette Krüger | Das Lob des Schöpfers. Studien zur Sprache,
Motivik und Theologie von Psalm 104 zur Beschreibung |
89,00 |
|
|
| 123 | 978-3-7887-2332-3 | Sophie Rantzow | Christus Victor temporis.
Zeitkonzeptionen im Epheserbrief
zur Beschreibung |
75,00 |
|
2008 |
| 122 | 978-3-7887-2324-8 | Christina Eschner | Gestorben und hingegeben für die
Sünder. Die griechische Konzeption des Unheil
abwendenden Sterbens und deren paulinische Aufnahme für
die Deutung des Todes Jesu Christi zur Beschreibung |
225,00 |
|
2008 |
| 121 | 978-3-7887-2319-4 | Dorothea Erbele-Küster | Körper und Geschlecht. Studien zu
Leviticus 12 und 15 zur Beschreibung |
49,00 |
|
2008 |
| 120 | 978-3-7887-2245-6 | Peter Riede | Vom Erbarmen zum Gericht. Die
Visionen des Amosbuches (Amos 7-9) und ihr literatur- und
traditionsgeschichtlicher Zusammenhang zur Beschreibung |
79,00 | 2008 | |
| 119 | 978-3-7887-2277-7 | Anna Karena Müller | Gottes Zukunft. Die Möglichkeit der Rettung am
Tag Jhwhs nach dem Joelbuch
zur Beschreibung |
49,00 | 2008 | |
| 118 | 978-3-7887-2281-4 | Robert Vorholt | Der Dienst der Versöhnung. Studien zur
Apostolatstheologie bei Paulus zur Beschreibung |
79,00 | 2008 | |
| 117 | 978-3-7887-2276-0 | Miriam von Nordheim | Geboren von der Morgenröte. Psalm
110 in Tradition, Redaktion und Rezeption zur Beschreibung |
75,00 | 2008 | |
| 116 | 978-3-7887-2258-6 | Christina Ehring | Die Rückkehr JHWHs. Traditions-
und religionsgeschichtliche Untersuchungen zu Jesaja
40,1-11, Jesaja 52, 7-10 und verwandten Texten zur Beschreibung |
59,00 |
|
2007 |
| 115 | 978-3-7887-2207-4 | Sung Bok Choi | Geist und christliche Existenz.
Das Glossolalieverständnis des Paulus im Ersten
Korintherbrief (1. Kor. 14) zur Beschreibung |
55,00 |
|
2007 |
| 114 | 978-3-7887-2191-6 | Judith Gärtner | Jesaja 66 und Sacharja 14 als
Summe der Prophetie. Eine traditions- und
redaktionsgeschichtliche Untersuchung zum Abschluss des
Jesaja- und des Zwölfprophetenbuches zur Beschreibung |
79,00 |
|
2006 |
| 113 | 978-3-7887-2190-9 | Sebastian Fuhrmann | Vergeben und Vergessen.
Christologie und Neuer Bund im Hebräerbrief zur Beschreibung |
55,00 |
|
2006 |
| 112 | 978-3-7887-2142-8 | Sigurd Kaiser | Krankenheilung. Untersuchungen zu
Form, Sprache, traditionsgeschichtlichem Hintergrund und
Aussage von Jak 5, 13-18 zur Beschreibung |
59,00 |
|
2006 |
| 111 | 978-3-7887-2141-1 | David du Toit | Der abwesende Herr. Strategien im
Markusevangelium zur Bewältigung der Abwesenheit des
Auferstandenen zur Beschreibung |
100,00 |
|
2006 |
| 110 | 3-7887-2138-3 978-3-7887-2138-1 |
Anja Angela Diesel | Ich bin Jahwe. Der Aufstieg der
Ich-bin-Jahwe-Aussage zum Schlüsselwort des
alttestamentlichen Monotheismus zur Beschreibung |
85,00 |
|
2006 |
| 109 | 3-7887-2137-5 978-3-7887-2137-4 |
Meik Gerhards | Die Aussetzungsgeschichte des
Mose. Literatur- und traditionsgeschichtliche
Untersuchungen zu einem Schlüsseltext des
nichtpriesterichen Tetrateuch zur Beschreibung |
59,00 |
|
2006 |
| 108 | 978-3-7887-2107-7 | Gerlinde Baumann | Gottes Gewalt im Wandel.
Traditionsgeschichtliche und intertextuelle Studien zu Nahum 1, 2-8 zur Beschreibung |
55,00 |
|
2005 |
| 107 | 3-7887-2087-5 978-3-7887-2087-2 |
Christine Schlund | Kein Knochen soll gebrochen werden. Studien zur Bedeutung und Funktion des Pesachfests in Texten des frühen Judentums und im Johannesevangelium | 55,00 |
|
2005 |
| 106 | 978-3-7887-2086-5 | Gernot Garbe | Der Hirte Israels. Eine
Untersuchung zur Israeltheologie des Matthäusevangeliums zur Beschreibung |
55,00 |
|
2005 |
| 105 | 3-7887-2067-0 978-3-7887-2067-4 |
Andreas Scherer | Überlieferungen von Religion und
Krieg. Exegetische und religionsgeschichtliche
Untersuchungen zu Richter 3-8 und verwandten Texten zur Beschreibung |
95,00 |
|
2004 |
| 104 | 3-7887-2035-2 978-3-7887-2035-3 |
Christian Münch | Die Gleichnisse Jesu im
Matthäusevangelium. Eine Studie zu ihrer Form und
Funktion zur Beschreibung |
75,00 |
|
2004 |
| 103 | 3-7887-2042-5 | Alexandra Grund | Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Psalm 19 im Kontext der nachexilischen Toraweisheit | 79,00 |
|
2004 |
| 102 | 3-7887-2007-7 978-3-7887-2007-0 |
Georg Freuling | Wer eine Grube gräbt. Der
Tun-Ergehen-Zusammenhang und sein Wandel in der
alttestamentlichen Weisheitsliteratur zur Beschreibung |
65,00 |
|
2004 |
| 101 | 3-7887-1998-2 978-3-7887-1998-2 |
Ute Neumann-Gorsolke | Herrschen in den Grenzen der
Schöpfung. AT-Anthropologie am Beispiel von Ps 8, Gen 1,
u.a. zur Beschreibung |
89,00 |
|
2003 |
| 100 | 978-3-7887-1946-3 | Michael Pietsch | Dieser ist der Sproß Davids.
Studien zur Rezeptionsgeschichte der Nathanverheißung im
alttestamentlichen und neutestamentlichen Schrifttum zur Beschreibung |
85,00 |
|
2003 |
| 99 | 3-7887-1944-3 978-3-7887-1944-9 |
Jenö Kiss | Die Klage Gottes und des Propheten.
Ihre Rolle in der Kompensation und Redaktion von Jer 11-12, 14-15 und 18 zur Beschreibung |
55,00 |
|
2003 |
| 98 | 978-3-7887-1918-0 | Jonathan Whitlock | Schrift und Inspiration / Studien
zur Vorstellung von inspirierter Schrift und inspirierter
Schriftauslegung im antiken Judentum und in den
paulinischen Briefen zur Beschreibung |
95,00 |
|
2002 |
| 97 | 978-3-7887-1916-6 | Axel Graupner | Der Elohist / Gegenwart und
Wirksamkeit des transzendenten Gottes in der Geschichte zur Beschreibung |
89,00 |
|
2002 |
| 96 | 978-3-7887-1888-6 | Nicola Wendebourg | Der Tag des Herrn / Zur
Gerichtserwartung im NT auf ihrem alttestamentlichen und
frühjüdischen Hintergrund zur Beschreibung |
85,00 |
|
2002 |
| 95 | 3-7887-1889-7 978-3-7887-1889-3 |
Martin Vahrenhorst | Ihr sollt überhaupt nicht
schwören / Matthäus im halachischen Diskurs zur Beschreibung |
95,00 |
|
2002 |
| 94 | 3-7887-1887-0 | Eberhart | Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament | 2002 | ||
| 93 | 978-3-7887-1859-6 | Jürgen U. Kalms | Der Sturz des Gottesfeindes. Traditionsgeschichtliche Studien zu Apokalypse 12 | 25,00 |
|
2001 |
| 92 | 978-3-7887-1858-9 | Johannes Goldenstein | Das Gebet der Gottesknechte / Jesaja 63,7 - 64,11 | 25,00 |
|
2001 |
| 91 | 978-3-7887-1855-8 | Adam, Janowski, Lichtenberger | Der königliche Held. Die Entsprechung von
kämpfendem Gott und kämpfendem König in Psalm 18 zur Beschreibung |
25,00 |
|
2001 |
| 90 | 978-3-7887-1830-5 | Matthias Millard | Die Genesis als Eröffnung der
Tora. Kompositions- und auslegungsgeschichtliche
Annäherungen an das erste Buch Mose zur Beschreibung |
39,00 |
|
2001 |
| 89 | 978-3-7887-1831-2 | Marc Wischnowsky | Tochter Zion. Aufnahme und
Überwindung der Stadtklage in den Prophetenschriften des
Alten Testaments.
zur Beschreibung |
19,95 |
|
2001 |
| 88 | 978-3-7887-1815-2 | Thomas Knöppler | Sühne im Neuen Testament.
Studien zum urchristlichen Verständnis der Heilsbedeutung des Todes Jesu zur Beschreibung |
39,00 |
|
2001 |
| 87 | 978-3-7887-1812-1 | Dorothea Erbele-Küster | Lesen als Akt des Betens. Eine Rezeptionsästhetik der Psalmen | 2000 | ||
| 86 | 978-3-7887-1779-7 | Jens Dechow | Gottessohn und Herrschaft Gottes. Der Theozentrismus des Markusevangeliums | 39,00 |
|
2000 |
| 85 | 978-3-7887-1751-3 | Peter Riede | Im Netz des Jägers. Studien zur Feindmetaphorik der Individualpsalmen | 39,00 |
|
2000 |
| 84 | 978-3-7887-1750-6 | Peter Hirschberg | Das eschatologische Israel. Untersuchungen zum Gottesvolkverständnis der Johannesoffenbarung. | 25,00 |
|
1999 |
| 83 | 978-3-7887-1718-6 | Andreas Scherer | Das weise Wort und seine Wirkung. Eine Untersuchung zur Komposition und Redaktion von Proverbia 10,1-22,16 | 1999 | ||
| 82 | 978-3-7887-1719-3 | Gerben S. Oegema | Zwischen Hoffnung und Gericht. Untersuchungen zur Rezeption der Apokalyptik im frühen Christentum und Judentum | 39,00 |
|
1999 |
| 81 | 3-7887-1717-3 | Schmid | Erzväter und Exodus. Untersuchungen zur doppelten Begründung der Ursprünge Israels innerhalb der Geschichtsbücher des Alten Testaments | 1999 | ||
| 80 | 978-3-7887-1706-3 | Adelheid Ruck-Schröder | Der Name Gottes und der Name Jesu. Eine neutestamentliche Studie | 1998 | ||
| 79 | 3-7887-1680-0 | Lukas Kundert | Die Opferung / Bindung Isaaks Band 2, Gen 22,1-19 in frühen rabbinischen Texten | 1998 | ||
| 78 | 3-7887-1668-1 | Lukas Kundert | Die Opferung / Bindung Isaaks Band 1. Gen 22,1-19 im Alten Testament, im Frühjudentum und im Neuen Testament | 1998 | ||
| 77 | 978-3-7887-1665-0 | Rolf Schäfer | Die Poesie der Weisen. Dichtotomie als Grundstruktur der Lehr- und Weisheitsgedichte in Proverbien 1-9 | 1998 | ||
| 76 | 3-7887-1646-0 | Schröter | Erinnerung an Jesu Worte. Studien zur Rezeption der Logienüberlieferung in Markus, Q, und Thomas | 1997 | ||
| 75 | 3-7887-1640-1 978-3-7887-1640-0 |
Hartenstein | Die Unzulänglichkeit Gottes im Heiligtum. Jesaja 6 und der Wohnort JHWHs in der Jerusalemer Kulttradition | 1997 | ||
| 74 | 3-7887-1619-3 | Bauks | Die Welt am Anfang / Zum
Verhältnis von Vorwelt und Weltanschauung in Gen 1 und
in der altorientalischen Literatur siehe: Theologie des Alten Testaments, 978-3-8252-4973-1 |
1997 | ||
| 73 | 3-7887-1618-5 | Onuki | Sammelbericht als Kommunikation. Studien zur Erzählkunst der Evangelien | 1997 | ||
| 72 | 3-7887-1608-8 | Konrad Schmid | Buchgestalten des Jeremiabuches. Untersuchungen zur Redaktions - und Rezeptionsgeschichte von Jeremia 30 - 33 im Kontext des Buches | 1996 | ||
| 71 | 3-7887-1514-6 978-3-7887-1514-4 |
Gunter Kennel | Frühchristliche Hymnen?
Gattungskritische Studien zur Frage nach den Liedern der frühen
Christenheit zur Beschreibung |
69,-- |
|
1995 |
| 70 | 978-3-7887-1503-8 | Thomas Pola | Die ursprüngliche Priesterschrift. Beobachtungen zur Literaturkritik und Traditionsgeschichte von Pg | 1995 | ||
| 69 | 3-7887-1501-4 978-3-7887-1501-4 |
Thomas Knöppler | Die theologia crucis des Johannesevangeliums. Das Verständnis des Todes Jesu im Rahmen der johanneischen Inkarnations- und Erhöhungschristologie | 1994 | ||
| 68 | 3-7887-1482-4 | Albani | Astronomie und Schöpfungsglaube | 1994 | ||
| 67 | 3-7887-1471-9 978-3-7887-1471-0 |
Weiss | Zeichen und Wunder. Eine Studie
zu der Sprachtradition und ihrer Verwendung im Neuen Testament zur Beschrebung |
34,-- |
|
1995 |
| 66 | 3-7887-1395-x 978-3-7887-1395-9 |
Wolfgang Kraus | Der Tod Jesu als Heiligtumsweihe.
Eine Untersuchung zum Umfeld der Sühnevorstellung in Römer
3,25-26a zur Beschreibung |
39,90 |
|
1992 |
| 65 | 3-7897-1381-x | Mommer | Samuel | 1993 | ||
| 64 | 3-7887-1340-2 | Lips | Weisheitliche Traditionen im Neuen Testament | 1990 | ||
| 63 | 978-3-7887-1322-5 | Kratz | Translatio imperii. Untersuchungen zu den aramäischen Danielerzählungen | 1991 | ||
| 62 | 978-3-7887-1308-9 | Klaus Koenen | Ethik und
Eschatologie im
Tritojesajabuch. Eine literaturkritische und redaktionsgeschichtliche
Studie zur Beschreibung |
24,80 |
|
1990 |
| 61 | 3-7887-1248-1 | Helge S. Kvanvig | Roots of Apocalyptic. The
Mesopotamian Background of the Enoch Figure and the Son of Man discription |
69,-- |
|
1988 |
| 60 | 3-7887-1269-4 | Breytenbach | Versöhnung | 1989 | ||
| 59 | 978-3-7887-1230-3 | Bernd Janowski | Rettungsgewißheit und Epiphanie des Heils. Band 1: Alter Orient | 1989 | ||
| 58 | Dietzfelbinger | Die Berufung des Paulus als Ursprung seiner Theologie | 1985 | |||
| 57 | 978-3-7887-0713-2 | Eberhard Blum | Die Komposition der Vätergeschichte | 1984 | ||
| 56 | 3-7887-0704-6 | Onuki | Gemeinde und Welt im Johannesevangelium | 1984 | ||
| 55 | 978-3-7887-1782-7 | Bernd Janowski | Sühne als Heilsgeschehen.
Traditions- und religionsgeschichtliche Studien zur
priesterschriftlichen Sühnetheologie zur Beschreibung |
85,00 |
|
2000 |
| 54 | Ittmann | Die Konfessionen Jeremias | 1981 | |||
| 53 | Loader | Sohn und Hohepriester | 1981 | |||
| 52 | 978-3-7887-0647-0 | Thiel | Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 26-45 | 1981 | ||
| 51 | Gerstenberger | Der bittende Mensch | 1980 | |||
| 48 | Barth | Die Jesaja - Worte in der Josiazeit | 1978 | |||
| 47 | Fritz | Tempel und Zelt | 1977 | |||
| 46 | 3-7887-0448-9 | Christoph Burger | Schöpfung und Versöhnung. Studien zum
liturgischen Gut im Kolosser- und
Epheserbrief zur Beschreibung |
19,90 |
|
1976 |
| 45 | Polag | Die Christologie der Logienquelle | 1977 | |||
| 44 | Baumgarten | Paulus und die Apokalyptik | 1976 | |||
| 43 | 3-7887-0409-8 | Henning Paulsen | Überlieferung und Auslegung in
Römer 8 zur Beschreibung |
24,90 |
|
1975 |
| 42 | Welten | Geschichte und Geschichtsdarstellung in den Chronikbüchern / weitere Kommentare zur Chronik | 1973 | |||
| 41 | 3-7887-0341-5 | Thiel | Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 1-25 | 1973 | ||
| 40 | Berger | Die Gesetzesauslegung Jesu 1: Markus u. Parallelen | 1972 | |||
| 39 | 3-7887-0049-1 | Gerhard Liedke | Gestalt und Bezeichnung
alttestamentlicher Rechtssätze. Eine formgeschichtlich-terminologische
Studie. zur Beschreibung |
22,-- |
|
1971 |
| 38 | 3-7887-0010-6 | Ludwig Schmidt | Menschlicher Erfolg und Jahwes
Initiative. Studien zu Tradition, Interpretation und Historie in
Überlieferungen von Gideon, Saul und David zur Beschreibung |
22,50 |
|
1970 |
| 37 | Schottroff | Der Glaubende und die feindliche Welt | 1970 | |||
| 35 | Jeremias | Kultprophetie und Gerichtsverkündigung in der späten Königszeit Israels | 1970 | |||
| 34 | Saebo | Sacharja 9-14 weitere Kommentare zu Sacharja 9-14 | 1969 | |||
| 33 | Lührmann | Die Redaktion der Logienquelle | 1969 | |||
| 31 | Boecker | Die Beurteilung der Anfänge des Königtums in den deuteronomischen Abschnitten des ersten Samuelbuches | 1969 | |||
| 30 | Schottroff | Der altisraelitische Fluchspruch | 1969 | |||
| 29 | Brandenburger | Fleisch und Geist | 1968 | |||
| 28 | Hermisson | Studien zur israelitischen Spruchweisheit | 1968 | |||
| 27 | Hans-Martin Lutz | Jahwe - Jerusalem und die Völker. Zur Vorgeschichte von Sacharja 12,1-8, 14,105 | 22,-- |
|
1968 | |
| 26 | Steck | Überlieferung und Zeitgeschichte in den Elia-Erzählungen | 1968 | |||
| 25 | Balz | Methodische Probleme der neutestamentlichen Christologie | 1967 | |||
| 24 | Rendtorff | Studien zur Geschichte des Opfers im Alten Israel | 1967 | |||
| 23 | Steck | Israel und das Gewalttsame Geschick der Propheten | 1967 | |||
| 22 | Kayatz | Studien zu Proverbien 1-9 | 1966 | |||
| 21 | Satake | Die Gemeindeordnung in der Johannesapokalypse | 1966 | |||
| 19 | Hermisson | Sprache und Ritus im altisraelischen Kult | 1965 | |||
| 16 | Lührmann | Das Offenbarungsverständnis bei Paulus und in Paulinischen Gemeinden | 1965 | |||
| 15 | Schottroff | Gedenken im Alten Orient und im Alten Testament | 1967 | |||
| 14 | Boecker | Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament | 1970 | |||
| 10 | Jeremias | Theophanie | 1965 | |||
| 9 | Bach | Die Aufforderungen zur Flucht und zum Kampf im alttestamentlichen Prophetenspruch | 1962 | |||
| 8 | Rolf Rendtorff | Studien zur Geschichte des Opfers im alten Israel. | ||||
| 7 | Henning Graf Reventlow | Das Heiligkeitsgesetz, formgeschichtlich untersucht. | ||||
| 6 | Reventlow | Das Heiligkeitsgesetz | 1961 | |||
| 5 | Ulrich Wilckens | Die Missionsreden der Apostelgeschichte. Form- und traditionsgeschichtliche Untersuchungen | 1960 | |||
| 4 | Baltzer | Das Bundesformular | 1964 | |||
| 3 | Dietrich Rössler | Gesetz und Geschichte. Untersuchungen zur Theologie der jüdischen Apokalyptik und der pharisäischen Orthodoxie (gebrauchtes Buch) | 1962 | |||
| 2 | Plöger | Theokratie und Eschatologie | 1968 | |||
 |
Benedikt Bauernschmitt Rache und Vergeltung im Alten Testament Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, 496 Seiten, Gebunden, 978-3-525-50504-5 150,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 178 Philologische, motivgeschichtliche und erzähltextanalytische Perspektiven auf einen umstrittenen Themenkomplex Rache ist faszinierend und verstörend zugleich – obwohl von einer Sphäre archaischer Anmutung belastet, fesseln Racheerzählungen Menschen seit Jahrtausenden. Die darin erkennbare Ambivalenz zeigt sich auch im Alten Testament, wo Racheakte einerseits zugunsten der göttlichen Prärogative limitiert werden, andererseits aber auch von brutalem Rachehandeln erzählt wird. Benedikt Bauernschmitt unternimmt es, den entsprechenden Begrifflichkeiten mithilfe eines multiperspektivischen Ansatzes auf die Spur zu kommen. In einem Dreischritt aus philologischem, motivgeschichtlichem und narratologischem Methodenrepertoire klärt der Autor, was überhaupt unter „Rache“ und „Vergeltung“ im Alten Testament verstanden werden kann und in welchen Erscheinungsformen sie auftreten. Die Analyse des breit gestreuten Textbefundes zeigt, dass hier der ethische und theologische Umgang mit einem anthropologischen Basisphänomen aus unterschiedlichen Perspektiven ventiliert wird. Inhaltsverzeichnis |
 |
Sebastian
Ziera Die Danielrezeption im Markusevangelium Vandenhoeck & Ruprecht, 2023, 364 Seiten, Gebunden 978-3-525-50030-9 130,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testamen
Band 177 Sebastian Ziera widmet sich der Analyse der Danielrezeption im Markusevangelium. Dabei untersucht er die Text-Text-Bezüge nicht nur punktuell, sondern konzeptionell und gibt einen Gesamtüberblick über ihre Bedeutung für das gesamte Markusevangelium. Als methodischer Ansatz kommen die Erkenntnisse aus der Intertextualitätsforschung, besonders des textorientierten Modells, zum Tragen. Die Untersuchung zeigt, dass der Autor des Markusevangeliums die Rezipienten seines Werkes überdeutlich und sehr bewusst auf das Danielbuch verweist. Dies wird besonders an der Endzeitrede in Mk 13 sichtbar. Weil zudem über das gesamte Evangelium hinweg immer wieder mit unterschiedlicher Deutlichkeit auf das Danielbuch angespielt wird, legt sich der Schluss nahe, dass der Autor des Markusevangeliums das Danielbuch prinzipiell als Subtext seinen Hörern bzw. Lesern präsentiert. Die intertextuellen Bezüge zwischen dem Markusevangelium und dem Danielbuch erweisen sich damit als eine wesentliche Perspektive für ein angemessenes Verständnis des Markusevangeliums. Dabei wird das Danielbuch vom Markus aber nicht nur aufgenommen, vielmehr findet eine kritische und korrigierende Auseinandersetzung mit wesentlichen Inhalten statt: Dies betrifft vor allem die im Danielbuch vorhergesagten Zeiten und Zeichen, den endzeitlichen Krieg und die Rolle des Tempels. Das herausgearbeitete Profil, welches in Bezug auf die Danielrezeption als ambivalent beschrieben werden muss, lässt sich dabei am besten in die Zeit nach der Tempelzerstörung durch die Römer im Jahr 70 n.Chr. einordnen. Ziera liefert damit nicht nur Erkenntnisse in Bezug auf die inhaltliche Ausrichtung des Markusevangeliums, sondern auch wichtige Impulse für die Frage nach der historischen Einordnung. Blick ins Buch |
 |
Miriam von Nordheim-Diehl Streit um Korach Eine biblische Figur zwischen Numeri, den Psalmen und der Chronik Vandenhoeck & Ruprecht, 2023, 288 Seiten, Gebunden, 978-3-525-56087-7 130,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 176 Miriam von Nordheim-Diehl behandelt das „Korach-Problem“ des Alten Testaments. Als das „Korach-Problem“ lässt sich folgende Frage beschreiben: Wie kann es sein, dass – wie Num 16f. berichtet – ein Levit mit Namen Korach einen Aufstand gegen Mose und Aaron anführte, er als Strafe mitsamt allen, die zu ihm gehörten, vom Erdboden verschluckt wurde, und trotzdem seine Nachkommen, die Söhne Korachs, als Psalmendichter Berühmtheit erlangten? Die Söhne Korachs werden gemäß den Psalm-Überschriften als Verfasser oder zumindest Sammler und Herausgeber der sogenannten Korachpsalmen angegeben – Psalmen, die zum Teil eine ausgeprägte Zionstheologie enthalten (so Ps 46 und 48). Aber nicht nur das verwundert. Darüber hinaus stellen die Korachiter für die Verfasser der Chronik eine elementare Stütze des Tempelpersonals dar. Der Chronik zufolge waren die Korachiter nicht bloß Leviten, sondern sie waren berühmte Sänger und Torwächter und kämpften sogar als Helden an der Seite Davids. Historisch gesehen wäre eine solche Karriere für die Nachkommen eines Aufrührers, eines Rebellen gegen Mose, undenkbar. Leseprobe |
 |
Ulrike
Beiroth Facetten von Gerechtigkeit Das Lexem Gerechtigkeit in Spr 10,1–22,16; 25–29 Vandenhoeck & Ruprecht, 2022, 384 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-525-55297-1 100,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 170 Gerechtigkeit scheint ein zentrales Thema alttestamentlicher Texte zu sein. Doch wie nähert man sich einem derart aufgeladenen Begriff an? Ulrike Beiroth widmet sich dem Lexem Gerechtigkeit in Spr 10,1–22,16; 25–29 und arbeitet dessen Bedeutungsebenen heraus. Das Ergebnis ist eine semantische Tiefenbohrung, die die Facetten des Lexems methodisch entschlüsselt. Statt bei der üblichen Übersetzung von "Gerechtigkeit" mit Gerechtigkeit/gerecht/Gerechter stehen zu bleiben, erfasst Beiroth die verschiedenen Sinndimensionen des Begriffs. Dabei kristallisiert sich heraus, dass die klassischen Übersetzungen des Lexems einerseits zu kurz greifen, dass jedoch andererseits auf den Gerechtigkeitsbegriff nicht einfach verzichtet werden kann. Die philologische Detailarbeit an den poetischen Einzelsprüchen ordnet sie abschließend in den Kontext des Sprüchebuches in seiner Endgestalt ein. Die einzelnen Facetten von Gerechtigkeit ergeben ein Gesamtbild, das bis in aktuelle Debatten hinein anschlussfähig ist. Blick ins Buch |
 |
Peter
Riede Zwischen Mensch und Gott Vandenhoeck & Ruprecht, 2022, 424 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-525-56074-7 100,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 169 Psalm 45 und die Bedeutung von König und Königin im Rahmen der judäischen Herrschaftstheologie Ps 45 entfaltet Grundlagen der judäischen Herrschaftstheologie und spiegelt in besonderer Weise die Verhältnisse am Königshof mit den dort üblichen Kommunikationsstrukturen und Zeremonien. In seinem Zentrum steht zum einen der König, dessen Rolle und Amt durch kriegerische und juridische Funktionen bestimmt ist und so die Außen- und Innendimension von Herrschaft erfasst. Als Amtsträger, nicht als Person ist er „zwischen Mensch und Gott“ platziert, hat teil an göttlichen Qualitäten und kann daher auch als „Gott“ tituliert werden. An der Seite des Königs ist als weiblicher Teil des Königtums die Königin, der ebenfalls eine Sonderrolle zukommt, steht sie doch zwischen König und Volk und hat wesentlichen Anteil am Erhalt der Dynastie. Peter Riede arbeitet die kompositionellen und die motiv- und traditionsgeschichtlichen Zusammenhänge des Psalms heraus und macht sie für eine Rekonstruktion des Hof- und Palastlebens in Juda fruchtbar. Dabei zeigt sich, dass die den Psalm prägenden Bildkonstellationen Teil eines kulturübergreifenden Repertoires sind, das sich auch in der Bildkunst nachweisen lässt. Blick ins Buch |
 |
Siegfried
Bergler Judas Einer der nachösterlichen Zwölf Vandenhoeck & Ruprecht, 2022, 1179 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-525-56054-9 160,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 168 Jesu Verhaftung bedurfte keines Verräters Judas wird in allen Evangelien als „einer der Zwölf“ – nicht wie die anderen als „einer seiner Jünger“ – charakterisiert. Die These Siegfried Berglers ist, dass „die Jünger“ und „die Zwölf“ zwei verschiedene Gruppen bezeichneten: Erstgenannte, in unterschiedlicher Zahl, waren Jesu Schüler; hingegen zeugen die festen Zwölf-Namen-Listen von einem nachösterlichen Gremium/Presbyterium der Jerusalemer Urgemeinde, das sich aufgrund einer Christophanie als Repräsentanz des endzeitlichen Israel verstand. Diesem Kollegium gehörten (auch) vormalige Jünger Jesu an – und Judas. Daher der Titel Judas und die nachösterlichen Zwölf. Die Monographie umfasst neben der Exegese sämtlicher Judas-Auftritte eine Betrachtung aller Zwölfer-Stellen im NT – beginnend mit 1Kor 15,5 („erschienen den Zwölfen“) über den Befund der Logienquelle („...sitzen auf zwölf Thronen“, Mt 19,28 par Lk 22,30) bis zu Apk 21 („zwölf Grundsteine“). Auch erfolgt eine kritische Würdigung des ambivalenten Judas-Bildes im gnostischen Judas-Evangelium. Judas, der in der Gemeinde eine prominente Funktion ausübte (vgl. Apg 1,20: „sein Aufsichtsamt“), dürfte den Glauben an Jesu göttliche Herkunft oder Messianität aufgekündigt, sich zum Judentum zurückgewandt (vgl. Joh 6,64.66.71) und dadurch zur Auflösung des Zwölferkreises beigetragen haben. Man hat ihn verteufelt, für tot erklärt (vgl. die drei verschiedenen „Tode“ des Gottlosen: Mt 27, Apg 1, Papias) und schließlich in die Vita Jesu als dessen „Verräter“, korrekt: „Auslieferer“, zurückprojiziert (retrojiziert). |
 |
Seo-Jun Kim Gott ist es ja, der uns für gerecht erklärt Vandenhoeck & Ruprecht, 2023, 512 Seiten, Gebunden, 978-3-525-56088-4 150,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 167 Eine Studie zu den verschiedenen Bedeutungen und Funktionen der δικαι-Termini im Römerbrief Dieses Buch ist das Ergebnis einer Studie, die die Bedeutung und Rolle der im Römerbrief häufig verwendeten δικαι-Termini analysiert. Seo-Jun Kim zeigt, dass die Terminologie des Paulus nicht im Rahmen einer theologischen Kategorie aufgeht, vielmehr verschiedenste referenzielle Bedeutungen aufweist und eine Vielzahl von Rollen im jeweiligen Kontext spielt. Bestehende Studien haben sich hauptsächlich auf die Interpretation des Ausdrucks δικαι konzentriert und argumentiert, dass es sich hierbei um Gottes Gabe (R. Bultmann), Gottes rettende Macht (E. Käsemann, P. Stuhlmacher) oder Gottes Bundestreue (J. D. G. Dunn, N. T. Wright) handele. Diese Studie untersucht erschöpfend und von Grund auf neu alle δικαι Begriffe im Römerbrief in ihren jeweiligen Kontexten und beleuchtet sie in Korrelation zu den entsprechenden Referenztexten. Darüber hinaus finden die traditionsgeschichtlichen Beziehungen der δικαι-Terminologie des Paulus hinsichtlich ihrer gedanklichen und sprachlichen Ähnlichkeit mit dem Alten Testament und der jüdischen Literatur in jeder exegetischen Analyse ausführliche Erläuterung. Somit liefert dieses Buch eine präzise Kategorisierung der referenziellen Semantik der δικαι-Begriffe. Die Leser sollen befähigt werden, die verschiedenen Argumentationsstränge im Römerbrief mit Blick auf diesen Schlüsselbegriff besser nachzuvollziehen. |
 |
Ulrich Mell Das Evangelium in einem rhetorischen Brief Ein Kommentar zum 1. Thessalonicherbrief Vandenhoeck & Ruprecht, 2022, 472 Seiten, Gebunden, 978-3-525-56079-2 140,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 166 Zum ersten Mal im frühen Christentum wird hier die heilsmittlerische Bedeutung von Christus entfaltet.Der Apostel Paulus leitet mit dem von ihm verfassten 1. Thessalonicherbrief einen historischen Paradigmenwechsel ein, indem er das im frühen Christentum bislang mündlich verkündigte Evangelium von Jesus Christus in einer Schrift entfaltet. Es beginnt ca. 50 n.Chr. die mediale Revolution des Christentums, die sukzessive zu der Sammlung von 27 Schriften im Neuen Testament führen wird. Brieftechnische Merkmale am Beginn und Ende zeigen, dass ein halbamtliches Schreiben der Gemeindegründer an die christliche Bekenntnisgemeinde in Thessaloniki vorliegt. Da Paulus vorschreibt, dass sein Brief in einer Gemeindevollversammlung vorgelesen werden soll, liegt in seiner Mitte eine mit rhetorischen Mitteln gestaltete Kunstrede vor, die aus Narratio, Propositio, Argumentatio und Peroratio besteht. Das rhetorische Genre ist eine beratende Lobrede, die die auf die Wiederkunft Christi sehnsüchtig wartende Naherwartungsgemeinde in den von ihr praktizierten Tugenden von Glauben, Liebe und Hoffnung fördern will. Ziel ist eine vollkommene Heiligkeit, um dem aus dem Himmel herabsteigenden Parusie-Christus einen standesgemäßen Empfang zu bereiten. Besonderen Fokus legt Ulrich Mell auf die im Abschnitt Beweisführung (argumentatio) gemachten ethischen Anweisungen zur Ehe, zu Geschäftsbeziehungen, zur Geschwisterliebe und Haushaltsführung. Die Frage der Hoffnung, wie verstorbene Gemeindeglieder an dem irdischen Zukunftsheil teilnehmen können, löst Paulus, indem er aus dem Glauben an die Auferstehung Christi die Auferstehung eben in diesem Glauben Verstorbener folgert. Damit wird zum ersten Mal im frühen Christentum die heilsmittlerische Bedeutung von Christus entfaltet, sodass die aus Lebenden und wieder lebendig Gewordenen bestehende Gemeinde an dem zukünftigen Sieg der Gottesherrschaft über die Endzeitgewalt beteiligt wird. Inhaltsverzeichnis Blick ins Buch |
 |
Martina
Weingärtner Die Impertinenz Jakobs Vandenhoeck & Ruprecht, 2021, 346 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-525-56058-7 95,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 165 Eine relecture der Jakob-Esau-Erzählungen vor einer text- und metapherntheoretischen Hermeneutik Paul Ricoeurs Nur ein trickreicher Tauschhandel? Die Rezeption Paul Ricœurs erfolgt in den alttestamentlichen Bibelwissenschaften bis heute eklektisch. Martina Weingärtner setzt hierzu einen Kontrapunkt und erarbeitet die Anwendung seiner Hermeneutik im Dialog mit alttestamentlicher Exegese. Die Syntheseleistung besteht darin, die Reflexionen Ricœurs zu bündeln und in eine Methodik des Textverstehens zu übersetzen, die das Proprium biblischer Texte wahrnimmt. Die Analyse (Erklären) der Episode des Linsengerichts (Gen 25,29–34) bildet den Ausgangspunkt der Studie. In einer konstruktiven Erweiterung historisch-kritischer Methodik zielt die Interpretation (Verstehen) darauf, diese Erzählung als bedeutungsvolle Geschichte und deren existentielle Funktion wahrzunehmen. So kann die Autorin neue Erkenntnisse gegenüber bisherigen Exegesen präsentieren, die von einer Esau-Konzentration und dessen negativer Einschätzung absehen. Die „Verkaufsepisode“ als Schulderzählung zu lesen, eröffnet eine vertieft theologische Deutung eines diesbezüglich eher stiefmütterlich behandelten Textes. Inhaltsverzeichnis Blick ins Buch |
 |
Tanja
Forderer Was Gott zusammengefügt hat...? Vandenheock & Ruprecht, NTH, 2021, 439 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3527-2 130,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 164 Eine argumentationsanalytische Untersuchung von Ehe-Scheidung im Neuen Testament am Beispiel von Mk 10,1–12 und 1Kor 7,10–16 (K)Ein Scheidungsverbot im Neuen Testament? – Zu Ehe-Scheidungsargumentationen im Neuen TestamentWofür argumentieren neutestamentliche Texte, wenn sie von Ehescheidung sprechen? Welche Vorstellungen von Ehe setzen sie voraus und welche Argumente führen sie an? Die vorliegende Arbeit geht diesen Fragen beispielhaft anhand von Mk 10,1-12 und 1Kor 7,10-16 nach. Mit Hilfe des argumentationsanalytischen Ansatzes von F. van Eemeren und R. Grootendorst werden die Scheidungsargumentationen analysiert und die den Texten übergeordneten Argumentationsfiguren herausgearbeitet. Für die argumentative Entwicklung der Scheidungspositionen in Mk 10,1-12 und 1Kor 7,10-16 erweist sich insbesondere ihr literarischer Kontext – die markinischen Streitgespräche und 1 Kor 5-7 – als relevant. Hinzu kommt die Bedeutung der antiken Debatten über Ehe und Scheidung, an denen die frühchristlichen Texte partizipieren, aber auch eigene Akzente setzen. Das gilt insbesondere für die Rezeption von Gen 2,24. Ein Ausblick, der sich mit der inner-neutestamentlichen Rezeption von Ehekonzepten und mit der Bezugnahme auf Gen 2,24 in Eph 5,21-33 befasst, schließt die Untersuchung ab. Inhaltsverzeichnis Blick ins Buch |
 |
Tobias
Wieczorek Die Nichtgläubigen Vandenheock & Ruprecht, NTH, 2021, 223 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-3524-1 85,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 163 Über die Funktion abgrenzender Sprache bei Paulus Abgrenzung der Glaubenden gegenüber ihrer nichtgläubigen Vergangenheit und Umwelt mit der Bezeichnung „die Nichtgläubigen“ Teil der Entstehung des frühen Christentums ist die Entwicklung einer ›christlichen‹ Sprache, die dieses beschreibt und bezeichnet. Der Glaube war in diesem Prozess für Paulus das entscheidende Kriterium von Zugehörigkeit und Abgrenzung. Bemerkenswerterweise spricht Paulus über die Nichtgläubigen - also diejenigen, die nicht dazu gehören - völlig ohne Polemik und die Bezeichnung begegnet auch in keinem Lasterkatalog. Die Untersuchung der Bezeichnung „die Nichtgläubigen“ hat gezeigt, dass Paulus diese weniger dazu gebraucht, eine bestimmte Gruppe als nicht oder ungläubig zu beschreiben, oder zu diskutieren, warum die Nichtgläubigen nicht glauben. Vielmehr hat die Bezeichnung eine bestimmte paränetische und identitätsstiftende Funktion: Sie dient der Abgrenzung gegenüber der nichtgläubigen Vergangenheit der Glaubenden, sie dient der Abgrenzung gegenüber der heidnischen Welt und sie dient der (eschatologischen) Vergewisserung der Glaubenden. Blick ins Buch |
 |
Heinz-Dieter
Neef Geschichte, Schuld und Rettung Vandenheock & Ruprecht, NTH, 2021, 224 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3521-0 978-3-525-50501-4 95,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 162 Studien zur Redaktion, Komposition und Theologie von Ri 1,1-3,30 "Geschichte, Schuld und Rettung " die Theologie von Ri 1-3 auf den Punkt gebrachtDie Monographie setzt mit einem Forschungsbericht zu neueren Tendenzen der Richterbuchforschung ein. Das Richterbuch wird mit unterschiedlichen Botschaften verbunden. Einige Ausleger sehen seine Botschaft in dem Dreiklang von "Gewalt, Herrschaft und Rettung", andere erkennen in ihm die Darstellung starker Frauen oder sehen im Humor das Charakteristikum des Buches. In methodischer Hinsicht zeigen sich unterschiedliche Zugänge zum Buch: mehrschichtiges Wachstum des Buches; Retterbuch als Grundlage; Frauenbuch; biblische Auslegung. - Es folgen Textexegesen zu Ri 1,1-36 mit dem Hinweis auf Siege und Niederlagen der Stämme Israels, zu 2,1-5, in dem das Versagen Israels beschrieben wird, zu 2,6-10 mit seiner Gegenüberstellung von Josuazeit und Richterzeit, zu 2,11-3,6 mit den Rahmenelementen der Richtererzählungen, zu Othniel 3,7-11 und Ehud und Eglon 3,12-30 als die beiden ersten Richter-Helden-Erzählungen. Die Monographie versucht, den überlegten Aufbau dieser Anfangskapitel aufzuzeigen und arbeitet deren theologischen Schwerpunkt mit dem Dreiklang von "Geschichte, Schuld und Rettung" heraus. Die ersten Kapitel sind im wesentlichen das Werk des Deuteronomisten, der mit einer Fülle von Überlieferungen, Traditionen und Informationen die Richterzeit geformt und charakterisiert hat. Dass hinter dieser Darstellung durchaus historische Erfahrungen aus der Zeit der Stämme Israels stehen können, sollte nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Blick ins Buch |
 |
Kathrin
Gies Strebe nach Schalom! Vandenheock & Ruprecht, NTH, 2021, 343 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-3494-7 110,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 161 Eine biblisch-ethische Lektüre von Psalm 34 Die ethische Bedeutung biblischer Texte wie Psalm 34 muss sich im Urteil des Lesenden bewähren.Die ethische Relevanz biblischer Texte liegt in ihrer Literarizität begründet, die fremde Textwelten entstehen lässt und dem Lesenden Möglichkeitsräume des Denkens und Handelns eröffnet. Als Zeugnisse wurzeln sie in einem konkreten soziokulturellen Kontext und fordern ein kritisches ethisches Urteil des Lesenden. Ihre ethische Bedeutung entscheidet sich daran, ob sie auch in der Gegenwart als gerecht bezeugt werden können. Dieses Programm einer ethischen Lektüre biblischer Texte, das an Überlegungen Paul Ricoeurs anschließt, wird an einer Auslegung von Psalm 34 erprobt. Der Psalm erweist sich als ein Kompendium ethischer Schlüsselbegriffe und bietet mit seinem Aufruf zur Solidarisierung mit den Armen und zum Streben nach Gerechtigkeit und Šalom Grundlinien ethischer Orientierung an. Inhaltsverzeichnis Blick ins Buch |
 |
Nina Meyer zum
Felde Hiobs Weg zu seinem persönlichen Gott Vandenheock & Ruprecht, NTH, 2019, 267 Seiten, 520 g, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3428-2 75,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 160 Studien zur Interpretation von Psalmentheologie im Hiobbuch Das Hiobbuch erzählt die Geschichte des Mannes Hiob, der in seinem Vertrauen auf Gott zutiefst erschüttert wird. Nachdem er seinen Reichtum, seine Kinder und seine Gesundheit verloren hat, sieht er sich nur noch in der Lage, zu klagen. Anders als die Beter aus den Psalmen kann er Gott nicht mehr direkt ansprechen oder Bitten an ihn richten. Im weiteren Verlauf des Buches durchläuft seine Gottesbeziehung jedoch eine Veränderung. Diese führt von dem Wunsch zu sterben und Gottes bedrohlicher Nähe zu entkommen hin zu dem Wunsch nach Gottesnähe und einer Antwort Gottes. Nach einer Gottesbegegnung bekundet Hiob seine Absicht, sich in allen Schwierigkeiten seines Lebens wie in den Psalmen an seinen Gott zu wenden. Die Autorin untersucht, wie Hiobs Weg zu seinem persönlichen Gott verläuft, welche Faktoren auf diesem Weg entscheidend sind und wie sich die Hiobautoren kritisch mit der Theologie der Psalmen auseinandersetzen. Blick ins Buch |
 |
Katrin
Zehetgruber Zuwendung und Abwendung Vandenheock & Ruprecht, NTH, 2019, 451 Seiten, 890 g, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3412-1 89,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 159 Studien zur Reziprozität des JHWH/Israel-Verhältnisses im Hoseabuch „Unabwendbare Reziprozität“ als alternative Deutungsmöglichkeit des alttestamentarischen Hoseabuches. Die Komposition des Hoseabuches ist seit ihren Anfängen von Schilderungen der Auseinandersetzung JHWHs mit dem als Vergehen charakterisierten Verhalten Israels bzw. Judas in der Innen-, Außenpolitik und Kult geprägt. Die Auseinandersetzung JHWHs mit den Vergehen wird dabei in der alttestamentlichen Forschung zumeist als »unbedingte Gerichtsankündigung« bezeichnet. Katrin Zehetgruber untersucht anhand von exemplarischen Exegesen, ob diese Bezeichnung den Texten gerecht wird oder sich im Rahmen des Handlungsmodells der sozialen Interaktion andere Deutungsmöglichkeiten für die geschilderten Vorgänge eröffnen. Als alternative Deutungsmöglichkeit erweist sich dabei die Rede von einer »unabwendbaren Reziprozität«, welche im Hoseabuch als prägendstes Element der Beziehung zwischen JHWH und Israel bzw. Juda im Guten wie im Schlechten dargestellt wird. Blick ins Buch Dr. Katrin Zehetgruber arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der theologischen Fakultät der Universität Rostock. |
 |
Szabolcs-Ferencz
Kató Jhwh: der Wettergott Hoseas? Vandenheock & Ruprecht, NTH, 2019, 384 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3402-2 89,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 158 Der ursprüngliche Charakter Jhwhs ausgehend vom Hoseabuch Der Monotheismus in Israel entwickelte sich über einen längeren Zeitraum hin. Was stand am Anfang dieser Entwicklung? Was für ein Gott war Jhwh, bevor er zu „dem einen“ Gott wurde? Die Antworten auf diese Fragen variieren, je nachdem, wie man den Namen Jhwh etymologisch herleitet und wie man für literarisches Urgestein gehaltene Texte literar- und traditionsgeschichtlich einordnet. In der Regel werden als Quellen dabei fast ausschließlich poetische Texte herangezogen (v.a. Ri 5, Hab 3, Dtn 33; Ps 68). Szabolcs-Ferencz Kató geht dieser Frage auf eine andere Weise nach, indem er nämlich mit Hosea ein relativ altes prophetisches Buch motivgeschichtlich untersucht und darin ein archaisches Gottesprofil herausarbeitet. Dementsprechend dominieren bei Jhwh die Wettergottzüge des Baal-Hadad-Typs, was sich so interpretieren lässt, dass Jhwh ursprünglich selbst ein Wettergott dieser Art war. Leseprobe |
 |
Elisabeth
Krause-Vilmar Nah ist und schwer zu fassen der Gott Vandenheock & Ruprecht, NTH, 2019, 180 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3415-2 59,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 157 Die ambivalente Beschreibung der Nähe Gottes in Jer 20,7-18 und Ps 139 Elisabeth Krause-Vilmar untersucht die ambivalente Beschreibung der Nähe Gottes in Psalm 139 und Jer 20,7-18. Psalm 139 handelt von der Nähe Gottes, die dynamisch und existentiell beschrieben wird: als bedrohlich und fremd, aber auch als beschützend und tröstlich. Eine solch existentielle und ambivalente Erfahrung der Nähe Gottes kennzeichnet auch die letzte Konfession Jeremias (Jer 20,7-18). So weisen Ps 139 und Jer 20,7-18 über die heute – auch in Predigten – verbreitete Vorstellung hinaus, die Nähe Gottes werde vorwiegend positiv und die Ferne negativ erfahren. Die Studie verbindet die Exegese von Jer 20,7-18 und Ps 139 mit der Rezeption der Texte in ausgewählten Predigten aus dem 20. Jahrhundert von Dietrich Bonhoeffer und Paul Tillich, um Möglichkeiten der religiösen Rede von der Nähe Gottes auszuloten. Das Gottesbild von Jer 20,7-18 und Ps 139 beinhaltet herausfordernde Aspekte, die von einem inneren Ringen mit Gott erzählen. Die Autorin ermutigt dazu, in der Verkündigungspraxis diese Ambivalenzen im Gottesbild anzusprechen. Sie plädiert für eine detaillierte Wahrnehmung der in den Texten verarbeiteten Erfahrung, dass die Nähe Gottes nicht einlinig positiv sondern zugleich herausfordernd und bedrängend sein kann. Sie führt vor, wie der hermeneutische Bogen von der Exegese bis in die heutige Predigtpraxis zu spannen ist – einen Bogen, der unter der Spezialisierung der gegenwärtigen theologischen Wissenschaft nicht selten aus dem Blick gerät. Leseprobe |
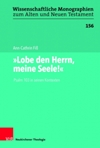 |
Ann-Cathrin
Fiß Lobe den Herrn, meine Seele! Psalm 103 in seinen Kontexten Vandenheock & Ruprecht, NTH, 2018, 352 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3341-4 79,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 156 Psalm 103 zeichnet sich durch seine rezeptions- und frömmigkeitsgeschichtliche Bedeutung für das Christentum aus. Ann-Cathrin Fiß zeigt, dass sich Psalm 103 schon in seiner Entstehung als ein theologischer Reflexionstext darstellt, der verschiedene zentrale Traditionen aus allen drei Teilen des späteren Kanons miteinander in Beziehung setzt. Die Autorin stellt die Bedeutung des Psalms als ein wichtiger Textzeuge für späte Texte heraus, die eine Art frühe Form von theologischen Kompendien entwickeln. Die Entstehungszeit des Psalms wird in diesem Werk in das 3. Jh. v. Chr. datiert. Fiß konzentriert sich in ihrer Arbeit auf die innere thematische Kohärenz des Psalms, die sie motivgeschichtlich auslegt. Leseprobe |
 |
Michael
Emmendörfer Gottesnähe Zur Rede von der Präsenz JHWHs in der Priesterschrift und verwandten Texten Vandenheock & Ruprecht, NTH, 2018, 336 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3338-4 75,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 155 Michael Emmendörffer untersucht die Priesterschrift und zeigt, wie diese nach der Katastrophe von 587 v.Chr. unter veränderten politischen, sozialen und religiösen Rahmenbedingungen die Gegenwart und Nähe Gottes wieder neu begründet und in wesentliche, hermeneutische Schlüsseltexte (Schöpfung; Sintflut; Abraham und Exodus) einschreibt. Emmendörffer zeichnet die relecture älterer Gründungsmythen und die Transformationsprozesse detailliert nach. Der Autor berücksichtigt dabei analoge Gotteskonzeptionen in den Kulturen Ägyptens und Mesopotamiens, die der Arbeit eine besondere religions- und theologiegeschichtliche Tiefe verleihen. Betrachtungen zeitgenössischer Konzeptionen des Ezechielbuches und Jes 40–55* fließen ebenfalls in die Arbeit ein. Michael Emmendörffer leistet damit insgesamt nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Theologie der Priesterschrift und zur strittigen Frage nach ihrer literarischen Beschaffenheit und Integrität, sondern bezeichnet mit der paradigmatischen Frage, wie die Gegenwart Gottes angesichts existenzieller Krisenerfahrungen gedacht werden kann – eine für Theologie und Kirche bleibend aktuelle Herausforderung, deren Bearbeitung bereits in der biblischen Traditionsbildung selbst beobachtet werden kann. Die dort gegebenen Antworten tragen deutlich das Gepräge ihrer Zeit, aber sie schärfen das Bewusstsein für die hermeneutische Aufgabe, von der Gegenwart und Nähe Gottes beim Menschen immer wieder neu zu reden. Leseprobe |
 |
Marion Christina
Hauck DYNAMIS EIS SOTERIAN Eine Untersuchung zum semantischen Hintergrund eines neutestamentlichen Syntagmas Vandenhoeck und Ruprecht, 2018, 672 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3328-5 75,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 154 Marion Christina Hauck geht anhand einer Sichtung paganen und jüdischen Quellenmaterials in griechischer Sprache dem semantischen Horizont nach, vor dem die δύναμις-Begrifflichkeit in Verbindung mit σῴζειν κτλ.-Terminologie bei neutestamentlichen Autoren (Paulus, Verfasser des 1. Petrusbriefes) Verwendung gefunden hat und von den antiken Lesern bzw. Hörern dieser Schriften vermutlich verstanden worden ist. Der Akzent der Analyse liegt auf einer Erforschung des Bedeutungsgehaltes des in der (Profan-)Gräzität sowie im Neuen Testament begegnenden Syntagmas δύναμις εἰς σωτηρίαν. Dabei zeigt die Autorin, dass die Verfasser der neutestamentlichen Texte in ihrem δύναμις εἰς σωτηρίαν-Gebrauch an eine bereits bestehende pagane Wortverbindung anknüpften: Die im Neuen Testament zum Einsatz kommende Wendung δύναμις (θεοῦ) εἰς σωτηρίαν (Röm 1,16; 1Petr 1,5) wird im Rahmen der (profan-) griechischen außerbiblischen Rede von δύναμις εἰς σωτηρίαν verortet, und es werden mögliche Lektüreoptionen und semantische Anknüpfungsmöglichkeiten im Blick auf die Leser- bzw. Hörerschaft besagter neutestamentlicher Schriften erschlossen. Leseprobe |
 |
Hoby Randriambola-Ratsimihah Wenn ein Mensch stirbt, lebt er dann wieder auf? (Hi 14,14) Zur Frage einer Jenseitshoffnung im hebräischen und im griechischen Hiobbuch Vandenhoeck und Ruprecht, 2018, 320 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3325-4 65,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 153 „Wenn ein Mensch stirbt, lebt er dann wieder auf?“ Hiob artikuliert diese Frage in Hi 14,14 so direkt wie kein anderer in der Bibel. Doch eine direkte Antwort gibt er nicht. Die Antwort muss man aus seinen Reden erschließen und diese hängt davon ab, was man unter „sterben“ und „wiederaufleben“ versteht. Die Forscher, die dieses Thema behandelt haben, sind verschiedenster Meinungen. Manche bejahen die Frage, manche verneinen sie und andere vertreten eine Zwischenposition. Dies liegt vor allem daran, dass die methodischen Zugänge unterschiedlich und z.T. von textexternen Hypothesen überlagert sind. Hinzu kommt, dass das Hiobbuch durch seinen Stil und Wortschatz besonders anspruchsvoll ist. In der vorliegenden Arbeit ist die Autorin deshalb um eine textgemäße Deutung der Texte bemüht. Und dies macht sie auf eine originelle und innovative Weise. Dabei geht sie anhand drei Leittexte auf die Frage einer Jenseits- bzw. Auferstehungshoffnung im Hiobbuch differenziert und umsichtig ein. Anschließend versucht sie, die Rolle des spätnachexilischen Hiobbuches in der Frage nach der Auferstehungsvorstellung und dem ewigen Leben in der Bibel zu definieren. Mit diesem Buch füllt die Autorin ebenfalls eine Forschungslücke aus, denn sie bearbeitet die hebräischen Texte nicht nur religions-, traditions- und theologiegeschichtlich, sondern macht auch eine Exegese der griechischen Leittexte. Trotz der Komplexität des Themas ist die Arbeit gut zu lesen und verständlich geschrieben Leseprobe |
 |
Simon
Schäfer Gegenwart in Relation Eine Studie zur präsentischen Eschatologie bei Paulus ausgehend von Römer 5-8 Vandenhoeck und Ruprecht, 2018, 576 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3322-3 85,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 152 Was gilt bereits gegenwärtig hinsichtlich der ‚Lehre von den letzten Dingen‘ in den Briefen des Apostels Paulus? Um diese Grundfrage der Studie zu beantworten, werden verschiedene paulinische Texte ausgehend von Römer 5 – 8 ausgelegt und mit Hilfe des Modells der modalisierten Zeit aus der Kulturphilosophie differenziert erklärt. Unbestreitbar gilt das neue Sein der Christusgläubigen bereits gegenwärtig für das Hier-und-Jetzt, ohne dass damit die vielfältigen die Zukunft betreffenden Aussagen des Apostels negiert würden. Die grundsätzlichen Voraussetzungen der Rechtfertigung werden ebenso bedacht wie ihre Konsequenzen. Das Leben mit Christus bleibt selbst im Sterben und darüber hinaus bestehen. Für die Gläubigen bedeutet ihr irdisches Dasein Gegenwart in Relation: In der Person Jesu Christi und der Beziehung der Gläubigen zu ihm besteht der wesentliche Kern der präsentischen Eschatologie des Apostels. Christus kam in ihre von Sünde und Tod geprägte Vergangenheit, um sie durch Erlösung und Rechtfertigung in seine Gegenwart zu versetzen und im Glauben eine gemeinsame Zukunft zu eröffnen und fortan zu verwirklichen. Im Glauben gilt die ‚Aufhebung der Zeit‘ in die Christuswirklichkeit. Und so entfaltet sich die präsentische Eschatologie des Paulus als die im Glauben gelebte Wirklichkeit der Beziehung des Menschen zu Gott, seinen Mitmenschen und sich selbst in Jesus Christus. Leseprobe |
 |
Thomas Naumann Ismael Israels Selbstwahrnehmung im Kreis der Völker aus der Nachkommenschaft Abrahams Neukirchener Verlag, 2017, 504 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3260-8 85,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 151 Thomas Naumann geht in seiner Analyse der Hagar-Ismael-Episoden der Genesis der Frage nach, warum Ismael so positiv in die Verheißungstheologie der Abrahamerzählung eingezeichnet wird, obwohl er weder als Ahnvater Israels noch als Israel-Erbe Abrahams figuriert, sondern als Vater arabischer Völker. Im Ergebnis reflektiert Israel an dieser Figur, dass der Segen und die bleibende Fürsorge Gottes auch den nichtisraelitischen Völkern aus der Nachkommenschaft Abrahams gelten. Ismael ist weder als Feind noch als Gegenpool zu Isaak aufzufassen, wie dies Paulus in Gal 4 betont hat, sondern als Verheißungskind und Partner im Bundesschluss, ein Vorläufer Isaaks, der die Segnungen und die Zumutungen Gottes mit seinem jüngeren Bruder teilt und diese vorwegnimmt. Die Genesis bietet eine theologisch reflektierte inklusive Sicht auf Ismael und seine Mutter Hagar. Nach Naumanns Ergebnissen kann sich die in der christlichen und jüdischen Rezeptionsgeschichte dominierende negative Sicht Ismaels, die in Exkursen jeweils in den Blick kommt, nicht auf die Genesiserzählung stützen. Naumanns Studie bietet eine fulminante theologische Rehabilitation dieser auch im Hinblick auf die islamische Rezeption interessanten biblischen Gestalt. Blick ins Buch siehe auch: 1. Mose 16, 1-16, Hagar und Ismael |
 |
Monika
Müller Und der Herr wohnt in Zion (Joel 4,21) Neukirchener Verlag, 2017, 240 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3125-0 59,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 150 Die äußerst komplexe Struktur der Joelschrift, vor allem der letzten zwei Kapitel Joel 3 und 4, lädt dazu ein, sich ihr unter verschiedenen Perspektiven zu nähern. Der markante Schlusssatz, der den Titel der Arbeit bildet, fordert geradezu heraus, danach zu fragen, wie die Schrift denn nach den Höhen und Tiefen (Verheißung, Gericht und Heil) der letzten beiden Kapitel zu der starken Aussage über die Gegenwart Gottes kommt. Das vorliegende Werk möchte sich durch verschiedenen literaturwissenschaftlichen Zugängen und theologischen Fragestellungen damit auseinanderzusetzen. Die literaturwissenschaftliche Analyse arbeitet dabei primär unter synchroner Hinsicht, die redaktionsgeschichtlichen Entwicklungen der Joelschrift und des Zwölfprophetenbuches werden auf Grund vom aktuellen wissenschaftlichen Stand vorausgesetzt und sollen mit einem literaturwissenschaftlich-theologischen Ansatz ergänzt werden. Methodische Schwerpunkte sind eine detaillierte Strukturanalyse, die Darstellung eines Raumkonzepts, eine gezielte Sprechaktanalyse und eine Auswertung der Zeitstruktur, die jeweils die intertextuell-leserorientierte Perspektive aufgreifen. Mit Amos 9, Sacharja 8 und Ezechiel 48 wird der Blick auf andere Endpunkte prophetischer Literatur gelenkt, die gleichfalls Aussagen über die Präsenz Gottes treffen, und ihre theologische Zielrichtung mit der Joelschrift verglichen. Inhaltsverzeichnis und Leseprobe |
 |
Chol-Gu
Kang Behemot und Leviathan Studien zur Komposition und Theologie von Hiob 38,1-42,6 Neukirchener Verlag, 2016, 368 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3053-6 79,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 149 Die Gottesreden (Hi 38,1 - 42,6) bilden den Höhepunkt der Hiobdichtung und werden als Schlüssel zu ihrem Gesamtverständnis angesehen. Die vorliegende Arbeit versucht, die Gottesreden durch das Welt-, Gottes- und Menschenverständnis des Hiobbuches verständlich zu machen. Als Lösung des Hiobproblems stehen die mythischen Repräsentanten Behemot und Leviathan. Die Existenz beider Tiere, hinter denen sich zoologisch Nilpferd und Krokodil verbergen und zu denen sich in den Gottesreden des Hiobbuches noch weitere 10 Tiere dazugesellen (Hi 38,39 - 39,30), stellt Hiob vor die entscheidende Frage und zwingt ihn dazu, sich und sein Leiden an Gott und Welt neu zu sehen. Es ist das Ziel der Gottesreden, Hiobs Vorstellung zu ändern und ihm eine neue Einsicht zu geben. In den Gottesreden werden die grundlegenden Koordinaten des neuen Verhältnisses zwischen der Welt, Gott und Mensch festgelegt. |
 |
Nesina
Grütter Das Buch Nahum Eine vergleichende Untersuchung des masoretischen Texts und der Septuagintaübersetzung Neukirchener Verlag, 2016, 320 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3068-0 65,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 148 Dieses Buch legt eine detaillierte und vielschichtige Untersuchung des Prophetenbuchs Nahum vor. Im Vordergrund steht der Vergleich des hebräischen Texts (des masoretischen Texts) mit der ersten griechischen Übersetzung des Nahumbuchs (der Septuaginta). Einerseits wird die Übersetzungsweise analysiert, andererseits die hebräische Vorlage, die zum Erstellen der griechischen Übersetzung benutzt wurde, rekonstruiert. Darauf erfolgen drei Detailstudien, die die drei quantitativ auffallendsten Differenzen zwischen dem masoretischen Text und der Septuaginta mittels textkritischer Methode und unter Einbezug verschiedener biblischer und nichtbiblischer (griechischer, ägyptischer und akkadischer) Quellen untersuchen. Schließlich wird herausgearbeitet, dass mit Septuaginta und masoretischem Text Zeugen zweier Textstufen/Editionen vorliegen. Der masoretische Text bietet einen Konsonantentext, der letzte redaktionelle Änderungen erfahren hat, die die hebräische Vorlage der Septuaginta noch nicht aufwies. Das Buch leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Textgeschichte des Zwölfprophetenbuchs. Zudem führt der reflektierte Bezug von Philologie und Kulturwissenschaften dazu, dass die Arbeit auch von anderen Disziplinen der Theologie und darüber hinaus mit Gewinn gelesen werden kann. |
 |
Stefanie
Schabow Gemacht zu einem Königreich und Priestern für Gott Eine Auslegung der basileia-/basileuw-Aussagen in Offb 1,6; 5,10; 20,4.6 und 22,5 Neukirchener Verlag, 2016, 272 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3060-4 65,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 147 Die Autorin untersucht die Verwendung der Begriffe basileía ("Königreich" oder "Königsherrschaft") und basileúw ("König sein" oder "herrschen") in Bezug auf die Gläubigen in Offb 1,6; 5,10; 20,4.6 und 22,5. Damit rückt eine zentrale soteriologische Aussage der Offb in den Fokus. Das Buch bietet einen bisher nicht an einem Einzelproblem der Offb erprobten hermeneutischen Ansatz: Es werden immer mehrere Auslegungsmöglichkeiten einer Stelle vorgestellt, die zum einen durchlaufend die häufig verschiedenen Lesarten der großen Codices Alexandrinus und Sinaiticus berücksichtigen, zum anderen damit rechnen, dass erstmalige Lektüre und wiederholte Relektüre der auszulegenden Stellen zu unterschiedlichen Interpretationen führen können. |
 |
Karin
Finsterbusch MT-Jeremia und LXX-Jeremia 25-52 Synoptische Übersetzung und Analyse der Kommunikationsstruktur Neukirchener Verlag, 2017, 400 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-3045-1 75,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 146 In diesem Band wird eine philologisch exakte wort- und strukturgetreue deutsche Neuübersetzung des zweiten Teils (Kapitel 25-52) des hebräischen Jeremiabuches und gleichzeitig eine Neuübersetzung des griechischen Jeremiabuches vorgelegt; beide antike Textfassungen unterscheiden sich in Bezug auf Struktur und Umfang signifikant. In der synoptischen Übersetzung sind wesentliche Unterschiede zwischen den Fassungen markiert; die einzelnen Sinnabschnitte sind durch Überschriften und ein System von Anführungszeichen strukturiert. Das Buch ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Erschließung der jeremianischen Texte in Bezug auf Textentstehung und rhetorische Strukturen. |
 |
Karin Finsterbusch MT-Jeremia und LXX-Jeremia 1-24 Synoptische Übersetzung und Analyse der Kommunikationsstruktur Vandenheock & Ruprecht, NTH, 2017, 271 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2995-0 65,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 145 In diesem Band wird eine philologisch exakte wort- und strukturgetreue deutsche Neuübersetzung des ersten Teils (Kapitel 1-24) des MT-Jer (auf der Grundlage des Codex L) unter gleichzeitiger Vorlage einer Neuübersetzung der LXX-Jer (auf der Grundlage der kritischen Göttinger Ausgabe) vorgelegt; beide antike Textfassungen unterscheiden sich in Bezug auf Struktur und Umfang signifikant. In der synoptischen Übersetzung sind die wesentlichen Unterschiede markiert (z.B. substantielle Zusätze in der einen oder anderen Fassung). Auf Gründe für die Unterschiede wird vielfach in Anmerkungen eingegangen (beispielsweise, wenn Unterschiede darauf hindeuten, dass der griechische Übersetzer[kreis] einen vom MT abweichenden hebräischen Text vorliegen hatte). Darüber hinaus werden in redaktionellen Überschriften die Kommunikationsebenen sowie die Sprecher in der jeweiligen Welt des Buches ausgewiesen; durch ein System von Anführungszeichen wird die ausgesprochen komplexe Rhetorik der Texte erschlossen. Das Buch ist ein wichtiges Hilfsinstrument für die Erschließung der jeremianischen Texte in Bezug auf Textentstehung und rhetorische Strukturen. |
 |
Meik Gerhards Homer und die Bibel Studien zur Interpretation der Ilias und ausgewählter alttestamentlicher Texte Neukirchener Verlag, 2015, 544 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2962-2 89,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 144 Homer und die Bibel gehören zu den Grundtexten der europäischen Kultur. Beide sind allerdings heute vielen Menschen fremd geworden. Die Arbeit geht davon aus, dass es dennoch, gerade in der heutigen Informationsgesellschaft, wichtig ist, die großen prägenden Texte nicht zu vergessen, die ihre Orientierungsleistung über Jahrhunderte hinweg bewährt haben. Von daher versucht sie, am Beispiel der Ilias und einiger biblischer Texte zu zeigen, was diese aktuell zu sagen haben. |
 |
Sung-Ho Park Stellvertretung Christi im Gericht Studien zum Verhältnis von Stellvertretung und Kreuzestod Jesu bei Paulus Neukirchener Verlag, 2015, 480 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2896-0 89,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 143: Wenn Christus durch seinen Tod am Kreuz Heil schafft, warum muss er im Endgericht noch für uns eintreten (Röm 8,34)? Mit dieser Frage versucht die vorliegende Studie, das Verhältnis der Fürsprache Jesu Christi im Gericht zu seinem Kreuzestod, der den Höhepunkt der biblischen Stellvertretungsvorstellung bildet, zu erhellen. Daraus ergibt sich die Tatsache, dass Kreuz und Fürsprache im Gericht als ein einziges theologisches und christologisches Ereignis zu betrachten sind, worin Gottes Heilswille in Christus der Menschheit in pointierter Form zur Sprache gebracht wird. |
 |
Christine Abart Lebensfreude und Gottesjubel Studien zu physisch erlebter Freude in den Psalmen Neukirchener Verlag, 2014, 364 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2888-5 65,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 142: Glücklich sein ist nicht dasselbe wie Glück haben, sagt die heutige Glücksforschung. Die Betenden der Psalmen haben immer wieder Glück. Sie jubeln über freudige Ereignisse wie Festzeiten, das Einsetzen des nötigen Regens oder Hilfe in persönlicher Not. Solche Gipfelerlebnisse stärken ihre freudige Grundstimmung. Wirklich glücklich sind sie jedoch aufgrund ihrer Gottesbeziehung. Die vorliegenden Interpretationen von 23 Psalmen verbinden die ganzheitlich erlebte Freude der Betenden mit den Ergebnissen heutiger Glücksforschung. Sie sind Hilfe auf der Suche nach dem eigenen Glück. Ps 4 / Ps 13 / Ps 16 / Ps 19 / Ps 28 / Ps 33 / Ps 35 / Ps 42 / Ps 47 / Ps 51 / Ps 63 / Ps 71 / Ps 84 / Ps 86 / Ps 94 / Ps 97 / Ps 104 / Ps 105 / Ps 118 / Ps 119 / Ps 126 / Jes 48,20 |
 |
Oliver
Cremer Das sagt der Sohn Gottes Die Christologie der Sendschreiben der Johannesoffenbarung Neukirchener Verlag, 2014, 336 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2860-1 55,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 141: Die vorliegende Arbeit verfolgt jede der Selbstvorstellungen Jesu zu Beginn der Sendschreiben (Offb 2-3) in ihrem unmittelbaren Kontext, ihrer Sprachgestalt, ihren Schriftbezügen und ihrem sachlichen Zusammenhang. Ein Schwerpunkt der Bezüge erschließt die Christologie vom Verständnis Gottes her, ein anderer gibt dem Christusbild herrscherliche Züge. Beide Aspekte wendet die Johannesoffenbarung auf die angeschriebenen Gemeinden an. So entsteht eine intensive gemeindebezogene Christologie. |
 |
Bärbel
Bosenius Der literarische Raum des Markusevangeliums Neukirchener Verlag, 2014, 560 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2856-4 100,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 140: Die Autorin verbindet in ihrer Untersuchung des Markusevangeliums unterschiedliche methodische Herangehensweisen der Evangelienauslegung miteinander. Aus den räumlichen Angaben dieses frühchristlichen Erzähltextes konstruiert sie im Rahmen eines erzähltheoretischen Zugangs einen literarischen Raum, den sie in Beziehung zur außertextuellen Wirklichkeit setzt, indem sie nach historischen, geografischen und materialen Bezugnahmen der erzählten Welt auf die reale Welt fragt. |
 |
Michael
Lichtenstein Von der Mitte der Gottesstadt bis ans Ende der Welt Psalm 46 und die Kosmologie der Zionstradition Neukirchener Verlag, 2014, 544 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2799-4 89,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 139: Ziel der vorliegenden Studie ist die Rekonstruktion der Kosmologie der Zionstradition, ausgehend von einer motivgeschichtlichen Untersuchung von Psalm 46 als Einzeltext im Kontext seiner alttestamentlichen und altorientalischen Sachparallelen. Methodisch verwendet diese Arbeit für die Beschreibung dieses Sachverhalts den Begriff des kulturellen Symbolsystems, um die Wechselwirkung von geglaubter Kosmologie und gelebten Ethos zu plausibilisieren. Einen Schwerpunkt der Arbeit bildet dabei das Motiv der Gottesstadt. |
 |
Uta
Schmidt Zukunftsvorstellungen in Jesaja 49-55 Eine textpragmatische Untersuchung von Kommunikation und Bildwelt Neukirchener Verlag, 2013, 356 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2717-8 79,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 138: "Was wird kommen, und wie wäre es, wenn es gut wäre?" Diese Frage könnte als Überschrift für Jesaja 49-55 dienen. Die Analyse der Kommunikationsstruktur der Texte im Rahmen einer pragmatischen Texttheorie erschließt, wie Zukunftsvorstellungen in den Jesajatexten vermittelt und in der Kommunikation entfaltet und entwickelt werden. Die Studie zeigt, dass mit "Zion" und dem "sogenannten Gottesknecht" zwei Figuren im Zentrum der Texte stehen, mit denen verschiedene Zukunftsmodelle und unterschiedliche Formen der Beziehung zu JHWH nebeneinandergestellt werden. |
 |
Meike
Gerhards Conditio humana Studien zum Gilgameschepos und zu Texten der biblischen Urgeschichte am Beispiel von Gen 2-3 und 11,1-9 Neukirchener Verlag, 2013, 356 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2707-9 79,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 137: Diese Studie, ein wissenschaftliches Fachbuch im Grenzgebiet von alttestamentlicher Exegese und Altorientalistik, enthält Auslegungen zum Gilgameschepos sowie zu Gen 2-3 und 11,1-9. Dabei ist ein historisch-kritischer und religionsgeschichtlicher Zugang gewählt, der allerdings nicht als Selbstzweck betrieben wird. Ziel der Arbeit ist es, an den Texten grundlegende anthropologische Einsichten zu gewinnen und in den Gesprächshorizont der Gegenwart einzubringen. Der Zugang zu gegenwärtigen Diskursen wird über ein an der Philosophischen Anthropologie orientiertes heuristisches Konzept gesucht, das in Teil A der Arbeit vorgestellt wird. |
 |
Johannes
Schnocks Das Alte Testament und die Gewalt Studien zu göttlicher und menschlicher Gewalt in alttestamentlichen Texten und ihren Rezeptionen Neukirchener Verlag, 2014, 224 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2675-1 35,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 136 Im Alten Testament gibt es immer wieder Texte, die mit Gewalt zu tun haben. Ja, Gott selbst ist Urheber von Gewalt und fordert zugleich Menschen zu gewalttätigem Handeln auf. Wie lässt sich diese Tatsache damit vereinbaren, dass Gott ein Gott der Liebe ist? Zugleich stellt sich die Frage, wie wir heute mit solchen Bibeltexten umgehen. Es ist unbestritten, dass es im Alten Testament immer wieder Texte gibt, in denen von Gewalt die Rede ist, ja in denen Gott selbst als Urheber mit Gewaltakten in Verbindung gebracht wird oder Menschen zu gewalttätigem Handeln auffordert. Auch wenn die historisch-kritische Exegese in vielen Fällen die historischen Hintergründe beleuchten und so einen Großteil des Gewaltpotentials der Texte besser verstehbar machen kann, bleiben solche Texte doch anstößig, wenn man auf ihre Rezeptionsgeschichte schaut. Hier stellt sich die beklemmende Frage, ob die literarische Gewalt der Texte im Lauf der Geschichte zur Legitimierung zwischenmenschlicher Gewalt geführt hat und nach manchen Vertretern der aktuellen Diskussion um Religion und Gewalt sogar führen musste. Die vorliegende Studie setzt daher ein mit einer Standortbestimmung in der Diskussion, die besonders von den Beiträgen des Ägyptologen Jan Assmann mit dem Stichwort der »Mosaischen Unterscheidung« angestoßen wurde. Ein zweiter Teil wendet sich mit Einzeluntersuchungen einigen »Gewalttexten« der Hebräischen Bibel zu. Ein dritter Teil ist der Rezeption solcher Texte in den Makkabäerbüchern gewidmet und fragt, wie in dieser späten biblischen Literatur bereits auf die Hebräische Bibel zurückgegriffen wird, um gewalttätiges Handeln oder Herrschaft zu legitimieren. Der Ausblick am Ende des Buches behandelt punktuell die mittelalterliche Makkabäerrezeption und zeichnet nach, wie solche Legitimationsmuster etwa in der Kreuzzugspropaganda, aber auch darüber hinaus, genutzt werden konnten |
 |
Christiane
Zimmermann Gott und seine Söhne Das Gottesbild des Galaterbriefes Neukirchener Verlag, 2013, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2687-4 49,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 135 In Untersuchungen der Texte des Neuen Testaments stand in Fachkreisen über viele Jahrzehnte die Betrachtung Christi im Mittelpunkt. Erst in den letzten Jahren wendet man sich stärker der Frage zu, welche Rolle Gott in diesen Texten spielt. In "Gott und seine Söhne" wendet sich die Verfasserin der Funktion Gottes in einem der wichtigsten Briefe des Apostels Paulus zu und arbeitet heraus, dass Gott vor allem als gnädiger Vater erscheint, der die Glaubenden an Sohnes statt annimmt und sie somit auf eine Christus vergleichbare Stufe stellt. Zudem wird Gott besonders als ein mit den Menschen durch Verheißungen und durch das Evangelium kommunizierender beschrieben. Inhaltsverzeichnis Christiane Zimmermann, Dr. phil. (1991) studied Greek, Theology and Classical Archaeology in Munich ( Der Antigone-Mythos in der antiken Literatur und Kunst, 1993). She is member of the Institut für Christentum und Antike at the Humboldt-University Berlin. At the Faculty of Theology in Berlin (HU) she obtained her Habilitation in New Testament in 2006. Currently she is lecturing New Testament and Greek language at the Humboldt-University Berlin. |
 |
Tomohisa Yamayoshi Von der Auslösung zur Erlösung Studien zur Wurzel PDH im Alten Orient und im Alten Testament Neukirchener Verlag, 2012, 400 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2581-5 85,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament,
WMAN Band 134 Der Begriff "Erlösung" gehört zu den zentralen Glaubensaussagen der christlichen Tradition, wobei die hebräische Wurzel hdp im Alten Testament als ein wichtiger Baustein dient. Die vorliegende Arbeit versucht, unterb Berücksichtigung der außerbiblischen Belege die etymologische Grundbedeutung sowie die religions- und theologiegeschichtliche Entwicklung der Wurzel hdp im Alten Testament zu erklären. Als Hauptergebnis ergibt sich die These, dass es bei dem Gebrauch der semitischen Wurzel hdp um eine Handlung geht, die darauf zielt, durch Erbringung eines Gegenwertes das Leben aus dem Tod auszulösen. Darüber hinaus wird gezeigt, dass die Wurzel hdp im theologischen Sprachgebrauch des Alten Testaments eine einzigartige Bedeutungsentwicklung erfahren hat, die im Titel der Arbeit bündig zum Ausdruck kommt. Tomohisa Yamayoshi, geb. 1978 in Shizuoka (japan), studierte Evangelische Theologie, Assyriologie und Semitistik in Tokyo (Rikkyo Universität) und Tübingen. Promotion zum Dr. theol. mit der vorliegenden Untersuchung. |
 |
Daniel Opel Hiobs Anspruch und Widerspruch Die Herausforderungsreden Hiobs (Hiob 29-31) im Kontext frühjüdischer Ethik Neukirchener Verlag, 2010, 400 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2432-0 79,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament Band 127 Mit den Herausforderungsreden Hiobs (Hi 29–31) wird innerhalb des Hiobbuches die Frage nach Gottes Gerechtigkeit im Hinblick auf das Leid des frommen und rechtschaffenen Hiobs auf den Höhepunkt geführt. Im Fokus der Studie stehen die Ausgestaltung und Begründung von Hiobs Ethos sowie dessen literar- und zeitgeschichtliche Verortung und Funktion für die Theologie des Hiobbuches. Des Weiteren werden anhand der griechischen und syrischen Übersetzung von Hi 29–31 Veränderungen in Hiobs Ethos angesichts sich wandelnder historischer Gegebenheiten dargestellt und schließlich ein Vergleich mit den Ethos-Konzeptionen von Ben Sira und 1Q/4Q Instruction als Beispiele frühjüdischer Weisheit vorgestellt. |
 |
Andreas
Reinert Die Salomofiktion Neukirchener Verlag, 2010, 256 Seiten, Gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2380-4 55,00 EUR |
Wissenschaftliche
Monographien zum Alten und Neuen Testament Band 126 Studien zur Struktur und Komposition des Koheletbuches Seit langem suchen Forscherinnen und Forscher nach einer nachvollziehbaren Struktur im Buch Kohelet. Lange Zeit wurden ein sinnvoller Aufbau und eine organische Gliederung des Buches ganz bestritten. Nachdem in den letzten Jahrzehnten einige thematisch oder an der antiken Rhetorik orientierte Versuche vorgelegt worden sind, macht es sich dieses Buch zur Aufgabe, mit Hilfe einer Analyse von Leitworten im Koheletbuch eine an der hebräischen Sprache ausgerichtete Struktur zu erarbeiten. Exemplarisch wird dies an der sogenannten Salomofiktion (Koh 1,1 – 4,16) gezeigt. |
 |
Günther
Bornkamm Studien zum Matthäus-Evangelium Neukirchener Verlag, 2009, 440 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2365-1 85,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament Band 125 Günther Bornkamm gilt innerhalb der neutestamentlichen Wissenschaft als Begründer der redaktionsgeschichtlichen Methode, die er speziell auf das Matthäus-Evangelium angewandt hat. Der vorliegende Band enthält im ersten Teil sämtliche Aufsätze Bornkamms zum Matthäus-Evangelium sowie im zweiten Teil insgesamt acht Studien, die dem unvollendet gebliebenen Matthäus-Kommentar des Heidelberger Neutestamentlers entnommen sind. Eingeleitet wird der Sammelband durch eine Einführung von Werner Zager. |
 |
Annette Krüger Das Lob des Schöpfers Studien zur Sprache, Motivik und Theologie von Psalm 104 Neukirchener Verlag, 2009, 440 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2379-8 89,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testamant
Band 124 Psalm 104 wird bis heute mit dem bekannten Großen Amama-Hymnus Amenophis' IV. / Echnaton verglichen, teilweise sogar von ihm hergeleitet. Die vorliegende Studie untersucht Psalm 104 daraufhin, ob und in welcher Form literarische Motive aus den Nachbarkulturen Ägypten, Mesopotamien und Syrien/Ugarit aufgenommen und verarbeitet wurden. Darüber hinaus bietet die Arbeit ausführliche Untersuchungen zur Textstruktur und Sprache von Psalm 104 sowie zu Fragen der Theologie, der Gattung und der Wirkungsgeschichte. Ein eigener Teil ist dem direkten Vergleich des Psalms mit dem ägyptischen Hymnus gewidmet. Inhaltsverzeichnis Annette Krüger , geb. 1965, Dr. theol., Studium der Evangelischen Theologie und Philosophie in Mainz, Marburg, Hamburg und Heidelberg, 1993-2001 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin an den Universitäten Hamburg und Tübingen, 2002-2007 Elternzeit, 2008 Promotion an der Eberhard-Karls Universität Tübingen mit vorliegender Studie, seit 2007 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Tübingen. |
 |
Sophie Rantzow Christus Victor temporis Neukirchener Verlag, 2008, 302 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2332-3 75,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testamant
Band 123 Zeitkonzeptionen im Epheserbrief Das umstrittene Zeitverständnis des Epheserbriefes ist deshalb von besonderem Interesse, weil es am Ende des 1. Jahrhunderts neue Wege betritt. Das vorliegende Buch zeigt, wie der Epheserbrief an den Apostel Paulus anknüpfend dessen Theologie konsequent weiterentwickelt, aber zugleich weit über ihn hinausgeht. Innerhalb einer metaphorischen Raumstruktur konzeptionalisiert der Verfasser sein ganz eigenes eschatologisches Modell, dessen Angelpunkt Christus als victor temporis ist. Der Epheserbrief erweist sich dadurch entgegen der Mehrheit der Forschungsstimmen als ein durch und durch eschatologisch geprägtes Schreiben. |
 |
Christina Eschner Gestorben und hingegeben für die Sünder Neukirchener Verlag, 2008, 981 Seiten, 2 Bände (WMANT 122/1-2), gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2324-8 225,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testamant
Band 122 1 + 2 Die griechische Konzeption des Unheil abwendenden Sterbens und deren paulinische Aufnahme für die Deutung des Todes Jesu Christi Gegenstand der Arbeit sind die sogenannten paulinischen Sterben-"für" - und Hingabe-"für"-Formulierungen. Mit ihnen deutet Paulus den zum Kernbestand des christlichen Glaubens gehörenden Tod Jesu in seinen Briefen mehrfach in positiver Weise. Durch eine systematische Analyse der in der griechischen Literatur belegten Sterbe- und Hingabeformulierungen wird der Hintergrund skizziert, vor dem die Adressaten der paulinischen Briefe diese beiden Wendungen vermutlich verstanden haben. Dabei zeigt sich, dass die paulinischen Sterbe- und Hingabe formulierungen - entgegen gängigem Forschungskonsens - beide der griechischen Konzeption vom Unheil abwendenden Sterben entstammen. Zielgruppe: Alle, die sich für die Bedeutung des Todes Jesu interessieren; Studierende und Lehrende der Theologie. Inhaltsverzeichnis |
 |
Dorothea Erbele-Küster Körper und Geschlecht Neukirchener Verlag, 2008, 260 Seiten, gebunden, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2319-4 49,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testamant
Band 121 Studien zu Leviticus 12 und 15 Die uns fremde Körper-Sprache der Reinheitsbestimmungen in Lev 12 und 15 eröffnet in der Spätmoderne einen Blick auf den menschlichen Körper jenseits allen Körperkults. Zwei widerstreitende Phänomene fallen in den genannten Kapiteln ins Auge: zum einen die Geschlechterdualität und zum anderen die geschlechterneutralen Formulierungen für den geschlechtlichen Körper. Die Körper-Sprache der Texte wird anhand einzelner Begriffe und Themen wie Menstruation und Beschneidung entfaltet. Insgesamt wird die Bedeutung der Reinheitsbestimmungen des Alten Testaments herausgearbeitet. Zielgruppe: Lehrende und Studierende der Theologie sowie der Kulturwissenschaften, Interessierte in Genderfragen. |
 |
Peter Riede Vom Erbarmen zum Gericht Die Visionen des Amosbuches (Amos 7-9) und ihr literatur- und traditionsgeschichtlicher Zusammenhang Neukirchnener Verlag, 2008, 400 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2245-6 65,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testamant
Band 120 Die Visionen des Amosbuches entfalten in fünf Bildern des Unheils eine stetig wachsende Bedrohung. Gleichzeitig führen sie verschiedene Stadien der Begegnung zwischen Gott und Prophet vor Augen. Erreicht der Prophet in den ersten beiden Visionen durch sein Einschreiten eine Zurücknahme des Unheils, so enden die dritte und die vierte mit einem Gerichtswort. Die fünfte Vision schließlich zeigt, wie das Gericht eintritt. Ziel der Studie ist es, die kompositionellen, motiv- und traditionsgeschichtlichen Zusammenhänge des Visionszyklus herauszuarbeiten. Peter Riede geb. 1960, Dr. theol., Studium der Evangelischen Theologie in Tübingen, Bern und Heidelberg, 1998 Promotion, 2005 Habilitation, ist Privatdozent an der Evangelisch- Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. |
 |
Anna Karena
Müller Gottes Zukunft Die Möglichkeit der Rettung am Tag Jhwhs nach dem Joelbuch Neukirchener Verlag, 2008, 240 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2277-7 49,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament Band 119 Unter dem Thema des Tages Jhwhs vereint das Joelbuch vielfältige Stimmen der Tradition, es ist als Schriftprophetie im Vollsinne des Wortes zu verstehen. Insbesondere die Kapitel 1-2 weisen aber nicht einfach Anspielungen auf, sondern legen auf spezifische Weise Texte sowohl früherer Prophetie (exemplarisch Jes 13, Jer 4-6) als auch des Pentateuch (Ex 10, Ex 32-34) als Bezugstexte konzeptionell zugrunde: Sie sind auf zwei Ebenen zu lesen. Mit seiner Interpretation des Tages Jhwhs formuliert Joel eine TheoIogie, die Heil und Unheil allein von Gott erwartet. Zugleich beschreibt er das ,Wesen' Gottes durch die Aufnahme des Theologumenons von der ,Reue' Gottes. Sie wird zur zentralen Gottesaussage, von einer Hoffnung zum Bekenntnis Israels. Anna Karena Müller geb. 1967, Dr. theol., ist Pfarrerin der Evangelischen Kirche von Kurhessen- Waldeck. |
 |
Robert Vorholt Der Dienst der Versöhnung Studien zur Apostolatstheologie bei Paulus Neukirchener Verlag, 2008, 480 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2281-4 79,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament Band 118 Die vorliegende Studie widmet sich der paulinischen Apostolatstheologie. Sie ist von ökumenischer Bedeutung, weil sie nicht nur die Frage nach der Einmaligkeit, sondern auch der Erstmaligkeit des apostolischen Dienstes stellt und darüber hinaus einen Beitrag zur Beantwortung beider Fragen leisten möchte. Die Befassung mit der Apostolatstheologie des Paulus führt auch auf innerexegetische Forschungsfelder: etwa die Beschreibung ihres Stellenwertes im Themenkreis der Paulusbriefe, die Beziehung des Apostels zu Christus oder das besondere Verhältnis der jungen Kirche zum Judentum. Robert Vorhalt, geb. 1970 in Münster/Westfalen, Studium der katholischen Theologie in Münster und Paris (1996 Dipl. Theol.), 1999 Priesterweihe in Münster, 2002 Beauftragung zum Promotionsstudium an der Ruhruniversität Bochum, Promotion am 13.6.2007. |
 |
Miriam von Nordheim Geboren von der Morgenröte Neukirchener Verlag, 2008, 350 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2276-0 75,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testamant
Band 117 Psalm 110 in Tradition, Redaktion und Rezeption Ps 110 - ein sog. Königspsalm - erfuhr in seiner Auslegung Sinnverschiebungen. Dies wird vor allem an V. 3 deutlich, der im uns vorliegenden hebräischen Text vom "Tau deiner Jugend" redet, die Septuaginta hingegen von der Geburt eines Königs "aus dem Mutterleib vor dem Morgenstern". Die Dissertation versucht, sowohl den vorliegenden hebräischen Text nach seinen theologischen Intentionen zu befragen als auch seine Rezeptions- und Auslegungsgeschichte zu verfolgen. Ziel ist es, Entwicklungslinien aufzeigen, wann der Psalm welche Aussage bekam. Gerade die Wirkungsgeschichte soll nicht vernachlässigt werden, denn sie bietet ein facettenreiches Nebeneinander verschiedener Deutungen. Miriam von Nordheim geb. 1975, Dr. theol., Studium von Latein und Geschichte in Würzburg, der Evangelischen Theologie in Heidelberg und Marburg sowie der Judaistik an der Hebräischen Universität in Jerusalem, ist seit 2006 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Evangelische Theologie am dortigen Lehrstuhl für Altes Testament. |
 |
Christina Ehring Die Rückkehr JHWHs Traditions- und religionsgeschichtliche Untersuchungen zu Jesaja 40,1-11, Jesaja 52, 7-10 und verwandten Texten Neukirchener Verlag, 2007, 270 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2258-6 59,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament Band 116 Ausgangspunkt der Untersuchungen ist die Beobachtung, dass Jesaja 40,1-11 und Jesaja 52,7-10 nicht, wie häufig angenommen, die Heimkehr der Exilierten aus Babylon, sondern JHWHs Rückkehr zum Zion beschreiben. Diese Auffassung wird im ersten Teil der Arbeit in einer Exegese der beiden Texte entfaltet. Ein zweiter Teil rekonstruiert den Vorstellungszusammenhang, innerhalb dessen das Motiv der Rückkehr JHWHs zum Zion zu verstehen ist, vor einem doppelten Hintergrund: Zum einen zeigt ein Vergleich mit mesopotamischen Inschriften (aus der Zeit Nebukadnezars I., Asarhaddons und Nabonids) Parallelen im Blick auf die Deutung geschichtlicher Ereignisse auf. Sie legen es nahe, dass die deuterojesajanischen Texte mit Kenntnis und unter modifizierender Aufnahme des mesopotamischen Vorstellungszusammenhangs entstanden sind. Zum anderen macht ein Blick auf die vorexilischen Vorstellungen von JHWHs Präsenz in Zion/Jerusalem die traditionsgeschichtlichen Voraussetzungen des Motivs der Abwesenheit und Rückkehr JHWHs zum Zion deutlich. Ein Vergleich mit der in vielem parallelen Vorstellung der aus dem Jerusalemer Tempel aus- und wieder in ihn einziehenden »Herrlichkeit JHWHs« in Ezechiel 8-11 und 43 unterstützt die Überlegungen. Der dritte Teil der Arbeit stellt die Frage nach Verbindungslinien, die sich vor dem Hintergrund des rekonstruierten Vorstellungszusammenhangs zwischen Jesaja 40,1-11 und Jesaja 52,7-10 und anderen Texten des Deuterojesajabuches ziehen lassen. Betrachtet werden hier vor allem die Kyros-Weissagungen und Jesaja 46,1-4. Dabei wird deutlich, dass das Motiv der Rückkehr JHWHs nach Zion/Jerusalem im Deuterojesajabuch kein isoliertes Motiv darstellt, sondern vielmehr die sachliche Voraussetzung und Grundlage zentraler Teile der deutrojesajanischen Grundschicht bildet. |
 |
Sung Bok Choi Geist und christliche Existenz Neukirchener Verlag, 2007, 250 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2207-4 55,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament Band 115 Das Glossolalieverständnis des Paulus im Ersten Korintherbrief (1. Kor. 14) Die Frage, welches Phänomen in Korinth sich hinter der sog. Zungenrede verbirgt, ist weitgehend ungeklärt. Viele Arbeiten zum Thema zielen häufig darauf, eine im Grunde durchaus positive Einstellung des Paulus zur Glossolalie aufzuzeigen. Demgegenüber geht die vorliegende Studie von der Frage aus, ob für Paulus und die Korinther dasselbe Glossolalieverständnis vorauszusetzen ist und zeigt plausibel, dass Paulus mit seinen Aussagen zu diesem spezifisch korinthischen Phänomen eine grundsätzliche Zurückweisung ansteuert, und zwar vor allem um seines Kirchenverständnisses und seiner Pneumatologie willen. |
 |
Judith Gärtner Jesaja 66 und Sacharja 14 als Summe der Prophetie Neukirchener Verlag, 2006, 360 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2191-6 79,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament Band 114 Eine traditions- und redaktionsgeschichtliche Untersuchung zum Abschluss des Jesaja- und des Zwölfprophetenbuches Wie ist der Abschluss des Jesaja- und des Zwölfprophetenbuches gestaltet worden? Antworten auf diese auch kanontheologisch wichtige Fragestellung geben Jesaja 66 und Sacharja 14. Beide Texte erweisen sich als schriftprophetisch konzipierte Summe und spiegeln den über Jahrhunderte gewachsenen und facettenreichen Entstehungsprozess der beiden großen prophetischen Korpora in traditionsgeschichtlicher Gemeinsamkeit (Zions- und Völkerthematik) und buchspezifischer Differenz wider. Aus der Perspektive dieser beiden Buchabschlüsse wird neu nach den Konsequenzen für die Entstehung des Jesaja- und des Zwölfprophetenbuches gefragt. |
 |
Sebastian Fuhrmann Vergeben und Vergessen Christologie und Neuer Bund im Hebräerbrief Neukirchener Verlag, 2006, 288 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2190-9 55,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament Band 113 Die Studie verhandelt die Deutung des Leidens und des Todes Jesu im Hebräerbrief. Hierbei zeigt sich, dass nicht der alttestamentliche Sühnegedanke und die Schilderung des Ritus am Versöhnungstag (besonders Leviticus 16), sondern die Verheißung des Neuen Bundes (Jeremia 31) als der entscheidende Bezugspunkt der gesamten Darlegung und somit der Christologie und der Soteriologie des Hebräerbriefes zu werten ist. Die Arbeit bietet eine Lesart für die Interpretation des Hebräerbriefes, von der her sich die Reden vom Hohenpriestertum Christi und von der Unmöglichkeit der zweiten Buße neu erschließen. |
 |
Sigurd Kaiser Krankenheilung Neukirchener Verlag, 2006, 288 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2142-8 59,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament Band 112 Untersuchungen zu Form, Sprache, traditionsgeschichtlichem Hintergrund und Aussage von Jak 5, 13-18. Die Studie untersucht die zentrale neutestamentliche Anweisung zum Gebet für die Kranken, Jak 5, 13-18, auf die sich z.B. das Sakrament der letzten Ölung bzw. heute der Krankenheilung bezieht. Anhand von sprachlichen und inhaltlichen Vergleichen mit anderen biblischen und außerbiblischen Heilungstexten rekonstruiert die Arbeit die urchristliche Praxis der Krankenheilung durch Gebet. zur Seite Krankensalbung |
 |
David du Toit Der abwesende Herr Neukirchener Verlag, 2006, 488 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2141-1 100,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament Band 111 Strategien im Markusevangelium zur Bewältigung der Abwesenheit des Auferstandenen Im Markusevangelium nimmt die Vorstellung von der Heilsgegenwart des irdischen Jesus eine Schlüsselstellung ein. Da der Evangelist nicht wie im frühen Christentum üblich mit der Gegenwart des Erhöhten, sondern mit dessen Abwesenheit rechnet, wird im Evangelium die nachösterliche Zeit als Zeit der Abwesenheit Jesu und somit als Unheilszeit begriffen. Der Autor untersucht, welche Strategien der Evangelist entwickelt, um dieses Problem zu bewältigen. |
 |
Anja Angela Diesel Ich bin Jahwe Neukirchener Verlag, 2006, 350 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2138-1 85,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament Band 110 Der Aufstieg der Ich-bin-Jahwe-Aussage zum Schlüsselwort des alttestamentlichen Monotheismus Neue Ideen, neue Gedanken brauchen sprachlichen Ausdruck,um sich mitteilen zu können. Das Israel der exilischen und nachexilischen Zeit bringt in die Weltgeschichte solch einen neuen Gedanken ein, den des einzigen Gottes. Unter den sprachlichen Strategien, dieses unerhört Neue zu sagen, nimmt die Formel »Ich bin Jahwe« einen prominenten Rang ein. |
 |
Meik Gerhards Die Aussetzungsgeschichte des Mose Neukirchener Verlag, 2006, 288 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2137-4 59,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament Band 109 Literatur- und traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu einem Schlüsseltext des nichtpriesterichen Tetrateuch Es handelt sich um einen Beitrag zu dem gegenwärtig stark diskutierten Problem der Entstehung des Pentateuch. Die ausführliche Untersuchung der Aussetzungsgeschichte des Mose soll eine Basis für weitere Forschungen auf diesem Gebiet schaffen. Dabei wird stärker als in anderen Arbeiten das Verhältnis des biblischen Textes zur akkadischen Sargonlegende besprochen, was wiederum interessante Folgen für das theologische Verständnis mit sich bringt. |
 |
Gerlinde
Baumann Gottes Gewalt im Wandel Traditionsgeschichtliche und intertextuelle Studien zu Nahum 1, 2-8 Neukirchener Verlag, 2005, 288 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2107-7 55,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament Band 108 In christlicher Theologie werden alttestamentliche Gottesbilder häufig als sehrgewalttätig empfunden. Wenig Aufmerksamkeit fällt dabei auf Stimmen innerhalb des Alten Testaments, die sich mit der Gewalttätigkeit Gottes reflektierend und kritisch auseinandersetzen. Dies versucht die vorliegende Studie zu tun. Sie untersucht, in welcher Weise dem Corpus der vorexilischen prophetischen Schrift Nahum in nachexilischer Zeit durch Voranstellung einese inleitenden Psalms (Nah 1,2-8) eine neue Deutung verliehen wurde. Im Mittelpunkt steht dabei die traditionsgeschichtliche Untersuchung von Nah 1,2-8. Der Nahum-Psalm erscheint als enorm anspielungsreicher Text, der viele ältere Traditionen verarbeitet. Der entfesselten Gewalttätigkeit Gottes gegen Assur bzw. Ninive im Nahum-Corpus (Nah 1,9ff) wird auf diese Weise ein Bild Gottes vorangestellt, das sich stärker an rechtlichen Vorstellungen orientiert. Gott übt Vergeltung und ist gerechterweise zornig, wenn er gegen seine Feinde angeht. Mit Hilfe der literaturwissenschaftlichen Methodik der Intertextualität werden die Ergebnisse der Exegese noch einmal vertieft. Hier wird besonders nach der Verarbeitung älterer, geprägter Wendungen im Nahum-Psalm gefragt. Sowohl der Beginn des Nahum-Psalms (Nah 1,2f)als auch der Schluss der prophetischen Schrift Micha (Mi 7,18-20) nehmen in Zitat und Anspielung auf die sog. "Gnadenformel" (Ex 34,6f) Bezug. Hierdurch wird die zornige Seite Gottes eng mit dem gnädigen und vergebenden Gott verknüpft. Derg öttlichen Gewalttätigkeit, die bei Nahum als notwendig und gerechtfertigt erscheint, wird durch die Positionierung in einem größeren Deutungshorizont des Zwölfprophetenbuchs das "letzte Wort" verweigert. |
 |
Christine
Schlund Kein Knochen soll gebrochen werden Studien zur Bedeutung und Funktion des Pesachfests in Texten des frühen Judentums und im Johannesevangelium Neukirchener Verlag, 2005, 270 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2087-2 55,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament,
WMANT, Neukirchener Verlag Band 107 In allen vier Evangelien spielt das Pesachfest eine prominente Rolle. Während bei den Synoptikern Jesu letztes Mahl als ein Pesachmahl dargestellt wird, stirbt Jesus im Johannesevangelium bereits am "Rüsttag" des Pesach. Anders als die synoptischen Evangelien aber, die dem Fest außerhalb des unmittelbaren Mahl-Kontexts keinerlei Aufmerksamkeit schenken, erwähnt das Johannesevangelium mehrere Pesachfeste im Zusammenhang des Wirkens Jesu. Die Kapitel 12-19 sind dann ganz auf dem Hintergrund der anbrechenden Pesachzeit gestaltet. Ob es aber tatsächlich so etwas wie ein "Pesach-Thema" im Johannesevangelium gibt und ob Jesus für den Autor des Evangeliums an Stelle eines zu schlachtenden Pesachtieres am Kreuz stirbt, ist in der neutestamentlichen Forschung keinesfalls unumstritten. Auch dort, wo eine solche Beziehung angenommen wird, kann deren Funktion im Gesamtduktus des Evangeliums oft nur unzureichend bestimmt werden. Und schließlich: Wie ist der Zusammenhang zwischen der auf dem Pesach-Hintergrund gestalteten Kreuzigung und dem Sünden tragenden Lamm Gottes aus Joh 1,29 zu denken? Diesem Fragenkomplex widmet sich die vorliegende Studie, in dem sie zunächst die traditionsgeschichtlichen Voraussetzungen umfassend zu klären versucht. Das Interpretationspotential von Pesach wird anhand einer gründlichen Analyse der zur Verfügung stehenden frühjüdischen Texte (Septuaginta, Philo von Alexandrien, Josephus, Jubiläenbuch u.a.) untersucht. In einem zweiten Teil wird die Realisierung dieses Potentials in den neutestamentlichen Texten beschrieben, schwerpunktmäßig im Johannesevangelium, aber auch im 1. Korintherbrief. Ein wichtiges Ergebnis der Untersuchungen ist dabei, dass das "apotropäische" (Unheil abwendende) Verständnis des ursprünglichen ägyptischen Pesach für die Autoren der besprochenen Texte noch wesentlich präsen- ter ist, als dies bislang angenommen wurde. Ein abschließender Ausblick auf die Rezeption des Pesach in der christlichen Literatur des 2. Jahrhunderts (Melito von Sardis) und die Weiterentwicklung auf jüdischer Seite in den Targumen kann die gewonnenen Ergebnisse bestätigen und rundet die Studie ab. |
 |
Gernot Garbe Der Hirte Israels Eine Untersuchung zur Israeltheologie des Matthäusevangeliums Neukirchener Verlag, 2005, 270 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2086-5 55,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament,
WMANT Band 106 In der Diskussion um den sog. Antijudaismus des Neuen Testamentes kommt dem Matthäusevangelium eine besondere Bedeutungzu: Neben deutlichen Aussagen über die Herkunft Jesu aus Israel und seine ausschließliche Sendung zu Israel stehen Aussagen,die als Indizien dafür gewertet werden können, dass aus des Sicht des Verfassers das Volk Israel verworfen ist. Es ist in der Matthäusforschung umstritten, ob und in welcher Weise es dieser vermeintlich widersprüchliche Tatbestand erlaubt, eineeinheitlichen Sicht, d.h. eine matthäische Israeltheologie zu formulieren. Die Arbeit "Der Hirte Israels" versucht in einer Gesamtsicht auf das Matthäusevangelium zu zeigen, dass Israel in jeder der drei Phasen der matthäischen Heilsgeschichte (Wirken des irdischen Jesus -Gegenwart als Reich desMenschensohnes - eschatologisches Heil nach dem Gericht über alle Menschen) einen eigenen, nicht nur negativen Ort hat.Besondere Schwerpunkte bilden bei der Auslegung die Frage nach dem matthäischen Missionskonzept (Mt 10) und die Frage nachdem matthäischen Gerichtsverständnis im Blick auf das Volk Israel (Mt 24-25). Die schroff antijüdischen Aussagen des Matthäus-evangeliums haben ihre Funktion in der Auseinandersetzung des Mt mit seinenjüdischen Zeitgenossen und in der Deutung der Zerstörung Jerusalems als innergeschichtliches Gericht über Israel. Zugleich fordert Mt seine Gemeinde zur fortgesetzten Mission auch innerhalb Israels auf. Jesus ist und bleibt der vom Prophetenverheißene "Hirte Israels". Vor dem Hintergrund heutiger Fragestellungen wird dieser Befund kritisch gewürdigt. |
 |
Andreas Scherer Überlieferungen von Religion und Krieg Neukirchener Verlag, 2004, 495 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2067-4 95,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien Band 105 Exegetische und religionsgeschichtliche Untersuchungen zu Richter 3-8 und verwandten Texten Wie sind die Texte aus Richter 3,7 - 8,35 entstanden, welche religionsgeschichtliche Wirklichkeit spiegeln sie wider, und welche theologischen Intentionen sind in ihnen lebendig? Die vorliegende Studie bemüht sich auf der Grundlage einer eingehenden exegetischen Untersuchung um die Beantwortung dieser drei für das Verständnis und die Deutung zentraler Partien des Richterbuches entscheidenden Fragen. |
 |
Christian Münch Die Gleichnisse Jesu im Matthäusevangelium Eine Studie zu ihrer Form und Funktion Neukirchener Verlag, 2004, 380 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2035-3 75,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament,
WMANT, Neukirchener Verlag Band 104 Gleichnisse waren eine herausragende Form der Verkündigung Jesu. Diese Einsicht der Gleichnisforschung des 20. Jh.s ist kaum umstritten. Die Evangelisten als Überlieferer, Bearbeiter und Interpreten der Gleichnisse Jesu geraten dabei oft aus dem Blick. Die Studie fragt nach dem Gleichnisverständnis des Evangelisten Matthäus. Sie untersucht die sprachlich-literarische Form und die Verwendung dieser Textart sowie den Gebrauch des Begriffes ›Gleichnis‹ im ersten Evangelium. |
 |
Alexandra Grund Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes Psalm 19 im Kontext der nachexilischen Toraweisheit Neukirchener Verlag, 2004, 430 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2042-1 79,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament,
WMANT, Neukirchener Verlag Band 103 Die vorliegende Studie gibt neue Antworten auf die Fragen, die der theologisch so dichte 19. Psalm der Auslegung seit je her aufgibt: auf die Frage nach seiner Einheitlichkeit und Datierung, nach seiner etwaigen "natürlichen Theologie", nach Herkunft und Bedeutung der altorientalischen Motive und nach dem Profil seiner Tora-Theologie im Kontext anderer toraweisheitlicher Konzepte des nachexilischen Israel. Dabei werden zugleich auch neue Wege der Psalmenforschung (Beachtung der Stellung in der Psalterkomposition, rezeptionsorientierte Auslegung) beschritten. Alexandra Grund, geb. 1971, 1990-1998 Studium der Evangelischen Theologie und jüdischen Studien in Wuppertal, Bochum, Naumburg/Saale, Heidelberg und Tübingen, 1998-2000 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am DFG-Projekt ›Die Tier- und Pflanzenwelt der Bibel‹, 2001-2002 DFG-Stipendiatin am Graduiertenkolleg ›Die Bibel - Ihre Entstehung und Ihre Wirkung‹ (Tübingen), seit 2002 Wiss. Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Altes Testament an der Universität Siegen, 2003 Promotion an der Ev.-theol. Fakultät Tübingen mit der vorliegenden Studie, seit 2003 Wiss. Assistentin in Siegen. |
 |
Georg
Freuling Wer eine Grube gräbt Neukirchener Verlag, 2004, 310 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-2007-0 65,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament,
WMANT, Neukirchener Verlag Band 102 Der Tun-Ergehen-Zusammenhang und sein Wandel in der alttestamentlichen Weisheitsliteratur "Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein." Der alttestamentliche Vorläufer dieser sprichwörtlichen Redensart (Spr 26,27) dient üblicherweise als beliebtes Beispiel zur Erklärung, was mit dem »Tun-Ergehen-Zusammenhang« gemeint sei. Die vorliegende Arbeit erläutert, wie die alttestamentliche Weisheit diese Einsicht zur Lebensbewältigung entfaltet und schließlich angesichts widersprüchlicher Erfahrungen problematisiert. |
 |
Ute
Neumann-Gorsolke Herrschen in den Grenzen der Schöpfung Neukirchener Verlag, 2003, 420 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-1998-2 89,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament,
WMANT, Neukirchener Verlag Band 101 Ein Beitrag zur alttestamentlichen Anthropologie am Beispiel von Ps 8, Gen 1, und verwandten Texten Seit den 70er Jahren gilt das jüdisch-christliche Menschbild, mithin das dominium terrae in Gen 1 und die Rede vom königlichen Menschen in Ps 8, als Ausdruck göttlich legitimierter, unbegrenzter Naturbeherrschung und Wegbereiter der ökologischen Krise. Demgegenüber zeigt die vorliegende Studie, dass in diesen Texten dem Menschen eine umfassende Herrschaftsverantwortung in der Schöpfung zukommt,und entfaltet den theologischen Sinn der Sonderstellung des Menschen in exilisch-nachexilischer Zeit. |
 |
Michael Pietsch Dieser ist der Sproß Davids... Neukirchener Verlag, 2003, 480 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-1946-3 85,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament,
WMANT, Neukirchener Verlag Band 100 Studien zur Rezeptionsgeschichte der Nathanverheißung im alttestamentlichen und neutestamentlichen Schrifttum Die Interpretation der Nathanverheißung (2Sam 7) ist bis heute eine crux interpretum der alttestamentlichen Wissenschaft. Die Offenheit und Mehrdeutigkeit des Textes haben bereits seine antiken Rezipienten zu verschiedenen aktualisierenden Neuinterpretationen veranlaßt und sind letztlich in seiner Entstehungsgeschichte selbst begründet. Die vorliegende Untersuchung zeichnet den Weg dieses »traditionsschöpferischen« Prozesses von Rezeption und Interpretation der Nathanverheißung von seinen Anfängen innerhalb der alttestamentlichen Überlieferung über die jüdische Traditionsliteratur der hellenistischen und römischen Zeit bis ins Neue Testament nach. |
 |
Jenö
Kiss Die Klage Gottes und des Propheten Neukirchener Verlag, 2003, 230 Seiten, Paperback, 978-3-7887-1944-9 55,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament,
WMANT, Neukirchener Verlag Band 99 Ihre Rolle in der Kompensation und Redaktion von Jer 11-12, 14-15 und 18 In den mehrschichtigen Textkomplexen Jer 11-12, 14-15 und 18 stehen die Klagen Gottes und des Propheten nebeneinander. Zwar sind zwischen den göttlichen und prophetischen Klagen keine literarischen Beziehungen erkennbar, die inhaltlichen Affinitäten sind jedoch offensichtlich: Wie Gott über seine Verlassenheit klagt, so klagt Jeremia über seine Isolation, aus der er heraustreten möchte. Doch wenn er dies tut, kann er den verlassenen Gott vor dem Volk nicht mehr abbilden. Wie Gott die Folgen seines eigenen Gerichtes trägt, so leidet der Prophet unter den Folgen seiner Verkündigung. |
 |
Jonathan Whitlock Schrift und Inspiration Neukirchener Verlag, 2002, 490 Seiten, Paperback, 978-3-7887-1918-0 95,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament,
WMANT, Neukirchener Verlag Band 98 Studien zur Vorstellung von inspirierter Schrift und inspirierter Schriftauslegung im antiken Judentum und in den paulinischen Briefen Erst spät im Neuen Testament taucht die Behauptung auf, daß die Schrift inspiriert sei. Aber welche Schriften sind gemeint, und was bedeutet Inspiration überhaupt? Diese Studie beginnt bei der Beantwortung dieser Fragen damit, daß sie die alttestamentliche und frühjüdische Verbindung von Geist und Schriftwort durch die Jahrhunderte und dann vor allem bei Paulus nachzuzeichnen versuchen. Das nicht nur historisch, sondern auch theologisch interessante Ergebnis der Untersuchung ist, daß Paulus und seine Schule weniger an der Rolle des Geistes bei der Entstehung der Schrift interessiert sind als vielmehr an der Frage, in welchem Geist die Schrift ausgelegt wird. |
 |
Axel Graupner Der Elohist Neukirchener Verlag, 2002, 490 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-1916-6 89,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament,
WMANT, Neukirchener Verlag Band 97 Gegenwart und Wirksamkeit des transzendenten Gottes in der Geschichte Die Annahme einer Quelle E(lohist) stellt keinen "Irrweg" der Forschung dar, sondern wird durch jene Phänomene erzwungen, die die moderne Pentateuchkritik allererst angestoßen haben: die Doppelung des Stoffes, den Wechsel des Gottesnamens und-vor allem-die Koinzidenz beider Phänomene. Hauptanliegen des Elohisten ist die erzählende Begründung des von der Prophetie des 9. Jh. eingeforderten Bekenntnisses "Jahwe - er ist der Gott" (1Kön 18,21) durch die Darstellung der Gründungsgeschichte Israels als fortschreitende Selbstentbergung Gottes in seinem Mitsein. Der Gott, dessen Mitsein Israel seine Existenz verdankt, ist niemand anderer als Jahwe (Num 23,8.19.21 f); denn Mitsein ist seinem Namen nach sein Wesen (Ex 3,14). Andere theologische Anliegen des Werkes sind auf dieses "Kerygma" bezogen. |
 |
Nicola
Wendebourg Der Tag des Herrn Neukirchener Verlag, 2002, 420 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-1888-6 85,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament, Band 96 Zur Gerichtserwartung im Neuen Testament auf ihrem alttestamentlichen und frühjüdischen Hintergrund Gott als Richter - diese biblisch zentrale Vorstellung bereitet dem modernen Menschen Schwierigkeiten. Die Studie untersucht die neutestamentlich breit belegte Erwartung eines »Tages«, an dem Gott bzw. Christus die Welt richten wird. Momente der Kontinuität zur alttestamentlichen und frühjüdischen Tradition werden ebenso sichtbar wie christologisch motivierte Neuakzentierungen. Die Autorin befragt die Endtagserwartung mit ihren zum Teil anstößigen Seiten auf ihre theologische Bedeutung einst und jetzt hin und gibt Impulse für einen sachgemäßen Umgang mit der biblischen Rede vom Endgericht. |
 |
Martin
Vahrenhorst Ihr sollt überhaupt nicht schwören Matthäus im halachischen Diskurs Neukirchener Verlag, 2002, 480 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-1889-3 95,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament, Band 95 Das Matthäusevangelium gilt in besonderer Weise als "Evangelium der Kirche". Daher kommt ihm in Zeiten der Neubestimmung des Verhältnisses von Kirche und Israel hohes Gewicht zu. Folglich fragt die Forschung nach der Stellung dieses Buches zum Judentum seiner Zeit. Dieser Frage ist die vorliegende Studie verpflichtet. Unter Bezug auf neue judaistische Forschungen und durch sorgfältige Untersuchung der Schlüsselstellen im Matthäusevangelium kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass das Matthäusevangelium ganz innerhalb des Judentums beheimatet sind. Die Studie konzentriert sich auf Texte, die halachische Fragen - also Fragen nach der Gestaltung jüdischer Existenz im Alltag - behandeln. Besonderes Augenmerk richtet sich dabei auf Mt 5 mit der Grundsatzerklärung zur Bedeutung der Tora nebst den Kommentarworten und Mt 23. In beiden Kapiteln erweist sich Matthäus als engagierter und kompetenter Gesprächsteilnehmer am innerjüdischen Diskurs um die Halacha. Dies wird im Detail an den Stellungnahmen zum Schwören (5,33-37 und 23,16-22) gezeigt. Dazu wird das umfangreiche Quellenmaterial zur Schwurpraxis (und zur Diskussion darüber) von den biblischen Grundlagen über papyrologische Zeugnisse, Qumran, Philo und Josephus bis hin zu den tannaitischen Quellen ausgewertet. In diesen Strom einer immer kritischer werdenden Reflexion über das Schwören ordnen sich die matthäischen Aussagen mit eigenen Schwerpunkten bruchlos ein. Neben die ausführliche Besprechung dieses sowohl theologisch wie rechtsgeschichtlich aussagekräftigen Themas treten Ausblicke auf andere halachische Bereiche. Dabei zeigt sich, dass Matthäus auch in Fragen der Sabbat-, Reinheits- oder Scheidungshalacha formal wie inhaltlich im innerjüdischen Diskurs steht. Das "Evangelium der Kirche" ist also ein jüdisches Buch. Gedanken zur Bedeutung dieses Ergebnisse für kirchliches Leben heute runden die Studie ab. KURZTEXT Ob das Matthäusevangelium innerhalb oder außerhalb des Judentums beheimatet ist, entscheidet sich nicht zuletzt an seiner Stellung zu Tora und Halacha, der jüdischen Ethik. Dieser gilt das Interesse der vorliegenden Studie. Sie konzentriert sich vor allem auf die antike jüdische Diskussion über das Schwören von der Hebräischen Bibel bis hin zu den Rabbinen, in die hinein sie Matthäus einordnet. Hierbei erweist sich Matthäus - ebenso wie durch seine Aussagen zur Geltung der Tora, zu Fragen des Sabbats, zum Problem von Rein und Unrein und zu anderen Themen - als engagierter Teilnehmer am innerjüdischen Diskurs über die Halacha |
 |
Johannes
Goldenstein Das Gebet der Gottesknechte Jesaja 63,7 - 64,11 im Jesajabuch Neukirchener Verlag, 2001, 300 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-1858-9 25,00EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Band 92 In eindrücklichen Bildern und mit großer sprachlicher Originalität bittet Jes 63,7 - 64,11 Jahwe um seine Zuwendung und Hilfe für Zion/Jerusalem und sein Volk. Die Studie interpretiert dieses 'Gebet gegen die Verborgenheit Gottes' im literarischen Zusammenhang des Jesajabuches als ein Zeugnis prophetischer Schriftauslegung. Sie bestimmt den Standort des Textes in der alttestamentlichen Theologiegeschichte und beleuchtet den Abschluß der Redaktionsgeschichte des Jesajabuches. Inmitten der Heilsweissagungen für Zion/Jerusalem und seine Bewohner am Ende des Jesajabuches (Jes 60-62; 65-66) steht ein Gebet, das in eindrücklichen Bildern und mit großer sprachlicher Originalität den desolaten Zustand von Stadt, Tempel und Volk beklagt und Jahwe um seine Zuwendung und Hilfe bittet: "Du bist doch unser Vater!. Ach, daß du die Himmel zerrissest und herabführest!" Die Wirkungsgeschichte dieses Textes reicht bis in die christliche Hymnologie ("O Heiland, reiß die Himmel auf", EG 7) und die Ordnung der Predigttexte für den ersten (OLM, Reihe B) bzw. zweiten Advent (Perikopenordnung der EKD, Reihe IV). Dem ersten Anschein nach handelt es sich bei Jes 63,7 - 64,11 um ein Volksklagelied, das im literarischen Kontext des Jesajabuches überliefert ist. Doch die in der Forschung weit verbreitete Interpretation des Textes allein in der Tradition der Volksklage bleibt eine plausible Antwort auf die Frage schuldig, warum das Gebet dort zu stehen kommt, wo es heute steht. Die vorliegende Studie stellt dieses 'Gebet gegen die Verborgenheit Gottes' in den literarischen Zusammenhang des Jesajabuches und interpretiert es als ein Zeugnis prophetischer Schriftauslegung. Vor dem literarischen Horizont des Jesajabuches erschließt sich der Text als das Gebet schriftgelehrter Tradenten der jesajanischen und deuterojesajanischen Prophetie, die ihr Schicksal im Licht des leidenden Gottesknechts der Ebed-Jahwe-Lieder und der Verstockungsaussage von Jes 6 deuten. Anhand seiner Spitzenaussagen wie der Heiligkeitsprädikationen für Jahwes Geist und die judäischen Städte, der (im Alten Testament hier einzigartigen!) direkten Anrede Jahwes als Vater und einem radikal 'theozentrischen' Sündenverständnis wird der Text in der alttestamentlichen Theologiegeschichte verortet. Nach der detaillierten sprachlichen Analyse und der theologischen Profilierung des Textes ordnet die Göttinger Dissertation das Gebet Jes 63,7 - 64,11 schließlich in die literarischen Wachstumsprozesse des sog. "Tritojesaja" ein. In einer Verbindung von Fortschreibungshypothese und literarkritischer Differenzierung beleuchtet sie die letzten Phasen der Redaktionsgeschichte des Jesajabuches und gibt damit einen neuen Impuls für die Tritojesajaforschung, besonders im Blick auf die Entstehung von Jes 62-66. |
 |
Klaus-Peter
Adam Der königliche Held Neukirchener Verlag, 2001, 280 Seiten, 12 Abbildungen, Gebunden, 978-3-7887-1855-8 25,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament, Band 91 Die Entsprechung von kämpfendem Gott und kämpfendem König in Psalm 18 Wie ist es zu verstehen, wenn der königliche Beter des 18. Psalms in den Kampf zieht, und warum ist zuvor JHWHs Nahen zum Kampf erwähnt? Welche grundsätzliche Vorstellung von JHWH steckt hinter dessen kriegerischen Zügen, die sich auch in anderen Psalmen finden, und was bedeuten diese Vorstellungen für die Rede vom israelitischen König? Religionsgeschichtliche Überlegungen zum Entsprechungsverhältnis zwischen JHWH und irdischem König im Kampf ermöglichen eine präzisere Rekonstruktion des israelitischen Verständnisses vom Königtum. |
 |
Matthias
Millard Die Genesis als Eröffnung der Tora Kompositions- und auslegungsgeschichtliche Annäherungen an das erste Buch Mose Neukirchener Verlag, 2001, 420 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-1830-5 39,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament, Band 90 Der Titel des Buches ist Programm: Das Buch Genesis wird als Teil der fünf Bücher Mose interpretiert, d.h. als Eröffnung eines literarischen Werkes, das Sitte und Recht setzt. Die Studie enthält dabei sowohl einen historisch-kritischen als auch einen wirkungsgeschichtlichen Zugang zum Thema. Als fruchtbarer Gesprächspartner der wirkungsgeschichtlichen Darstellung erweist sich dabei vor allem die jüdische Auslegungsgeschichte. Das Ergebniss stellt sich u.a. als ein Impuls zu einer Genesisexegese dar, die die Erzählungen der Genesis als sukzessive Entfaltungen ethischer Themen mit einem speziellen Zugang zum Thema des Naturrechts versteht. Der Titel des Buches ist Programm: Das Buch Genesis wird als Teil der fünf Bücher Mose interpretiert, d.h. als Eröffnung eines literarischen Werkes, das Sitte und Recht setzt. Die Studie enthält dabei sowohl einen historisch-kritischen als auch einen wirkungsgeschichtlichen Zugang zum Thema. Als fruchtbarer Gesprächspartner der wirkungsgeschichtlichen Darstellung erweist sich dabei vor allem die jüdische Auslegungsgeschichte. Das Ergebniss stellt sich u.a. als ein Impuls zu einer Genesisexegese dar, die die Erzählungen der Genesis als sukzessive Entfaltungen ethischer Themen mit einem speziellen Zugang zum Thema des Naturrechts versteht. Der Titel des Buches ist Programm: Das Buch Genesis wird als Teil der fünf Bücher Mose interpretiert, d.h. als Eröffnung eines literarischen Werkes, das Sitte und Recht setzt. Die Studie enthält dabei sowohl einen historisch-kritischen als auch einen wirkungsgeschichtlichen Zugang zum Thema. Als fruchtbarer Gesprächspartner der wirkungsgeschichtlichen Darstellung erweist sich dabei vor allem die jüdische Auslegungsgeschichte. Das Ergebniss stellt sich u.a. als ein Impuls zu einer Genesisexegese dar, die die Erzählungen der Genesis als sukzessive Entfaltungen ethischer Themen mit einem speziellen Zugang zum Thema des Naturrechts versteht. |
 |
Marc
Wischnowsky Tochter Zion Aufnahme und Überwindung der Stadtklage in den Prophetenschriften des Alten Testaments Neukirchener Verlag, 2001, 335 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-1831-2 25,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament, Band 89 Tochter Zion, freue dich - die Vorstellung von Jerusalem als Frau spricht Menschen bis heute unmittelbar an. Die Studie erhellt die Ursprünge des Motivs in der kulturellen Umwelt des Alten Israel und zeichnet die Entwicklung im Alten Testament nach. Dort wird Jerusalem in eindringlichen Bildern als verlassene Mutter und Witwe beklagt, in scharfen Anklagen als Ehebrecherin für ihr Unglück verantwortlich gemacht und endlich als zukünftige Gottesbraut und Mutter ihrer Bewohner gepriesen. In seiner Gesamtschau läßt der Verfasser die historischen Bedingungen der Personifikation und ihre theologischen Implikationen klar hervortreten. Marc Wischnowsky, geb. 1965, Studium der Theologie in Göttingen, 1997 - 99 Vikar der Ev.-luth. Landeskirche Hannover, seit Anfang 2000 beschäftigt als Krankenhausseelsorger, 2000 Promotion an der Theologischen Fakultät der Universität Göttingen mit dieser Arbeit |
 |
Thomas Knöppler Sühne im Neuen Testament Neukirchener Verlag, 2001, 384 Seiten, Paperback, 978-3-7887-1815-2 39,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
88 Studien zum urchristlichen Verständnis der Heilsbedeutung des Todes Jesu Zu den entscheidenden soteriologischen Lehraussagen des christlichen Glaubens gehört die Rede vom Sühnetod Jesu. Die Auskunft, daß der Tod Jesu Sühne wirkt, ist freilich heftig umstritten. Zudem besteht keine Einigkeit über den Sachgehalt des neutestamentlichen Sühnebegriffs. Die vorliegende Arbeit versucht, der Kritik wie der Uneinigkeit durch eine Analyse biblischer Texte zu begegnen. Anhand der Koordinaten des alttestamentlichen Sühnebegriffs (MT und LXX) werden die neutestamentlichen Sühneaussagen untersucht. Herausgeber d. Reihe: Cilliers Breytenbach, Bernd Janowski, Reinhard G. Kratz, Hermann Lichtenberger |
 |
Gunter
Kennel Frühchristliche Hymnen? Gattungskritische Studien zur Frage nach den Liedern der frühen Christenheit Neukirchener Verlag, 1995, 334 Seiten, Pappband, 978-3-7887-1514-4 69,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament, Band 71 Die vorliegende Arbeit ist der Versuch, einen Weg aus den Schwierigkeiten zu weisen, in die sich die neutestamentliche Forschung bei der Frage nach den »frühchristlichen Hymnen« immer wieder verstrickt hat. Sie setzt bei der Gattungsfrage ein, denn nur so kann das Problem behandelt werden, ob sich überhaupt eine Gruppe von Texten innerhalb der urchristlichen Literatur als »Hymnen« bezeichnen und zusammenfassen läßt. Anhand eines Vergleichs von drei ausgewählten Texten des Neuen Testaments werden gattungsrelevante Verwandtschaftsbezüge beschrieben, woraufhin auch eine methodisch kontrollierte Zuordnung weiterer Texte möglich wird. Die hier angewandte neu entwickelte Kriteriologie und Analysemethode basiert auf neueren sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen und kann auch für andere Fragestellungen fruchtbar gemacht werden. Gunter Kennel, geb. 1961 in Kaiserslautern; Studium der Ev. Kirchenmusik und Theologie in München und London; Vikariat in München; seit 1992 Kantor in Berlin-Kreuzberg; 1994 Promotion zum Dr. theol. in München. |
 |
Wolfgang Weiss Zeichen und Wunder Neukirchener Verlag, 1995, 189 Seiten, Pappband, 3-7887-1471-9 978-3-7887-1471-0 34,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament, Neukirchener Verlag, Band 67 Eine Studie zu der Sprachtradition und ihrer Verwendung im Neuen Testament Wer heute von Zeichen und Wundern spricht, gebraucht eine fest alttestamentliche Wendung. Im Neuen Testament wird der Doppelbegriff als eigenständige Sprachtradition verwendet, sowohl positiv als auch kritisch. Die Studie behandelt Voraussetzungen und Herkunft der neutestamentlichen Sprachtradition und geht deren Form und dem unterschiedlichen Verständnis nach. Das Thema wird in dieser Untersuchung erstmals monographisch behandelt und traditionsgeschichtlich umfassend dargestellt. Wolfgang Weiß, Dr. theol., geb. 1955, ist Professor für Neues Testament in Oldenburg. |
 |
Wolfgang
Kraus Der Tod Jesu als Heiligtumsweihe Eine Untersuchung zum Umfeld der Sühnevorstellung in Römer 3,25-26a Neukirchener Verlag, 1992, Hardcover, 342 Seiten 3-7887-1395-x 978-3-7887-1395-9 39,90 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Band
66 Die Studie untersucht die traditionsgeschichtlichen Hintergründe von Röm 3,25f. Dabei finden sowohl die kultische Sühne (Lev 16; Ez 43 und 45) wie auch die Vorstellung vom sühnenden Märtyrertod Beachtung. Ebenso wird der Auslegungsgeschichte von Lev 16 nachgegangen. Es stellt sich heraus, daß Paulus eine Überlieferung verwendet, die ihren >Sitz im Leben< in der Auseinandersetzung um die Effizienz der kultischen Sühne hat und die den Akzent - entsprechend der jüdischen Unterscheidung - nicht auf die Person-, sondern auf die Heiligtumssühne gelegt wissen wollte. Davon ausgehend wird Röm 3,21- 26 interpretiert und werden Linien in das übrige Neue Testament gezogen. Dabei wird nachgewiesen, daß das Verständnis des Todes Jesu als Weihe eines eschatologischen Heiligtums auch sonst im Neuen Testament Spuren hinterlassen hat. Wolfgang Kraus, geb. 1955 in Würzburg, nach dem Studium der evang. Theologie in Neuendettelsau, HeideIberg, Göttingen und Erlangen und dem Vikariat von 1982-1988 Studienleiter im Evang. -Luth. Studienheim mit Knabenchor, Windsbach. Danach als Pfarrer mit allgemeinkirchlichen Aufgaben im Rahmen des christlich-jüdischen Gesprächs tätig. Dr. theol . im Sommer 1990 in Erlangen. Seither Wiss. Assistent am dortigen Institut für Neues Testament. |
 |
Klaus Koenen Ethik und Eschatologie im Tritojesajabuch Eine literaturkritische und redaktionsgeschichtliche Studie Neukirchener Verlag, 1990, Leinen, 280 Seiten 978-3-7887-1308-9 24,80 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Band 62 Ethik und Eschatologie im Tritojesajabuch Eschatologie / Lehre von den letzten Dingen |
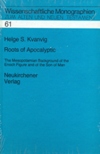 |
Helge S.
Kvanvig Roots of Apocalyptic The Mesopotamian Background of the Enoch Figure and the Son of Man Neukirchener Verlag, 1988, Leinen, 3-7887-1248-1 69,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Band 61 The book aims at giving the answer to how the characteristics of apocalyptic literature emerged. This is done through a detailed analysis of Mesopotamian and Jewish sources. Many of these sources have not been considered in this context before. The book concentrates on the two earliest apocalyptic traditions: The Enochic traditions and the Danielic traditions about the Son of Man. The roots of the Enochic literature are traced in Mesopotamian primeval traditions, the roots of the Danielic Son of Man vision in Mesopotamian visionary literature. Through these analyses the author presents a comprehensive model of the process shaping apocalyptic literature. The results are new and a challenge to previous research in the field. Helge S. Kvanvig, born 1948. Cand.theol. at the Free Faculty of Theology 1972. Research assistant at Hamburg University 1972-73. Faculty lecturer at the Free Faculty of Theology 1975. Scholarship from the Norwegian Research Council 1979-81. Research in Oxford and Jerusalem. Doctor's degree in theology at the University of Oslo 1984. Senior lecturer at the Free Faculty of Theology from 1984. Guest Professor at Lutheran Theological Seminary, Hong Kong 1987-88. |
 |
Bernd Janowski Sühne als Heilsgeschehen Neukirchener Verlag, 2000, 469 Seiten, Gebunden, 978-3-7887-1782-7 85,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament,
Band 55 Traditions- und religionsgeschichtliche Studien zur priesterschriftlichen Sühnetheologie Die Rede vom Sühnetod Jesu gehört zu den zentralen Lehrstücken des christlichen Glaubens. Nur wenige Grundbegriffe der Bibel werden allerdings so kontrovers beurteilt wie gerade der Sühnebegriff. Die vorliegende Arbeit versucht, dieser Kritik durch traditions- und religionsgeschichtliche Untersuchungen der alttestamentlichen Sühneaussagen zu begegnen. Ausgehend von etymologischen und semantischen Analysen der Wurzel KPR wird dabei vor allem die priesterschriftliche Sühnetheologie und deren Rezeption im Neuen Testament untersucht. Ein ausführlicher Anhang dokumentiert die seit 1983 erschienene Literatur zum Thema und nimmt noch einmal zu einzelnen Sachfragen Stellung. |
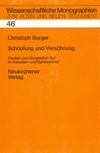 |
Christoph
Burger Schöpfung und Versöhnung Studien zum liturgischen Gut im Kolosser- und Epheserbrief Neukirchener Verlag, 1976, VIII, 164 Seiten, Leinen, 3-7887-0448-9 19,90 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Band
46 Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die vieldiskutierten Texte KoI 1,15-20 und Eph 2,14-18. Sie handeln von Schöpfung und Versöhnung und verwenden dazu Formulierungen frühchristlicher Hymnen. Die traditions- und redaktionsgeschichtliche Analyse arbeitet die theologische Konzeption der verwendeten Stücke heraus und läßt gleichzeitig das intensive Bemühen der Paulus-Schule deutlich werden, die hymnischen Aussagen im Sinne des Apostels zu interpretieren. Eine erste Deutung durch den Verfasser des Kolosserbriefes wurde nachträglich von einem Glossator überarbeitet. Der Autor des Epheserbriefes fand diese bearbeitete Deutung vor und führte sie in seiner Neufassung des Schreibens fort. |
 |
Henning
Paulsen Überlieferung und Auslegung in Römer 8 Neukirchener Verlag, 1975, 226 Seiten, Leinen, 3-7887-0409-8 24,90 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Band
43 In Römer 8 umschreibt Paulus »die neue Wirklichkeit des Menschen in Christus als die Gegenwart des Geistes« (Eichholz). Das Kapitel schließt damit jenen Teil des Römerbriefs ab (Kap. 5-8), in dem Paulus die Existenz des Christen unter dem Aspekt der Rechtfertigung betrachtet. Wie in den übrigen Partien des Römerbriefs weiß sich Paulus auch in Römer 8 in einem intensiven Gespräch mit der theologischen Überlieferung. Paulsen geht in seiner Arbeit der Frage nach, welche Überlieferungen Paulus in Römer 8 aufnimmt und wie er sie den Empfängern seines Briefes gegenüber interpretiert. Die Untersuchung hat exemplarischen Charakter und eröffnet Ausblicke auf das gesamte Feld der paulinischen Briefliteratur. Der Autor setzt mit grundsätzlichen Erwägungen über das Wesen überlieferungsgeschichtlicher Arbeit ein und bestimmt dann zunächst die Stellung von Römer 8 im Kontext des Römerbriefs. Den Ausgangspunkt für die überlieferungsgeschichtliche Untersuchung der großen Texteinheiten von Römer 8 im Hauptteil der Arbeit bilden jeweils Form- und Strukturanalysen der betreffenden Texte. Der Nachweis, ob und inwieweit in den zu Tage tretenden Motiven, Gedankenzusammenhängen und Begriffsfeldern Überlieferung vorliegt, sowie die Beschreibung ihres historischen Horizonts, ihres ursprünglichen Charakters und ihrer Entstehungsbedingungen schließen sich daran an. Schließlich bestimmt Paulsen jeweils die Art und Weise, in der Paulus diese Traditionen in Römer 8 aufnimmt und deutet. Die überlieferungsgeschichtliche Analyse von Römer 8 führt zu dem Ergebnis, daß das Verhältnis des Paulus zu den Traditionen des Urchristentums und seiner Umwelt mannigfach und differenziert gesehen werden muß, An diesem schöpferischen Prozeß von Übernahme, Kritik und Auslegung der Überlieferung wird auf der einen Seite deutlich, wie sich die historische Rolle des Paulus konkretisieren läßt. Zugleich weisen aber auch die Mittel, mit denen Paulus Überlieferung auslegt und in seine Theologie einbezieht, auf die Konturen und Schwerpunkte dieser Theologie selbst hin. |
 |
Gerhard
Liedke Gestalt und Bezeichnung alttestamentlicher Rechtssätze Eine formgeschichtlich-terminologische Studie. Neukirchener Verlag, 1971, 208 Seiten, 3-7887-0049-1 22,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Band
39 Nachdem die wissenschaftliche Arbeit über Recht und Gesetz im Alten Testament lange Zeit durch die bedeutende Untersuchung über "Die Ursprünge des israelitischen Rechts" von A. Alt bestimmt worden ist, sind durch eine Reihe von Arbeiten in den vergangenen Jahren in die Diskussion über diesen Themenkreis neue Gesichtspunkte eingebracht worden. Im deutschsprachigen Raum sind hier u.a. die Untersuchungen über die "Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament" von H.J.Boecker und über "Wesen und Herkunft des 'apodiktischen' Rechts" von E. Gerstenberger zu nennen. Der Verfasser führt die so begonnene Arbeit mit seiner Dissertation weiter, indem er sich zwei Rechtsformen, dem kasuistischen und dem apodiktischen Rechtssatz, und zwei Rechtstermini zuwendet. Liedke zeigt, daß dem kasuistischen Rechtssatz und dem Stamm spt jeweils dieselben Vorgänge zugrundeliegen ; entsprechendes gilt für hqqq und den apodiktischen Rechtssatz. Kasuistische Rechtssätze sind entstanden aus der Tradierung von Urteilen, die in nichtautoritären, schiedsgerichtlichen Verfahren des Sippenältestengerichts vereinbart wurden. Die Untersuchung des Stammes spt führt primär in denselben Verfahrensbereich, weshalb mispa Bezeichnung des kasuistischen Rechtssatzes werden kann. Der apodiktische Rechtssatz dagegen ist 'gesetztes Recht'. Er wird den Untergebenen von einer Autorität, zunächst wohl vom pater familias, als Grenze gesetzt. In denselben Bereich autoritärer Setzung führt die Behandlung des Stammes hqq, weshalb hoq den apodiktischen Rechtssatz bezeichnen kann. Diese Ergebnisse sind nur durch eine Untersuchung der "Vorgeschichte" der Formen und Begriffe in erzählenden Texten des Alten Testaments zu erhalten. In den Rechtskorpora hingegen sind sowohl die Formen als auch die Begriffe nicht mehr nach ihren spezifischen Funktionen unterschieden. Anhangsweise untersucht Liedke in derselben Weise aus Gründen der Abgrenzung die Begriffe miswah und torah. Dabei ergeben sich folgende Hypothesen: miswah ist Bezeichnung des Gebotes (wie z.B. im Dekalog), torah ist ursprünglich ein weisheitlicher Termmus. |
 |
Ludwig
Schmidt Menschlicher Erfolg und Jahwes Initiative Studien zu Tradition, Interpretation und Historie in Überlieferungen von Gideon, Saul und David Neukirchener Verlag, 1970, 246 Seiten, 3-7887-0010-6 22,50 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Band
38 Die vorliegende Untersuchung stellt die geringfügig gekürzte Fassung meiner Dissertation dar, die unter dem Titel: "Erfolg des Menschen und Initiative Jahwes" im Sommersemester 1969 von dem Kollegium der Kirchlichen Hochschule Berlin angenommen wurde. Mein besonderer Dank gilt Herrn Professor Dr. Diethelm Michel, der mir seit Oktober 1965 eine Assistentenstelle an der Kirchlichen Hochschule übertragen hat. Ohne seine Ermunterung und seinen Rat wäre die Arbeit nicht entstanden. Durch Anregungen und kritische Anfragen hat auch Herr Professor Dr. Richard Hentschke die Untersuchung gefördert, wofür ich ihm ebenfalls meinen Dank aussprechen möchte. Herrn Professor D. Dr. Gerhard v. Rad bin ich sehr dankbar für die Aufnahme der Arbeit in die "Wissenschaftlichen Monographien zum Alten und Neuen Testament." Die Mühe der Korrekturarbeiten hat freundlicherweise Herr stud. theol. Manfred Berner mit mir geteilt. An dieser Stelle möchte ich auch meinem Vater danken, der mir das Studium ermöglichte. Berlin, im April 1970 Ludwig Schmidt |
 |
Hans - Martin Lutz Jahwe - Jerusalem und die Völker Zur Vorgeschichte von Sacharja 12,1-8, 14,105 Neukirchener Verlag, 1968, 248 Seiten, 22,00 EUR |
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Band 27 Zur Vorgeschichte von Sacharja 12,1-8, 14,105 |