| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Reformator Martin Luther | Männer der Reformation / Reformatoren | Frauen der Reformation |
|
Petrus Canisius (8.5.1521-1597) |
||
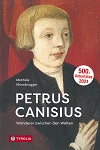 |
Mathias Moosbrugger Petrus Canisius Wanderer zwischen den Welten Tyrolia, 2021, 288 Seiten, gebunden, 978-3-7022-3929-9 27,95 EUR |
Protagonist der katholischen Reform Die neue Biographie zum 500. Geburtstag Petrus Canisius (1521–1597) ist nichts weniger als eine Schlüsselfigur des dramatischen 16. Jahrhunderts. In ihm verkörperte sich das Ringen der katholischen Kirche, sich angesichts der Reformation neu zu erfinden. Beweglichkeit und überschäumender Tatendrang kennzeichnete den ersten „deutschen“ Jesuiten, er gründete Kollegien und Schulen, Köln, Mainz, Ingolstadt und Augsburg, das Konzil von Trient, Wien und Prag, Innsbruck und Freiburg (CH) sind nur einige seiner Stationen. Dieses biographische Porträt beleuchtet die kampfeslustige intellektuelle Beschäftigung des Petrus Canisius mit den Kirchenvätern und seine Rolle als Autor des erfolgreichsten Religionsbuches aller Zeiten, thematisiert aber auch seine gravierenden Fehlleistungen, etwa im Bereich der Hexenverfolgungen. Dem Historiker und Theologen Mathias Moosbrugger gelingt es, die Persönlichkeit des Canisius zu erschließen und nicht einfach nur sein Leben nachzuerzählen. Leseprobe |
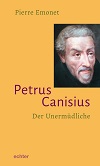 |
Pierre Emonet Petrus Canisius Der Unermüdliche Echter Verlag, 2020, 220 Seiten, Gebunden, 978-3-429-05549-3 16,90 EUR |
Petrus Canisius (1521-1597) ist eine der eindrucksvollsten
Gestalten zu Beginn der Gesellschaft Jesu. Obwohl er nicht zur
Gründergeneration gehörte, übte er einen außergewöhnlichen Einfluss
aus. Er lebte in einer Zeitenwende, im Übergang zur Moderne, einer Zeit also, die sich u.a. dadurch auszeichnet, den Menschen als Subjekt zu verstehen, Glauben in stärkerem Maße in Frage zu stellen und das Verhältnis zur Autorität neu zu gestalten; in einer Zeit, in der gleichzeitig die religiöse Praxis abnahm und das Verhalten der Kleriker, die Amtsführung und das Pfründenwesen die Kirche bis in die höchsten Instanzen hinein unglaubwürdig machten. In seinen vielfältigen Aktivitäten und Funktionen, die er in ausgewogener und scharfsinniger Weise ausübte, spielte Canisius eine wichtige Rolle in der Gegenreformation und war so für den deutschen Katholizismus eine prägende Gestalt. |
 |
Patrizio Foresta Wie ein Apostel Deutschlands Apostolat, Obrigkeit und jesuitisches Selbstverständnis am Beispiel des Petrus Canisius (1543–1570) Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, 528 Seiten, gebunden, 978-3-525-10100-1 120,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 239 Nach dem Auftreten der Reformation und besonders nach der Verhärtung der konfessionellen Fronten im Anschluss an den Augsburger Reichstag 1555 wurden die Territorien des Alten Reichs in den Augen vieler Zeitgenossen das Haupteinsatzfeld der so genannten katholischen Reform und Gegenreformation bzw. des frühneuzeitlichen Katholizismus. Dies galt auch für diejenigen Jesuiten, die bereits ab 1540-1541 in Deutschland eingesetzt worden waren. Ihnen trat eine Situation entgegen, die wegen der extremen Vielfalt der religiösen, politischen und sozialen Gegebenheiten sehr schwer zu bewältigen war und worauf sie anfangs unvorbereitet waren. Das war der Hauptgrund, weswegen sie ein möglichst breites Spektrum an Strategien entwickeln mussten, welche die vor ihnen stehenden religionspolitischen Fragen hätten lösen können. Die Jesuiten erkannten in der Erfüllung ihrer Aufgaben den apostolischen, i. e. den heilsgeschichtlichen und zugleich seelsorglichen Charakter ihrer Societas Jesu. Er wurde in der Natur und Berufung des Ordens in dem Maße gesehen, wie sich die Patres selbst als »Apostel« wahrnahmen. In diesem Zusammenhang wird das Selbst- und Apostolatsverständnis des Jesuiten Petrus Canisius (1521-1597) und derjenigen Patres (unter anderen Jerónimo Claude Jay, Pierre Favre, Alfonso Salmerón, Nicolas Bobadilla, Paul Hoffaeus), die als erste nach Deutschland gesandt wurden, dort tätig waren und die Anfangsjahre der deutschen Ordensprovinzen prägten, unter besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zur Obrigkeit untersucht. Inhaltsverzeichnis und Leseprobe |