| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Vandenhoeck & Ruprecht | ||
 |
Brandt C Klawitter A Forceful and Fruitful Verse Vandenhoeck & Ruprecht, 2023, 285 Seiten, gebunden, 978-3-525-57350-1 79,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 269 English: Genesis 1:28 in Luther's Thought and its Place in the Wittenberg Reformation (1521-1531) Luther’s understanding of “Be fruitful and multiply“: Powerful to Break. Powerful to Build.“Be fruitful and multiply” is a verse with a storied history. Whether in theology or natural law, this much-debated verse’s explosive potential had gone largely dormant prior to the Reformation. For Luther, however, in the context of the debate surrounding monastic vows, this verse would once again take on new life. Fueled by the contributions of his fellow reformers – especially with regard to the normative nature of man’s sexuality – a powerful new understanding of this verse emerged. This new understanding, a synthesis of Luther’s own scriptural understanding coupled with powerful natural-philosophical insight from Melanchthon, would go on to play a significant role as former celibates abandoned their vows. It would also offer normative shape to the contours of Reformation marriage even as it took its place in such important works as the Augsburg Confession and Melanchthon’s Apology. |
 |
Eva Maria Verst-Lizius Reisen nach Jerusalem Westdeutsche Christen im »Heiligen Land« und Israel (1950er bis 1970er Jahre) Vandenhoeck & Ruprecht, 2022, 284 Seiten, gebunden, 978-3-525-57343-3 79,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 266 Die Arbeit zeigt die ganze Bandbreite christlichen Reisens von Deutschen nach Israel auf.Mit welchen Erwartungen, Ideen und Vorannahmen reisten Deutsche im Zeitraum der 1950er bis 1970er Jahre nach Israel - beziehungsweise ins »Heilige Land« - und auf welche Weise wurden ihre Interpretationen des bereisten Raums vorgeprägt? Westdeutsche Gruppenreisen christlicher Organisationen zwischen traditionellen Heiliglandreisen und modernen Tourismusformen waren dabei verschiedensten Einflüssen ausgesetzt. Als zentrale Themenkomplexe stehen bei der Analyse von Deutungsmustern der Wandel von Religiosität in der Bundesrepublik, der Umgang mit der Vergangenheit des Holocaust, der sich in verschiedenen Krisen und Kriegen zuspitzende Nahostkonflikt sowie Zuschreibungen zum Fremden und zum Eigenen im Mittelpunkt. Drei Reiseformen werden exemplarisch untersucht: Pilgerreisen, Studienreisen und Freiwilligendienste und so die Bandbreite christlichen Reisens von Deutschen nach Israel bzw. ins »Heilige Land« aufgezeigt. Inhaltsverzeichnis |
 |
Christian Volkmar Witt Lutherische »Orthodoxie« als historisches Problem Leitidee, Konstruktion und Gegenbegriff von Gottfried Arnold bis Ernst Troeltsch Vandenhoeck & Ruprecht, 2021, 297 Seiten, gebunden, 978-3-525-50184-9 75,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 264 Die lutherische »Orthodoxie« behauptet ihren festen Platz in der nachreformatorischen Kirchen- und Theologiegeschichte. Im Gegenüber zu Pietismus und Aufklärung habe es eine historisch erfassbare Größe namens »Orthodoxie« gegeben, die - so die Annahme weiter - all das verkörperte, wogegen Pietisten und Aufklärer dann in bester reformatorischer Tradition sowie zunehmend erfolgreich in die Schranken traten. Dieser Antagonismus und der dahinter liegende Entwicklungsteleologismus verdanken sich allerdings nachweislich den positionellen Bindungen und theologiepolitischen Anliegen bis heute wirkmächtiger historiographischer Entwürfe, wie sie nach G. Arnold beispielsweise auch L. T. Spittler, G. J. Planck, K. Hase, F. Chr. Baur, A. Tholuck und schließlich E. Troeltsch vorgelegt haben. Angesichts dessen wird die Karriere der betreffenden Kategorie als Leitidee, Konstruktion und Gegenbegriff nachgezeichnet und durch Zusammenführung institutionentheoretischer, theologiehistorischer sowie begriffsgeschichtlicher Ansätze analysiert, um ihre historische Belastbarkeit und wissenschaftssprachliche Tauglichkeit zu hinterfragen. Open Access pdf |
 |
Stanislau Paulau Das andere Christentum Zur transkonfessionellen Verflechtungsgeschichte von äthiopischer Orthodoxie und europäischem Protestantismus Vandenhoeck & Ruprecht, 2020, 270 Seiten, gebunden, 978-3-525-33604-5 110,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 262 Transkontinentale Verflechtungen in der globalen Christentumsgeschichte der Neuzeit. Bereits im Jahre 1534 reiste ein äthiopischer Mönch nach Wittenberg, um dort Kontakt mit Martin Luther und Philipp Melanchthon aufzunehmen. Der daraus resultierte theologische Dialog markierte den Anfang einer Verflechtungsgeschichte von äthiopisch-orthodoxem Christentum und europäischem Protestantismus. Das andere Christentum erschließt erstmals die vielfältigen Wechselwirkungen von äthiopisch-orthodoxem Christentum und europäischem Protestantismus im Zeitraum vom 16. bis zum frühen 20. Jahrhundert. Damit bietet es einen neuen Blick sowohl auf die afrikanische als auch auf die europäische Kirchengeschichte der Neuzeit. Das Werk zeigt beispielhaft, auf welche Weise konfessionell und kulturell divergierende Varianten des Christentums kontinentübergreifend miteinander verknüpft waren, und leistet somit einen grundlegenden Beitrag zur globalen Christentumsgeschichte und der Interkulturellen Theologie. Methodisch knüpft die Arbeit hierbei an den Ansatz der Histoire croisée an und macht ihn für eine transkonfessionelle Kirchengeschichtsschreibung fruchtbar. Blick ins Buch Zur Seite Weltreligionen |
 |
Margarete Hopf Ein Osservatore Romano für die Evangelische Kirche in Deutschland Der Konzilsbeobachter Edmund Schlink im Spannungsfeld der Interessen Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, 416 Seiten, gebunden, 978-3-525-57077-7 89,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 254 Im Schnittpunkt von Kirchlicher Zeitgeschichte und Ökumenik untersucht Magaretha Hopf die Konzilsbeobachtung der Evangelischen Kirche in Deutschland auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965). Sie blickt hierzu in zahlreiche bislang unveröffentlichte Archivquellen aus dem Nachlass des Heidelberger Dogmatikers und Ökumenikers Edmund Schlink. Dieser war bereits während der Vorbereitungsphase des Konzils und dann während aller Sitzungsperioden als delegierter Beobachter der EKD in Rom. Seine schriftlichen Berichte an den Ratsvorsitzenden und weitere führende Persönlichkeiten der EKD überliefern Schlinks Wahrnehmung des ökumenischen Jahrhundertereignisses Vaticanum II und seine Versuche, darauf Einfluss zu nehmen. Hopf geht den Überlegungen und Hintergründen zur Entsendung Schlinks und den Reaktionen der EKD auf das über Schlink vermittelte Konzilsgeschehen nach. Verbunden mit einem Perspektivenwechsel in der Darstellung untersucht Hopf das Anliegen und die Interessen Schlinks, sein Agieren in Rom, seine Rolle im Beobachterkreis und seine Einflussnahme auf das Konzilsgeschehen. Die Autorin integriert Einsichten und Anregungen verschiedener methodischer Zugänge (historische Diskursanalyse, qualitative historische Netzwerkforschung), hat aber auch ein Interesse an den im engeren Sinne theologischen Inhalten, die auf dem Konzil und in den Berichten Schlinks verhandelt werden, und bewegt sich damit auch auf systematisch-theologischem bzw. dogmatischem Terrain. |
 |
Carsten Brall Konfessionelle Theologie und Migration Die Antwerpener Gemeinde Augsburger Konfession im 16. Jahrhundert Vandenhoeck & Ruprecht, 2017, 403 Seiten, gebunden, 978-3-525-56721-0 95,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 249 Die Antwerpener Gemeinde des Augsburger Bekenntnisses (CA) des Jahres 1566/67 war zu dieser Zeit die größte und wichtigste Gemeinde von Anhängern der CA im niederländischen Raum und von herausragender Bedeutung für die Entwicklung des Luthertums der Niederlande insgesamt. Die Ausweisung der Gemeinde 1567 hatte zur Folge, dass ihre Anhänger auf sehr unterschiedliche Weise das Erbe der Gemeinde forttrugen und es teilweise zur Gründung von Tochtergemeinden kam. Carsten Brall untersucht, wie diese Tochtergemeinden und Verbindungen zur Antwerpener Muttergemeinde ausgesehen haben und welche weiteren Folgewirkungen der Gemeinde feststellbar sind. Er spannt einen Bogen von den Voraussetzungen bei der Gründung der Gemeinde (1566) bis zur Entstehung der Frankfurter Niederländischen Gemeinde Augsburger Confession, in der die Antwerpener Wurzeln bis auf den heutigen Tag präsent sind. Der Autor beleuchtet die Theologie in der Gemeinde und deren Fortleben in den Transformationen der Gemeinde. Es wird deutlich, dass sich gerade gnesiolutherische Theologen wie Matthias Flacius und Cyriakus Spangenberg in Antwerpen Gehör verschaffen konnten. Daneben stellt Brall die Frage nach sozialen Gegebenheiten im Kontext der Entwicklung der Gemeinde, wie auch das Problem, welche Kontakte und Kontinuitäten sich bei den Antwerpener Anhängern der CA nach der Emigration feststellen lassen. Leseprobe |
 |
Jeung Keun Park Johann Arndts Paradiesgärtlein Eine Untersuchung zu Entstehung, Quellen, Rezeption und Wirkung Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, 269 Seiten, gebunden, 978-3-525-57088-3 75,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 248 Johann Arndt (1555-1621) hat auf die Frömmigkeit in Deutschland während der frühen Neuzeit gewirkt und besonders auf den Pietismus einen entscheidenden Einfluss ausgeübt. Die heutige Arndt- und Pietismusforschung zeigt sich allerdings als ein umstrittenes Feld, in dem Arndts Gebetbuch Paradiesgärtlein bis heute nicht genügend berücksichtigt wurde. Jeung Keun Park untersucht Arndts Rezeption der mittelalterlich-mystischen und außerreformatorischen Quellen, deren Gedanken Arndt in den Protestantismus des 17. Jahrhunderts einströmen ließ. Es zeigt sich dabei, dass Autoren und Schriften wie Johann Tauler, die Theologia deutsch, Angela de Foligno, die Imitatio Christi, Valentin Weigel und Paracelsus großen Einfluss auf Arndts Schrift das Wahre Christentum (1605-1610) und die Texte des (pseudo-) Bernhard von Clairvaux auf das Paradiesgärtlein (1612) hatten. Arndt fügte zu Luthers Verständnis des Glaubens die bernhardinische Frömmigkeit und Mystik hinzu, während Augustinus bei ihm zur Autorität der Rechtgläubigkeit gehörte. Durch die Rezeption der spätmittelalterlichen und bernhardinischen Quellen kam Arndt zum lebendigen Glauben und schuf ein Gebetbuch voller Widersprüche, in dem das Solus Christus, sola gratia et sola scriptura der Reformation ebenso aufgenommen ist wie die mystische praesentia Dei et Christi in der Seele der Glaubenden. Park illustriert diese Gegensätze, die dennoch eine gemeinsame Mitte haben, nämlich die Betrachtung des Gekreuzigten: »Jch sehe an mit gleubigen Augen den gecreutzigten Jesum«. Leseprobe |
 |
Jan Schubert Willem Adolph Visser ’t Hooft (1900–1985) Ökumene und Europa Vandenhoeck & Ruprecht, 2017, 263 Seiten, gebunden, 978-3-525-10151-3 79,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 243 Der ökumenische Protestantismus als Akteur im Diskurs eines vereinten Europas.Die Idee der europäischen Einheit hat im protestantischen Denken keine lange Tradition. Über Jahrhunderte war der Protestantismus aufs engste mit der Staats- und Nationenwerdung in Europa verbunden gewesen, weshalb er lange Zeit für europäische Vielfalt und Disparatheit, nicht aber für eine wie auch immer geartete Einheit stand. Erst ab Ende der 1930er Jahre ist das Entstehen eines protestantischen Europadiskurses zu beobachten - und zwar innerhalb der internationalen ökumenischen Bewegung. Dort, wo die Einheit der Kirchen über die nationalen Grenzen hinweg angestrebt wurde, ließ der drohende Krieg zwischen eben jenen Nationen ein europäisches Bewusstsein entstehen, und führende Vertreter der Ökumene begannen, sich in die allgemeine Diskussion über die Zukunft Europas einzuschalten. Von zentraler Bedeutung war dabei der niederländische Theologe Willem Adolph Visser 't Hooft, der den ökumenischen Protestantismus im 20. Jahrhundert wie kein Zweiter prägte. In der vorliegenden Studie untersucht Jan Schubert, wie sich seine Wahrnehmung Europas als einer politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Einheit von den 1920er bis zu den 1960er Jahren entwickelte. Dabei vollzieht die Studie nach, welche Personen, Gruppierungen sowie welche geistigen, ideellen und theologischen Strömungen ihn bei seiner Meinungsbildung bezüglich ""Europa"" beeinflusst haben. Auf diese Weise eröffnet sie einen exemplarischen Einblick in die Entstehungsphase des protestantischen Europadiskurses, der in der historischen Forschung bislang weitgehend vernachlässigt wurde. |
 |
Patrizio Foresta Wie ein Apostel Deutschlands Apostolat, Obrigkeit und jesuitisches Selbstverständnis am Beispiel des Petrus Canisius (1543–1570) Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, 528 Seiten, gebunden, 978-3-525-10100-1 120,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 239 Nach dem Auftreten der Reformation und besonders nach der Verhärtung der konfessionellen Fronten im Anschluss an den Augsburger Reichstag 1555 wurden die Territorien des Alten Reichs in den Augen vieler Zeitgenossen das Haupteinsatzfeld der so genannten katholischen Reform und Gegenreformation bzw. des frühneuzeitlichen Katholizismus. Dies galt auch für diejenigen Jesuiten, die bereits ab 1540-1541 in Deutschland eingesetzt worden waren. Ihnen trat eine Situation entgegen, die wegen der extremen Vielfalt der religiösen, politischen und sozialen Gegebenheiten sehr schwer zu bewältigen war und worauf sie anfangs unvorbereitet waren. Das war der Hauptgrund, weswegen sie ein möglichst breites Spektrum an Strategien entwickeln mussten, welche die vor ihnen stehenden religionspolitischen Fragen hätten lösen können. Die Jesuiten erkannten in der Erfüllung ihrer Aufgaben den apostolischen, i. e. den heilsgeschichtlichen und zugleich seelsorglichen Charakter ihrer Societas Jesu. Er wurde in der Natur und Berufung des Ordens in dem Maße gesehen, wie sich die Patres selbst als »Apostel« wahrnahmen. In diesem Zusammenhang wird das Selbst- und Apostolatsverständnis des Jesuiten Petrus Canisius (1521-1597) und derjenigen Patres (unter anderen Jerónimo Claude Jay, Pierre Favre, Alfonso Salmerón, Nicolas Bobadilla, Paul Hoffaeus), die als erste nach Deutschland gesandt wurden, dort tätig waren und die Anfangsjahre der deutschen Ordensprovinzen prägten, unter besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zur Obrigkeit untersucht. Inhaltsverzeichnis und Leseprobe |
 |
Jan Martin Lies Wahrheit – Geschwindigkeit – Pluralität Chancen und Herausforderungen durch den Buchdruck im Zeitalter der Reformation Vandenhoeck & Ruprecht, 2021, 368 Seiten, gebunden, 978-3-525-56037-2 120,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 132 Bewegung durch Beweglichkeit – eine Gesellschaft im buchstäblichen WandelNeue Techniken zur Informationsübermittlung befördern den Informationsaustausch. Das ist eine für das 20. und 21. Jahrhundert ganz selbstverständliche Feststellung. Genauso selbstverständlich gilt sie aber auch für das 16. Jahrhundert und die Frühe Neuzeit insgesamt. Ein allseits bekanntes Beispiel dafür ist die Verbesserung der Techniken des Buchdrucks durch die Verwendung beweglicher Lettern [zur Seite Johannes Gutenberg]. Dies führte dazu, dass neue Medien entstanden und sich dauerhaft etablierten, wie z.B. die Flugschrift und die „Neue Zeitung“. Andere bereits bekannte Genera wie Lieder und Predigten erhielten durch die veränderte Kommunikationssituation eine neue Bedeutung in den Auseinandersetzungen der Zeit. Daraus ergaben sich vielfältige Chancen und Herausforderungen, denn die Nutzung dieser neuen Medien wie die Transformation bestehender Medienformate und deren flächendeckende Verwendung setzte politische, soziale, juristische und religiöse Veränderungsprozesse in Gang bzw. beförderte sie. Die Beiträge des Sammelbandes möchten diese neuen Kommunikationsformen und -methoden ebenso wie die Veränderungsprozesse für das 16. Jahrhundert ausleuchten. Dies geschieht, indem Wandlungs- und Transformationsprozesse durch die Nutzung bekannter sowie die Schaffung neuer Medienformate, der Umgang mit Meinungsvielfalt und der damit einhergehenden Pluralität an Deutungen des Zeitgeschehens sowie die Entstehung einer neuen Streitkultur und neue Ordnungsversuche analysiert werden. Blick ins Buch |
 |
Eveline G. Bouwers Glaubenskämpfe Katholiken und Gewalt im 19. Jahrhundert Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, 359 Seiten, gebunden, 978-3-525-10158-2 85,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 130 Seit Anfang der 2000er ist eine Zunahme von Studien zur »religiösen Gewalt« zu konstatieren, und das trotz Polemiken über ihr Wesen. Ist Gewalt »im Namen Gottes« eine Reaktion auf die Säkularisierung moderner Gesellschaften, eine Form politischer Gewalt oder eine Erfindung, mit der die Repression religiöser Gruppen legitimiert werden kann? »Glaubenskämpfe« ergänzt diese sozialwissenschaftlich geprägte Literatur um eine überfällige historische Perspektive, indem erstmals ein umfassender Überblick auf das sich wandelnde Verhältnis von Glaube und Gewalt zwischen der Französischen Revolution und dem Ersten Weltkrieg geboten wird. Die einzelnen Kapitel untersuchen physische Gewalthandlungen im Zusammenhang innerkatholischer, katholisch-säkularer und interreligiöser Konflikte, und belegen dabei auch die Bedeutung von Rhetorik und Symbolik in der Anstachelung zu und Rechtfertigung von Gewalt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle der »Agency«. Das Buch erhellt demnach sowohl die Motive von Gewalt als auch deren Rechtfertigung und Deutung. Ferner wird geschildert, wie verschlungen religiöse und säkulare Differenzen mitunter waren. Indem es aufzeigt, wie Religion auch jenseits der Französischen Revolution Gewalt auszulösen vermochte, zeichnet Glaubenskämpfe ein weitaus komplexeres Bild des Verhältnisses von Glaube und Gewalt, als die Forschung bislang vermuten ließ. |
 |
Daniel Gehrt Bekennen und Bekenntnis im Kontext der Wittenberger Reformation Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, 313 Seiten, gebunden, 978-3-525-57095-1 85,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 128 Bekenntnistexte im Luthertum: Zwischen Normativität, Theoriegrundlage und politischer Bedeutunglt;p>Von den drei großen Konfessionen entwickelte nur das Luthertum verbindliche Bekenntnisse, die die Lehre normativ formulierten. Oft wurde der große Rang, der dem Bekennen im Luthertum zukam, in der wissenschaftlichen Literatur mit einem besonderen Drang zur Lehrnormierung verbunden. Dieser Befund gab Anlass zu einem Arbeitsgespräch, das Oktober 2015 in der Forschungsbibliothek Gotha stattfand. Der vorliegende Aufsatzband vereint die meisten dort gehaltenen Beiträge. In der »Blütezeit der Bekenntnisproduktion« (Wolf Dieter Hauschild) zwischen 1549 und 1580 entstanden zahlreiche Bekenntnistexte mit äußerst vielfältigen Funktionen. Es ging nicht einfach nur darum, seinen Glauben zu bekennen, sondern es mussten oft auch religions- oder bündnispolitische Aspekte beim Abfassen und Durchsetzen eines Bekenntnisses beachtet werden. Für das frühneuzeitliche Luthertum hatten die Bekenntnisse, die im Konkordienbuch von 1580 versammelt waren, zumindest der Theorie nach den Rang einer norma normata. Ihre Bedeutung leitete sich von der Heiligen Schrift ab und bestimmte zugleich als Rahmen die theologische Lehrbildung. Im Zuge der Aufklärung veränderte sich dieses Bild jedoch drastisch. Die Geltung der lutherischen Bekenntnisse war im 19. Jahrhundert nicht mehr selbstverständlich. In der theologischen Reaktion auf die aufklärerische Dogmenkritik traten die Bekenntnisschriften oft als neue Lehrgesetze wieder in Geltung. Inhaltsverzeichnis |
 |
Irene Dingel Matthias Flacius Illyricus Biographische Kontexte, theologische Wirkungen, historische Rezeption Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, 378 Seiten, Hardcover, 978-3-525-57094-4 100,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 125 Im Ringen um theologische Wahrheit und Polemik: Ein Blick auf Matthias Flacius jenseits der Klischees Die in diesem Band versammelten Beiträge nehmen den in Labin (Kroatien) geborenen Matthias Flacius Illyricus unter vier Schwerpunkten in den Blick. Der erste widmet sich Flacius als »Wanderer zwischen den Welten«, der sich in verschiedenen städtischen und territorialen, politischen und konfessionellen Zusammenhängen zu behaupten hatte. Im Zentrum steht die Frage danach, welchen Einfluss die jeweiligen kulturellen und sozialen Kontexte auf seine geistige und theologische Entwicklung ausübten, welche Exilserfahrung er machte und wie sich dies auf seine Einstellung zu Heimat und Heimatlosigkeit auswirkte. Der zweite Schwerpunkt beleuchtet Flacius als »Kämpfer für die Wahrheit«. Die Beiträge versuchen, sein Ringen um die theologische »Wahrheit« als Strukturelement seines Denkens herauszuarbeiten. Dies konnte durchaus konfessionell übergreifende Relevanz erhalten, wie sie sich zum Beispiel in Flacius' großen historischen und hermeneutischen Werken zeigt. Dabei wird deutlich, dass man Flacius nicht auf den Streittheologen und stets polarisierenden Gelehrten des strengen Luthertums reduzieren kann. Vielmehr rückt in den Vordergrund, wie Flacius' Eintreten für die »Wahrheit« zugleich ein leitendes Element für sein Geschichtsverständnis und die Art seiner Geschichtsschreibung wurde, für das Konzept der Zeugenschaft und für eine spezifische Hermeneutik. Der dritte Schwerpunkt widmet sich Flacius in seinen Netzwerken. Hier werden bisher kaum beachtete Korrespondenzen mit anderen Gelehrten betrachtet. Es geht um die Kontakte des Flacius in die Schweiz und nach Italien, sowie um die Gelehrtenkorrespondenzen nach Polen und Ostpreußen als Beispiele aus einem viel breiteren europäischen Korrespondenznetzwerk. Der vierte Zugang hat die Rezeption und von Flacius ausgehende gruppenbildende Wirkungen zum Gegenstand. Dabei rückt Österreich als Ort von Asyl und Exil in den Blick, an den sich die Flacianer, das heißt die Anhänger und engagierten Verfechter des Erbsündenverständnisses des Flacius, nach zahlreichen Ausweisungen aus dem Reich zurückzogen. Aber auch das Erbe der Flacianer in anderen europäischen Räumen mit Schwerpunkt Slowenien und Kroatien ist zu beachten. Ob es zu der Ausprägung eines »Flacianismus« im Sinne einer »Konfession« mit Bekenntnischarakter und konfessionsspezifischen Elementen kam, wird ebenso diskutiert wie die Flacius-Biographik des 19. Jahrhunderts. Open Access pdf 978-3-666-57094-0 |
 |
Irene Dingel / Christiane Tietz Säkularisierung und Religion Europäische Wechselwirkungen Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, 220 Seiten, gebunden, 978-3-525-57093-7 65,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 123 Säkularisierung – was heißt das? Annäherungen aus der Geschichte und SystematikIn den vergangenen Jahren ist das Thema "Säkularisierung" zu einem beliebten Forschungsparadigma geworden. Geschichtliche Prozesse und gegenwärtige Phänomene werden unter der Perspektive von "Säkularisierung" beschrieben und gewinnen so ein besonderes Profil. Was aber steckt hinter der Begrifflichkeit und mit welchen Theorien und Theorieentwicklungen sind wir konfrontiert? Die Beiträge dieses Bandes versuchen dies zu klären und sowohl historische als auch gegenwartsbezogene Zugänge zu entwickeln. Dabei geht es um Säkularisierungsschübe und deren Auslöser in der Geschichte; um die Frage danach, wie Religion und religiöse Praxis in jeweils unterschiedlicher Weise auf Säkularisierungsphänomene reagierten. Denn Tatsache ist, dass die Religion - in welcher Ausprägung auch immer - nie ganz verdrängt wurde. Auch die Auswirkungen von Säkularisierung und Säkularisierungsschüben auf die gelebte Religion werden thematisiert, ebenso wie mögliche gesellschaftliche und politische Auswirkungen. Kam es zu einer Verdrängung der Religion aus der Öffentlichkeit oder zu einer Selbstbehauptung der Religion gegen säkularisierende Tendenzen? Um dies zu beleuchten werden verschiedene geographische und religiöse Räume abgeschritten, wobei auch geschichtliche Entwicklungen aufgezeigt werden sollen, um den Blick auf Säkularisierungen in der Gegenwart zu schärfen. Blick ins Buch |
 |
Irene Dingel / Volker Leppin /
Kathrin Paasch Zwischen theologischem Dissens und politischer Duldung Religionsgespräche der Frühen Neuzeit Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, 328 Seiten, gebunden, 978-3-525-57087-6 89,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 121 Im 16. und 17. Jahrhundert entwickelte sich das aus dem Mittelalter bekannte Religionsgespräch zu einem weltlichen religions- und konfessionspolitischen Steuerungsinstrument, mit dem die innerchristlichen, konfessionellen Differenzen im Gefolge der Reformation entschieden oder wenigstens ausgeglichen werden sollten. Dieser Band widmet sich solchen Religionsgesprächen, in denen sich die gelehrte Auseinandersetzung der Theologen mit dem politischen Lösungswillen der Obrigkeiten verschränkte. Die hier verfolgte europäische Untersuchungsperspektive ermöglicht eine zugleich auch konfessionell vielfältige Bestandsaufnahme. Die Beiträge arbeiten das Exemplarische in den vielen unterschiedlichen Zusammenhängen der Religionsgespräche heraus, um so das zwar kurzlebige, in seinen Wirkungen aber gar nicht hoch genug einzuschätzende Phänomen des „Religionsgesprächs“ zu erfassen. Sie schildern Geschichte und Ablauf des jeweiligen Kolloquiums, behandeln Akteure, Abläufe und Wirkungen und analysieren zugleich Konstanten und Strukturen. Leseprobe |
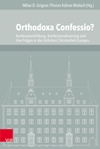 |
Mihai-D. Grigore Orthodoxa Confessio? Konfessionsbildung, Konfessionalisierung und ihre Folgen in der östlichen Christenheit Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, 360 Seiten, gebunden 978-3-525-57078-4 95,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 114 Der Sammelband füllt eine Forschungslücke der europäischen Konfessionsgeschichte, indem es die Anwendbarkeit und Erweiterung der ,klassischen' Paradigmen der Konfessionsbildung, Konfessionalisierung und Konfessionskultur auf die orthodoxen Traditionen des östlichen und südöstlichen Europas vorschlägt. Die Beiträge des Bandes zielen darauf ab, sich mit einer bislang nicht nachweisbaren Schärfe mit Konfessionalität und Konfessionalisierung im Bereich der östlichen Christenheit auseinanderzusetzen. Der Sammelband stellt damit einen unerlässlichen Schritt dar, um von »interkonfessioneller Dynamik« im Bereich der ost- und südosteuropäischen Christenheit qualifiziert sprechen zu können und somit die gesamte Konfessionsgeschichte Europa mit neuen Perspektiven zu erweitern. PD Dr. Mihai-D. Grigore ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz. Dr. Florian Kührer-Wielach ist Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München. Interessenten: Theologinnen, Historiker, Forscherinnen zur Kultur und Geschichte Ost- und Südosteuropas. |
 |
Irene Dingel Calvin und Calvinismus Europäische Perspektiven Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, 526 Seiten, gebunden, 978-3-525-10106-3 140,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 84 Die von Irene Dingel und Herman Selderhuis versammelten Beiträge widmen sich der europäischen Ausstrahlung des Genfer Reformators Johannes Calvin und den weitgreifenden Wirkungen des Calvinismus. Dabei kommt der Calvinismus als ein länderübergreifendes konfessionelles System in den Blick, dessen Gestaltungskräfte sich sowohl in theologischer als auch in gesellschaftlicher, politischer und kultureller Hinsicht äußerten, mit bestehenden Systemen in Interaktion traten und so wesentlich zur Ausprägung des modernen Europa beitrugen. In drei thematischen Schwerpunkten kommen zunächst die Person Calvins und ihre Einflüsse in West- und Osteuropa zur Sprache, sodann die durch Vertreibung, Exil und Neuaufbau geprägte Wirklichkeit des frühneuzeitlichen Calvinismus und schließlich die in einer spezifischen Spiritualität und deren »Medien« Gestalt gewinnende geistige Kraft des Calvinismus. Der Band greift die verschiedenen aktuellen Forschungsdiskurse auf, führt sie unter der Perspektive der europäischen Wirkmächtigkeit des Calvinismus zusammen und eröffnet durch seine Interdisziplinarität und Internationalität zugleich neue Blickwinkel, um auf diese Weise impulsgebend auf die Forschung zu wirken. |
 |
Irene Dingel / Christiane Tietz Das Friedenspotenzial von Religion Vandenhoeck & Ruprecht, 2009, 285 Seiten, gebunden, 978-3-525-10091-2 49,00 EUR |
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Band 78 Neues aus der Friedensforschung.In den letzten Jahren hat sich das öffentliche und wissenschaftliche Interesse am Gewalt- und Konfliktpotenzial von Religion verdichtet. Angesichts der politischen Ereignisse der letzten Jahre scheint es ausgemacht, dass religiöse Überzeugungen Konflikte fördern und Gewalt nach sich ziehen. Gründlichere Analysen zeigen jedoch, dass Religion für sich genommen nur selten selber den Ausbruch von machtpolitisch oder ökonomisch ausgetragenen Konflikten bewirkt. Wohl aber kann sie vorhandene ökonomische und machtpolitische Gegnerschaften verstärken.Dass Religion auch friedensfördernd zu sein vermag, ist in jüngerer Zeit deutlich weniger in den Blick genommen worden. Die Beiträge dieses Bandes widmen sich diesem vernachlässigten Thema, indem sie nach jenen Elementen von Religion fragen, die als friedensfördernd angesehen werden können und dazu geeignet sind, entsprechende Potenziale freizusetzen. Dies geschieht aus der Perspektive von Geschichts-, Politik-, Islam und Religionswissenschaft sowie Theologie und im Hinblick auf verschiedene, in Europa präsente Religionen. Religionskritisch werden gleichzeitig die gewaltfördernden Aspekte von Religion mit reflektiert.Mit Beiträgen von Andreas Hasenclever, Alexander de Juan, Armin Kohnle, Irfan A. Omar, Peter Steinacker, Klaus von Stosch und Christiane Tietz. Blick ins Buch |