| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Veröffentlichungen im Auftrag der Vereinigten Evangelisc-Lutherischen-Kirche Deutschlands VELKD | ||
| siehe auch EKD Denkschriften | ||
 |
Christine Constanza Familie in Kirche und Theologie Neue Perspektiven Evangelisches Verlagshaus, 2025, 252 Seiten, Paperback, 978-3-374-07913-1 25,00 EUR |
Veröffentlichungen i.A. der VELKD In der Gegenwart gibt es Familie in verschiedenen Lebensformen, Praxiskonstellationen und Idealbildern. Ebenso vielfältig sind die theologischen Reflexionsmodelle und normativen Theoriefiguren zum Thema »Familie«. Dennoch taucht dieses Thema in den theologischen Debatten um Sexualität, Ehe für alle, Genderfragen u.a. unerwartet selten auf. Auf der Tagung wurden Bezüge zum Thema "Familie" in den verschiedenen Disziplinen der Theologie sondiert, Entwicklungslinien und gegenwärtige Debatten rekonstruiert, unterschiedliche Facetten des weiten Spektrums »evangelisch« perspektiviert, Ambivalenzen diskutiert sowie die Kontexte und Aufgaben heutiger Positionierung bedacht. Das Format der Tagung ermöglichte v.a. theologischen Nachwuchskräften in der Qualifikationsphase, ihre Forschungsansätze und -ergebnisse vorzustellen. Der Tagungsband versammelt neben exegetischen Befunden und queertheologischen Analysen, dogmatischen und ethischen Reflexionen auch Beiträge zur religionswissenschaftlich-filmanalytischen sowie kirchenbezogen-soziologischen Forschung. Mit Beiträgen von Anna Hepting, Katharina Luise Merkert, Matthias Schnurrenberger, Charlotte von Ulmenstein, Johannes U. Beck, Adrian Marschner, Sonja Thomaier, Wolfgang-Michael Klein, Elisabeth Woehlke, Johanna Possinger und Sarah Jäger. |
 |
Christine Axt-Piscalar Neue Verantwortung für lutherische Friedensethik Dokumentation der Fachtagung der VELKD am 26./27. April 2024 Evangelisches Verlagshaus, 2025, 252 Seiten, Paperback, 978-3-374-07915-5 25,00 EUR |
Veröffentlichungen i.A. der VELKD Im Auftrag der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche (VELKD) herausgegeben von Christine Axt-Piscalar und Andreas Ohlemacher Bis zur "Friedenssynode der EKD" 2019 in Dresden überwog in den Kirchen wie auch in der Gesellschaft ein friedensethischer Optimismus, auf dem Weg zu einer friedlichen Welt zu sein. Die akuten Krisenherde in der Welt und allem voran der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine haben diesen Optimismus gebrochen. Eine Überprüfung der friedensethischen Parameter erscheint nötig. Die EKD hat den Prozess der Erarbeitung eines erneuerten Grundlagentexts zur Friedensethik angestoßen. An diesem Diskurs ist die Vereinigte Evangelisch-lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) beteiligt. Der Band versammelt Beiträge, die auf einer von der VELKD beauftragten Fachtagung 2024 gehalten wurden. Sie bringen theologische Anliegen in den friedensethischen Diskurs ein, die in den zurückliegenden Debatten eher in den Hintergrund getreten waren. Mit Beiträgen von Sarah Jäger, Friedrich Lohmann, Susanne Luther, Roger Mielke, Reinhard Müller, Notger Slenczka, Friederike Spengler, Volker Stümke, Arnulf von Scheliha, ergänzt um einen Aufsatz von Renate Penßel und Rochus Leonhardt zum gegenwartsorientierten Verständnis von CA XVI. |
 |
Christine Axt-Piscalar Bekenntnis – Bezeugung des Evangeliums Zum Verständnis von Bekennen und Bekenntnis in Lehre und Leben der Kirche Evangelisches Verlagshaus, 2025, 120 Seiten, Paperback, 978-3-374-07789-2 18,00 EUR |
Veröffentlichungen i.A. der VELKD Im Auftrag der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche (VELKD) herausgegeben von Christine Axt-Piscalar und Andreas Ohlemacher Was meinen wir, wenn wir von »Bekenntnis« sprechen? Und inwiefern kommt dem Bekenntnis eine zentrale Rolle für Lehre, Leben und Recht der Kirchen, bei der Berufung in kirchliche und schulische Ämter und Berufe sowie in die Verantwortung als Synodale zu? Welche Bedeutung haben das Bekennen und das kirchliche Bekenntnis für den Glaubensvollzug des Einzelnen? Welche Funktion hat das Bekenntnis - und für die Außenwahrnehmung der Kirche in Staat und Politik? Der Theologische Ausschuss der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) hat eine konzentrierte Handreichung zur Bedeutung des Bekenntnisses erarbeitet. Anlehnend Angelehnt an die Frage-Antwort-Struktur von Luthers Kleinem Katechismus und dem Heidelberger Katechismus wird entfaltet sich ein vielfältiger Katalog an exegetischen, kirchengeschichtlichen, systematisch-theologischen, konfessionsbestimmten, rechtlichen und praktisch-theologischen Fragen aufgemacht und jeweils beantwortetAntworten. Dabei zeigt sich in der Unterschiedlichkeit der Perspektiven: Das Bekennen und die verschiedenen Bekenntnisse dienen der Bezeugung des Evangeliums. Darin liegt ihre Bedeutung für Lehre und Leben der Kirche, die zu reflektieren immer wieder aufs Neue den Christenmenschen als Aufgabe gestellt ist. |
 |
Christine Axt-Piscalar Um des Evangeliums willen Gesetz und Evangelium, Glaube und Werke, Alter und Neuer Bund, Verheißung und Erfüllung. Eine Handreichung für Predigerinnen und Prediger Evangelisches Verlagshaus, 2021, 84 Seiten, Broschur, 978-3-374-06903-3 9,80 EUR |
Veröffentlichungen i.A. der VELKD Im Auftrag der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche (VELKD) herausgegeben von Christine Axt-Piscalar und Andreas Ohlemacher Jede Woche stehen Predigerinnen und Prediger vor der Aufgabe, die biblischen Texte in ihrer Vielfalt zu erschließen. Als ein innerbiblischer Schlüssel zum Verständnis dieser Texte haben die so genannten Duale Gesetz und Evangelium, Glaube und gute Werke, Alter und Neuer Bund, Verheißung und Erfüllung in der evangelisch-lutherischen Kirche eine lange Tradition als Hilfe für den Zugang zum Verstehen der Bibel. Sie können jedoch missverstanden und insbesondere gegen jüdische Theologie gewendet werden. Die Handreichung geht mit dieser Gefahr bewusst und offen um, indem sie beschreibt, wie die jeweiligen Duale zu verstehen sind – und damit auch, wie sie nicht zu verstehen sind und nicht verstanden werden dürfen. Sie beschreibt die unterschiedlichen theologischen Hintergründe der Duale und erhellt ihre jeweilige existenzerschließende Kraft für die Gegenwart und Zukunft. Die Duale werden so in ihrer Bedeutung für eine lebendige Predigtkultur erschlossen, die theologisches und existenzielles Verstehen der Bibel und ihre gegenwartsorientierte Auslegung miteinander verbindet |
 |
Christine Axt-Piscalar Die lutherischen Duale Gesetz und Evangelium, Glaube und Werke, Alter und Neuer Bund, Verheißung und Erfüllung Evangelisches Verlagshaus, 2021, 256 Seiten, Broschur, 978-3-374-06880-7 22,00 EUR |
Veröffentlichungen i.A. der VELKD Im Auftrag der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche (VELKD) herausgegeben von Christine Axt-Piscalar und Andreas Ohlemacher Im Auftrag der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche (VELKD) herausgegeben von Christine Axt-Piscalar und Andreas Ohlemacher Die lutherischen Duale »Gesetz und Evangelium«, »Glaube und gute Werke«, »Alter und Neuer Bund«, »Verheißung und Erfüllung« haben eine ambivalente Geschichte: Sie dienten lutherischer Theologie, Frömmigkeit und insbesondere der Predigtkultur über fast fünf Jahrhunderte als Schlüssel zum Verstehen der Vielfalt biblischer Texte. Sie wurden jedoch häufig auch dazu verwendet, die jüdische Religion als defizitär darzustellen oder herabzuwürdigen. Die Bischofskonferenz hat darum dem Theologischen Ausschuss der VELKD den Auftrag gegeben, die Verwendung der »Duale« zu prüfen. In diesem Rahmen sind die vorliegenden Untersuchungen aus verschiedenen Fachdisziplinen zum jeweiligen Verständnis der Duale entstanden. Der Band diskutiert erhellend die theologische und existenzerschließende Bedeutung und gegenwartsorientierte Wahrnehmung der Duale, aber ebenso ihre notwendige kritische Reflexion vor dem Hintergrund des jüdisch-christlichen Dialogs. |
 |
Notger Slenczka Verstandenes verstehen Luther- und Reformationsdeutungen in Vergangenheit und Gegenwart Evangelisches Verlagshaus, 2018, 240 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-05615-6 18,00 EUR |
Veröffentlichungen i.A. der VELKD Was unter Luther, lutherischer Theologie und Reformation verstanden wird, versteht sich nicht von selbst. Ihre Deutung ist immer von gegenwärtigen Fragestellungen und Perspektiven geleitet. Sie springt mit ihrem Erkenntnisinteresse nicht direkt ins 16. Jahrhundert zurück. Vielmehr kann sie auf Deutungstraditionen zurückgreifen, die das eigene Problembewusstsein schärfen. Ein Verstehen von Luther und der Reformation bedeutet also immer auch ein Verstehen von etwas schon Verstandenem, eine Hermeneutik von Luther- und Reformationsrezeptionen. Die in diesem Band versammelten Aufsätze rekonstruieren in theologiegeschichtlicher, ökumenischer, soziologischer und homiletischer Hinsicht bedeutende Deutungen der Person Luthers und der Reformation in Hinblick auf ihre jeweils erkenntnisleitende Hermeneutik. Damit leistet dieser Band einen Beitrag zum gegenwärtigen Verständnis der Reformation und einer lutherischen Theologie. |
 |
Moral ohne Bekenntnis? Zur Debatte um Kirche als zivilreligiöse Moralagentur. Dokumentation der XVII. Konsultation Kirchenleitung und wissenschaftliche Theologie Evangelisches Verlagshaus, 2017, 128 Seiten, Paperback, 978-3-374-05158-8 15,00 EUR |
Veröffentlichungen i.A. der VELKD Im gesellschaftlichen Diskurs und in der medialen Wahrnehmung kommen Kirche und Theologie vornehmlich dann vor, wenn es um die moralischen Grundlagen des Zusammenlebens geht. Sie melden sich in öffentlichen Stellungnahmen, durch Sozialworte oder mit Denkschriften zu Wort. Aktuelle Beispiele sind die Debatten um die Flüchtlingskrise, die Sterbehilfe, die Sexualethik, den Klimawandel, den Finanzkapitalismus. Gegenüber dieser Tendenz sollten Kirche und Theologie weniger Verhaltensnormierungen anstreben als vielmehr die Fähigkeit zur eigenen Urteilsbildung in ethischen Fragen stärken. Es ist ein Selbstmissverständnis, wenn die Kirchen sich als Moralagenturen verstehen. Die Beiträge in diesem Band wollen Antworten u. a. auf folgende Fragen geben: Wie steht der Wahrheitsanspruch des Evangeliums zur Vermittlung von Werten in und für diese Gesellschaft? Sind Kirche und Theologie verführt, den Relevanzverlust des Glaubens in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit auf ethischem Gebiet auszugleichen? Laufen sie Gefahr, sich im Kampf um die knappe Ressource Aufmerksamkeit selbst zu säkularisieren und die christliche Botschaft zu nivellieren? Mit Beiträgen von Corinna Dahlgrün, Johannes Fischer, Elisabeth Gräb-Schmidt, Michael Meyer-Blanck, Matthias Kamann, Peter Schallenberg und Notger Slenczka. |
 |
Dimensionen christlicher Freiheit Beiträge zur Gegenwartsbedeutung der Theologie Luthers Evangelisches Verlagshaus, 2015, 228 Seiten, Paperback, 978-3-374-03931-9 19,80 EUR |
Veröffentlichungen i.A. der VELKD Im Auftrag der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) herausgegeben von Christine Axt-Piscalar und Mareile Lasogga Was hat es auf sich mit der christlichen Freiheit? Welche Erfahrungen von Freiheit eröffnet sie? Welche Erfahrungen von Unfreiheit hebt sie auf? Welche Bindung geht mit ihr einher? Die Beiträge des Bandes befragen jeweils eine zentrale Schrift Luthers auf das sie leitende Verständnis von Freiheit hin. Sie bringen Luthers Einsichten und das genuine Anliegen der Reformation ins Gespräch mit der Selbst- und Welterfahrung des modernen Menschen sowie den Anfragen zeitgenössischer Freiheits- bzw. Unfreiheitstheorien. Sie beleuchten, inwiefern das Evangelium als Grund menschlicher Freiheit in der Vielfalt ihrer Dimensionen – als innere Freiheit, Handlungsfreiheit und politische Freiheit – zu begreifen ist, und erschließen so die Gegenwartsrelevanz von Luthers Theologie der Freiheit eines Christenmenschen. Mit Beiträgen von Christine Axt-Piscalar, Uwe Becker, Mareile Lasogga, Rochus Leonhardt, Wolf-Friedrich Schäufele und Notger Slenczka. Leseprobe |
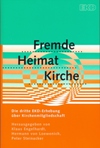 |
Klaus (Hg.) Engelhardt Fremde Heimat Kirche Die dritte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft Gütersloher Verlagshaus, 1997, 447 Seiten, kartoniert, 3-579-02363-2 978-3-579-02363-2 10,00 EUR |
Das vorliegende Buch enthält die ausführliche Darstellung der
dritten EKD-Erhebung zur Kirchenmitgliedschaft, von der erste Ergebnisse
schon 1993 unter dem Titel "Fremde Heimat Kirche" veröffentlicht wurde. Diese Befragung ist wieder von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau mitgetragen worden, die damit ihr besonderes Interesse bekunden, das kirchliche Handeln am Evangelium und an der soziologischen erfaßbaren Wirklichkeit zu orientieren. Teil 1: 1. Kirchenmitgliedschaft: Selbsterkundung der EKD 2. Die dritte Untersuchung 3. Erzählen über Religion: Werkstattbericht Teil 2: 1. Christsein im Lebenslauf: Biographie und gesellschaftlicher Wandel 2. Ordnungs- und Distanzbedürfnis: Zwei existentielle Perspektiven 3. Frauen in der Kirche 4. Kirche nach dem Sozialismus: Die Evangelischen in Ostdeutschland 5. Der Blick von außen: Die Konfessionslosen Teil 3: Perspektiven kirchlichen Handelns Teil 4: Anhang |
 |
Unsere Verantwortung für
den Sonntag EKD in Deutschland, 1988, 22 Seiten, geheftet, 2,60 EUR |
EKD Texte 22 Gemeinsame Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Taes der Evangelischen Kirche in Deutschland Anhang: Den Sonntag feiern Der Sonntag muß geschützt bleiben (siehe dazu: 2. Mose 20, 1-18, 10 Gebote, Dekalog, 2. Gebot) |
 |
Religiöse Bildung angesichts von Konfessionslosigkeit
Aufgaben und Chancen. Ein Grundlagentext der Kammer der EKD für Bildung und Erziehung, Kinder und Jugend Evangelisches Verlagshaus, 2020, 148 Seiten, Paperback, 978-3-374-06326-0 8,00 EUR |
Herausgegeben von der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) Religiöse Bildung für alle! Immer mehr Menschen gehören keiner christlichen Kirche mehr an, was zunehmend die Basis von Werte-, Erziehungs- und Bildungsübereinkünften erodieren lässt. Die Konfessionslosigkeit weiter Bevölkerungsteile stellt die evangelischen Kirchen sowie die Gesamtgesellschaft vor große Herausforderungen. Die Evangelische Kirche in Deutschland und ihre Gliedkirchen möchten in ihrer Bildungsarbeit auch diejenigen erreichen, für die christliche Religion nicht selbstverständlich ist. Darum werden mit diesem Text der EKD-Kammer für Bildung und Erziehung, Kinder und Jugend erstmals konfessionslose Menschen systematisch in den Mittelpunkt gestellt und Gründe sowie Hintergründe ihrer Konfessionslosigkeit analysiert. |
 |
Heinrich Bedford-Strohm Vernetzte Vielfalt Kirche angesichts von Individualisierung und Säkularisierung. Die fünfte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft. Mit CD-ROM Gütersloher Verlagshaus, 2015, 543 Seiten, Paperback, 15,0 x 22,7 cm 978-3-579-07437-5 15,00 EUR |
Der Auswertungsband der V. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD Die ersten veröffentlichten Ergebnisse der jüngsten EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft haben große Resonanz und vielfältige, z.T. kontroverse Reaktionen erfahren. Dieses Buch wird zur Vertiefung und Differenzierung der Diskussion beitragen. Es bietet die ausführliche Auswertung der Befragung zusammen mit einem Großteil des erhobenen Datenmaterials. Unverzichtbar für alle, die Leitungsverantwortung in der Evangelischen Kirche in Deutschland tragen. Daten und Erkenntnisse zur Wirklichkeit der Evangelischen Kirchen Orientierende Einsichten für kirchenleitendes Handeln heute Leseprobe |
 |
Kirchenkanzlei EKD Kirche und Frieden EKD Texte 3, Kundgebungen und Erklärungen aus den deutschen Kirchen und der Ökumene EKD Hannover, 1981, 248 Seiten, 310 g, Paperback, 8,00 EUR |
EKD Texte 3 Einleitung Die Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland »Frieden wahren, fördern und erneuem« verweist auf vier Initiativen im Raum der evangelischen Kirche, deren Texte nicht fürjedermaiin ohne weiteres greifbar sind. Dem abzuhelfen, ist der unmittelbare Anlaß dieser Sammlung von Texten zum Frieden. Überdies ist die Denkschrift ja eingebettet in einen breiten Strom kirchlicher Friedensdiskussion seit 1948, als die erste Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen proklamierte: »Krieg soll nach Gottes Willen nicht seiri«. An vielen Stellen verweist der Text der Denkschrift direkt oder indirekt auf diesen Zusammenhang. Nur zwei Dokumente konnten in ihren Anhang aufgenommen werden, nämlich die Heidelberger Thesen von 1959 und die Stellungnahrne der Deutschen Arbeitsgruppe CCIA zurBonner Konsultation über »Militarismus und Wettrüsten« vom September 1979. Frühere Denkschriften der EKD sind im Band I der Sammlung der Denkschriften der EKD »Fiieden, Versöhnung, Menschenrechte« wieder abgedruckt. Wichtige ältere kirchliche Verlautbarungen enthalt der von Christian Walther herausgegebene Sammelband »Atomwaffen und Ethik« Für die aktuellen Kundgebungen und Erklärungen aus den deutschen Kirchen und der Okumene besteht eine Lücke, die mit dieser Verö?entlichung geschlossen werden soll. Sie versammelt wichtige Stellungnahmen aus den evangelischen Kirchen in der Bundesrepublik und der DDR, grundlegende Dokumen te aus dem ökumenischen Gespräch und bezieht auch Texte aus der katholischen Kirche und unseren europäischen Nach barkirchen in l-Iolland und England mit ein. Begrenzt wird die Auswahl dadurch, daß nur Außeningen übergreifender kirchlicher Zusammenschlüsse und solche mit erkennbarer Bedeutung für die aktuelle Friedensdiskussion aufgenommen wurden. Stellungnahmen aus den einzelnen Landeskirchen wurden nicht berücksichtigt. Eine Abweich ung vom Prinzip, nur Texte mit kirchenleitender Autorität abzunicken, bilden die genaimten vier Stellungnahmen, die den Anlaß der Sainrnlung bildeten, das Wort der Konferenz Bekennender Gemeinschaften vom März 1982 sowie zwei Texte aus der katholischen Kirche, nämlich die Plattform der deutschen Pax Christi vom November 1980 und die Stellungnahme des Zentralkomitees der deutschen Katholiken vom November 1981. Mit der Veröffentlichung von »Kirche und Frieden« verbindet sich die Hoffnung, daß dieser ››Ergänzungsband« zusammen mit der Denkschrift »Frieden Wahren, fördem und emeuerri« das Gespräch in unseren Kirchen und Gemeinden vorantreiben und den Prozeß der Urteilsbildimg unterstützen möge. A Einleitung B Gemeinsame Erklärungen zum Frieden der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Bundes der Evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik 1. Der Bund der Evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik und die Evangelische Kirche in Deutschland zum 40. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges, August 1979 2. Arbeitsbericht über die Konsultationen des Bundes der Evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik und der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Friedensverantwortung der Kirchen in beiden deutschen Staaten, August 1982 C. Aus dem Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland 3. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland: Kundgebung zur Friedenssicherung Garmisch-Partenkirchen, Januar 1980 4. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland: Kundgebung zur Veröffentlichung der Denkschrift »Frieden wahren, fördern und erneuem« Fellbach, November 1981 5. Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland: Kommuniqué der Sitzung am 13./ 14. Februar 1981 6. Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland für Kirchlichen Entwicklungsdienst: Rüstung und Entwicklung - Ein Diskussionsbeitrag zur Problematik des Rüstungsexportes. September 1981 7. Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland: Entschließung »Zur Friedenssichenmg und Friedensförderung«. Augsburg, Juni 1980 8. Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland: Entschließung zu ››Beitrag der Kirchen und Christen zur Friedenssicherung<<, Wolfenbüttel, Oktober 1981 9. Moderamen des Reformierten Bundes: Diskussion um die Erhaltung des Friedens - Brief an die Gemeinden, Kirchen und Einzelmitglieder, Oktober 1981 10. Konferenz Bekennender Gemeinschaften: Wort zum Friedensauftrag der Gemeinde Jesu Christi, März 1982 11. Aktion »Ohne Rüstung leben«: Aufruf an alle Christen, 1978 12. Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste e.V.: Frieden schaffen ohne Waffen. Aufrufe zu den bundesweiten Friedenswochen 1980 und 1981 13. Arbeitskreis »Sicherung des Friedens«: Aufruf an die evangelischen Christen Juli 1980 14. Arbeitsgruppe »Schritte zur Abrüstung<<: Schritte zur Abrüstung - Welche Initiativen kann die Bundesrepublik Deutschland ergreifen und was können die Kirchen tun? Mai 1981 D. Aus dem Buiid der Evangelischen Kirchen in der DDR 15. Erklärung zur weltpolitischen Situation, Januar 1980 16. Rahmenkonzept »Erziehung zum Frieden«, September 1980 17. »Pazifismus<< in der aktuellen Friedensdiskussion - Arbeitsmaterialien für die Gemeinde, November 1981 18. Brief an die Gemeinden zur Abiüstungskonferenz der Vereinten Nationen 1982, Mai 1982 f E. Aus der Katholischen Kirche 19. Papst Paul VI.: Botschaft an die Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen, Juni 1978 20. Papst Johannes Paul II.: Botschaft vor dem Friedensdenkmal in Hiroshima, Februar 1981 21. Papst Johannes Paul II. : Botschaft an die Abrüsttmgskonferenz der Vereinten Nationen, Juni 1982 22. Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken: Stellungnahme »Zur aktuellen Friedensdiskussion<< November 1981 23. Delegiertenversammlung der deutschen Pax Christi: Abrüstung und Sicherheit- Plattform der Pax Christi, November 1980 F. Aus den ökumenischen Zusammenschlüssen 24. Erste Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen: Bericht der Vierten Sektion, Amsterdam 1948 25. Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft: Bericht der Dritten Sektion »Strukturen internationaler Zusammenarbeit - Friedliches Zusammenleben in einer pluralistischen Weltgemeinschaft« Genf 1966 26. Fünfte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen: Offizielle Erklärung »Die Weltrüstungssituation«, Nairobi 1975 27. Zentralausschuß des Ökumenischen Rates der Kirchen: Erklärung »Zunehmende Bedrohung des Friedens und die Aufgabe der Kirchen<< Dresden 1981 28. Ökumenischer Rat der Kirchen: Bericht des Öffentlichen Hearings über Atomwaffen und Abrüstung, Amsterdam 1981: »Bevor es zu spät ist«, Mai 1982 29. Exekutivkomitee des Lutherischen Weltbundes: Erklärung zum Frieden, Turku 1981 30. Achte Vollversammlung der Konferenz Europäischer Kirchen: Botschaft an die Christen in Europa, Kreta 1979 31. Vierte Nach-Helsinki-Konsultation der Konferenz Europäischer Kirchen: Bericht der Arbeitsgruppe I ››Vertrauensbildung, Entspannung und Abrüstung - Aufgaben, Wege und Methoden des Friedensauftrages heute« El Escorial 1980 G. Aus den europäischen Nachbarkirchen 32. Generalsynode der Niederländisch Reformierten Kirche: Brief an die Gemeinden November 1980 33. Britischer Kirchenrat: Auszüge aus den Entschließungen 1962 - 1981 H. Literaturverzeichnis |
 |
Die Menschenrechte im ökumenischen Gespräch
Beiträge der Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland für öffentliche Verantwortung Gütersloher Verlagshaus, 1979, 56 Seiten, 80 g, Kartoniert, 3-579-04876-7 2,60 EUR |
Ein Beitrag der Kmmer der Evangelischen Kirche in Deutschland für
öffentliche Verantwortung vom 26. September 1975, veröffentlicht in:
Denkschriften der EKD Bd 1/2, Frieden, Versöhnung und Menschenrechte,
Gütersloh 1978 Vorwort Das Fragen nach Sinn, Inhalt und Verwirklichung der Menschenrechte ist in den letzten Jahren zum Gemeingut der Christenheit geworden. Dafür gibt es mehrere gewichtige Gründe. In den Ländern der Dritten und Vierten Welt wächst die Erkenntnis, daß die Freiheitsrechte, die auf dem Boden Europas und Nordamerikas entstanden sind, jedenfalls insoweit allgemeine Gültigkeit besitzen könnten, als sie den einzelnen Menschen vor Tötung, vor Folter und willkürlicher Freiheitsberaubung schützen. In den sozialistisch regierten Staaten werden ähnliche Stimmen laut, nicht nur bei den sogenannten Dissidenten. Der Westen arbeitet, wenn auch von verschiedenen Ausgangspunkten aus und mit verschiedenen Zielrichtungen, an der Formulierung sozialer Grundrechte. Nicht zuletzt wird immer deutlicher, daß die Frage, inwieweit ein Gewaltmonopol des Staates hingenommen werden kann und muß, vor allem auch von der Einstellung des konkreten Staates zu den Menschenrechten abhängt. (Vgl. die Thesenreihe »Gewalt und Gewaltanwendung in der Gesellschaft<<, 1973, erarbeitet von der Kammer für öffentliche Verantwortung, vor allem Thesen 5 und 7). Im Auftrage des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland hat die Kammer für öffentliche Verantwortung daher den Menschenrechten einen großen Teil ihrer Arbeit gewidmet. Die vorliegende Veröffentlichung enthält zunächst die Thesenreihe »Die Menschenrechte im ökumenischen Gespräch« (1975), die in ihrer ursprüngli- chen Fassung schon der Ökumenischen Weltkonferenz 1974 in Nairobi vorgelegen hat und dort auf überraschend viel Interesse gestoßen ist. In der Folgezeit hat die Kammer paradigmatisch drei Einzelrechte erörtert: das Recht auf Arbeit, die Religionsfreiheit und die Meinungsfreiheit. Jedes dieser Menschenrechte wurde unter Heranziehung hervorragender Sachkenner behandelt, die wesentlichen Diskussionsergebnisse, aber auch die offengebliebenen Fragen wurden sodann von einzelnen Mitgliedern der Kammer in Protokollen zusammengefaßt. Diese drei Protokolle, die zwar den Stand der Beratungen in der Kammer, nicht aber etwa eine einstimmige Meinung aller Kammermitglieder wiedergeben und die insbesondere keine systematische Vollständigkeit anstreben, sind in der vorliegenden Schrift den Thesen von 1975 als Material beigegeben; mehr können und wollen sie nicht sein. Sie machen in ihrer unvermeidlichen Unvollständigkeit und Vorläufigkeit deutlich, daß die Menschenrechte stets gerade in jene Richtungen weiterentwickelt werden, aus denen ihnen besondere Gefährdungen erwachsen, und sie zeigen darüber hinaus, daß sie je nach der geistigen, politischen und gesellschaftlichen Umgebung, in der sie wirken, sehr unterschiedliche Gestalt annehmen können. Das Spannungsverhältnis zwischen dem universalen Geltungsanspruch der Menschenrechtsidee und ihrer konkreten Ausgestaltung in den verschiedenen Teilen der Welt beruht also nicht nur auf unterschiedlicher Beachtung und Verwirklichung, sondern ebenso auch auf unterschiedlichen kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Traditionen. Damit haben die Europäer und nicht zuletzt die europäischen Christen zu rechnen, wenn sie aufgrund ihrer eigenen geschichtlichen Erfahrung die Menschenrechte als Elemente einer künftigen, weltumspannenden Ordnung empfehlen. Professor D. Dr. Ludwig Raiser, ehemaliger Vorsitzender Professor Dr. Roman Herzog, Vorsitzender der Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland für öffentliche Verantwortung |
 |
Vom Geheimnis der Gemeinde Eine Handreichung von der Generalsynode. Angenommen von der Generalsynode der Niederländischen Reformierten Kirche auf ihrer Tagung am 18. Juni 1974 Gütersloher Verlagshaus, 1976, 64 Seiten, 80 g, geheftet, 3-579-03566-5 3,00 EUR |
Vorwort Es weiß, gottlob, ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören.« Martin Luther kam wegen dieses elementaren Erkenntnisstandes für seinen Abschnitt »Von der Kirche« in den Schmalkaldischen Artikeln mit vier Sätzen aus. Zu solch unbefangener und kurzgefaßter Feststellung wären wir heute kaum mehr berechtigt. Doch läßt sich gegenwärtig ein wachsendes Interesse an der Gemeinde Jesu Christi beobachten. Dies gilt besonders auch für die junge Generation. So hat sich die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend vorgenommen, das Verhältnis evangelischer jugendarbeit zur Gemeinde als lebendiger Realität wie zur Kirche insgesamt als Gemeinschaft des Glaubens, der handelnden Liebe, der Sakramente und der Hoifnung neu zum Schwerpunkt zu machen. Von der Schweiz ausgehend bilden sich auch im Bereich der EKD Initiativkreise, die unter der Losung ››Mut zur Gemeinde« Anregungen zur Gemeinschaftsbildung geben. Beispiele für dieses neue, sehr elementare Interesse an der Gemeinde ließen sich, auch aus dem Raum der katholischen Kirche, leicht vermehren. Da verwundert es nicht, daß auf einer kürzlichen Akademietagung über »Volkskirche -- Gemeindekirche« die Prognose: »Die Wiederentdeckung der Kirche als Gemeinde steht uns bevorl« erwartungsvolle Zustimmung fand. Wir freuen uns, mit der Schrift Vom Geheimnis der Gemeinde einen ökumenischen Beitrag zum Gemeindeverständnis zugänglich machen zu können, der sich vorzüglich für Gespräche und Beratungen in Gemeinden, Gemeindekirchenräten, Presbyterien und Hauskreisen, in Mitarbeiterkonventen und Dienstgruppen eignet. Es ist nicht das erste Mal, daß Ergebnisse der theologischen Arbeit unserer holländischen Nachbarkirche im deutschen Sprachraum veröffentlicht werden. Wir nennen vor allem die wichtigen »Fundamente und Perspektiven des Bekennens« von 1949, deutsch unter dem Titel »Lebendiges Bekenntnis« (1959); die Studie ››Israel und die Kirche« (1961), ››Kirche, Krieg und Frieden« (1965), »Rechenschaft über Geschichte, Geheimnis und Autorität der Bibel« (1968), Zur Predigt der Versöhnung, deutsch unter dem Titel ››Die Mauer ist abgebrochen« (1968). Wer sich in die beispielhaft gemeindebezogene und zugleich situationsbewußte theologische Arbeit der Niederländischen Reformierten Kirche vertiefen möchte, findet hier reiche Anregungen. Aus der theologischen Arbeit der EKD sind es vor allem der Studienbericht ››Schrift - Theologie - Verkündigung« (197-1), die Denkschrift »Aufgaben und Grenzen kirchlicher Äußerungen zu gesellschaftlichen Fragen« (1973) und die Studie »Christen und Juden« (1975), die sich mit Aussagen der vorliegenden Schrift inhaltlich berühren und zur Weiterführung anbieten. Die Schrift »Vom Geheimnis der Gemeinde« hat den Untertitel: Eine Handreichung zum Glaubensgespräch. Dieser Hinweis ist für die Niederländische Reformierte Kirche theologisch und praktisch gleich bedeutungsvoll. In seinem jüngst vorgelegten Umriß der Lehre von der Kirche hat der Theologe Berkhof neun institutionelle Mittel beschrieben, durch die die *Weitergabe des Glaubens und die Vermittlung des Heils geschehen und gefördert werden: die Unterweisung, die Taufe, die Predigt, das Gespräch, das Abendmahl, die Diakonie, die Versammlung der Gemeinde, das Amt und, als Hilfsinstrument, die Kirchenordnung. Berkhof räumt ein, daß das Gespräch als Gabe der Heilsvermittlung ekklesiologisch noch nicht voll anerkannt sei, weist aber mit Recht darauf hin, daß es in der Geschichte der Kirche und in der Erfahrung der Menschen eine sehr wirksame Rolle gespielt hat und immer wieder spielt. Viele Menschen verdanken den Anstoß zum Glauben und ihr Wachstum im Glauben persönlichen Gesprächen und Gesprächskreisen. Der Heilige Geist hat offenbar dieses gerade Menschen von heute ansprechende Instrument kräftig in seinen Dienst gestellt. Inhaltlich geht es darum, sich gegenseitig zu helfen, das Heil, das in den Worten der Bibel zu uns kommt, tiefer zu verstehen und zugleich miteinander zu klären, welche Haltung und Handlungsorientierung dem Heilsangebot angesichts der Sorgen, Versuchungen und Herausforderungen der Zeit entspricht. Die Form kann Vielfalt aufweisen: Bibelkreis, Studiengruppe, Gesprächsrunde; Hauptsache: beide Pole, Botschaft und Situation, bleiben aufeinander bezogen. So kann das Gespräch ein kraftvolles Mittel zur Ermutigung, Bereicherung und Korrektur sein; zumal in einer Zeit, in der es schwerer denn je erscheint, ohne die Hilfe der Gemeinschaft den Glauben zu bewahren (Berkhof). In diesem Sinne sei der vorliegenden Schrift eine gute und gesprächseröffnende Aufnahme in den Gemeinden unserer evangelischen Kirche gewünscht. Hannover, im Juli 1976 Walter Hammer Präsident der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland |
| Die Evangelische Kirche und
die Bildungsplanung Eine Dokumentation Gütersloher Verlagshaus, 1972, 128 Seiten, 150 g, kartoniert, 3-579-04555-5 2,00 EUR |
Pädagogische Forschungen Band 51 Unser gesamtes Bildungswesen befindet sich in der Bundesrepublik Deutschland in einem Prozeß tiefgreifender Umgestaltung. Er erfaßt alle Bildungseinrichtungen, ihren Aufbau und ihre Arbeitsweise ebenso wie die von ihnen vermittelten Bildungsgehalte. Sie alle sollen den Wertvorstellungen und Bedürfnissen unserer heutigen Gesellschaft angepaßt und in ihrer weiteren Entwicklung einem langfrístigen Plan unterworfen werden. Die Entscheidung darüber mit allen ihren organisatorischen und finanziellen Folgen gehört zµ den großen und dringlichen Aufgaben unseres politischen Gemeinwesens. Die evangelische Kirche ist von diesem Vorgang in doppelter Hinsicht betroffen. Einmal ist sie selbst Trägerin zahlreicher Bildungseinrichtungen vom Kindergarten über kirchliche Schulen aller Art bis zu den der Erwachsenenbildung dienenden Evangelischen Akademien und trägt nach geltendem Staatskirchenrecht eine Mitverantwortung für den an den öffentlichen Schulen zu erteilenden Religionsunterricht. Sodann aber ist sie über diesen, grob vereinfacht als kirchlichen Interessenbereich geltenden Ausschnitt unseres Bildungswesens hinaus nach ihrem volkskirchlichen Selbstverständnis aufgerufen, ihre Mitsorge und Mitverantwortung für Erziehung und Lebensweise der Menschen auch gegenüber dem Vorgang der Bildungsreform als Ganzem ratend, helfend oder kritisch warnend in der öffentlichen Diskussion geltend zu machen. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat sich für ihre Tagung vom 6. bis 12. November 1971 in Frankfurt die Aufgabe gestellt, nach diesen beiden Richtungen, wennschon unter dem Zwang thematischer Beschränkung, die Meinungen im kirchlichen Bereich abzuklären und das Ergebnis von Referaten, Plenardiskussionen und gründlich vorbereiteter Ausschußarbeit in mehreren, gemeinsam mit großer Mehrheit beschlossenen Resolutionen zu formulieren. Es ist kaum nötig zu sagen, daß diese Stellungnahmen nicht als verbindliche Lehraussagen Geltung beanspruchen; sie sollen die weitere Aussprache innerhalb und außerhalb der Kirche nicht abschließen und ersticken, sondern im Gegenteil kräftig beleben und in ihrer Grundhaltung den Fortgang der Bildungsreform nicht hemmen, sondern fördern. Diesem Zweck dient auch die hier vorgelegte Zusammenstellung der wichtigsten auf das Bildungsthema der Frankfurter Synodaltagung bezüglichen Dokumente, deren Ursprung und Zusammenhang sich aus der folgenden Einführung ergibt. Ich danke den beiden Herausgebern, die von Anfang an die Hauptlast der Vorbereitung dieses Themas der Synodaltagung getragen haben, und den Autoren der Beiträge, die als Referenten, Ausschußvorsitzende und Berichterstatter das Ergebnis der Beratungen wesentlich mitgeprägt haben. Tübingen, im Advent 1971 Ludwig Raiser, Professor D. Dr. jur., Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland |
|
 |
Christine Axt-Piscalar Christliche Existenz heute Evangelisches Verlagshaus, 2015, 228 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-04176-3 |
Veröffentlichungen i.A. der VELKD Zur Gegenwartsbedeutung der Theologie Sören Kierkegaards Im Auftrag der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) herausgegeben von Christine Axt-Piscalar und Mareile Lasogga Sören Kierkegaard nimmt die Existenz des Einzelnen vor Gott ebenso scharfsichtig wie tiefgründig in den Blick. Seine Analysen grundlegender Phänomene menschlicher und spezifisch christenmenschlicher Selbsterfahrung haben auch unter den Bedingungen der Spätmoderne nichts von ihrer Erschließungskraft für das Selbstverstehen des Einzelnen verloren. Die Beiträge des Bandes legen charakteristische Denkbewegungen Kierkegaards frei und erschließen deren Deutungspotenzial für den Vollzug der christlichen Existenz heute. |
 |
Christine Axt-Piscalar Taufe und Kirchenzugehörigkeit Zum theologischen Sinn der Taufe, ihrer ekklesiologischen und kirchenrechtlichen Bedeutung Evangelisches Verlagshaus, 2017, 224 Seiten, Paperback, 978-3-374-05205-9 |
Veröffentlichungen i.A. der VELKD Was ist der theologische Sinn der Taufe und welche Bedeutung hat sie für das Ganze des christlichen Lebens? Inwiefern ist in der Taufe ein Bezug zur Kirche, gerade auch in ihrer verfassten Gestalt, mit eingeschlossen? Welche rechtlichen Regelungen sind mit der Taufe verknüpft? Welche Fragen stellen sich angesichts der gegenwärtigen Taufpraxis – etwa ihre rituelle Gestaltung betreffend, hinsichtlich der vielfältigen Erwartungshaltungen auf Seiten der Eltern und Taufwilligen oder mit Blick auf Menschen, die trotz Nichtzugehörigkeit zur verfassten Kirche die Taufe begehren? Welche Aufgaben erwachsen für die jeweilige Gemeinde aus der Taufe von Säuglingen, Kindern und Erwachsenen? Das Buch will eine Handreichung geben für Pfarrer, Katecheten, Kirchenvorsteher und Ehrenamtliche, die mit theologischen Fragen nach dem Sinn der Taufe, mit deren rechtlichen Implikationen sowie der Gestaltung der konkreten Taufpraxis befasst sind. Die Texte richten sich aber auch an alle Getauften und solche, die die Taufe anstreben, dem Sinn der Taufe und ihrer Bedeutung für das eigene Leben nachzudenken. Mit Beiträgen von Christine Axt-Piscalar, Ulrich Heckel, Michael Herbst, Ark Nitsche und Heinrich de Wall. |