| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| EKD Denkschriften / EKD Grundlagentexte | ||
| siehe auch: Veröffentlichungen i.A. der VELKD | ||
 |
Welt in Unordnung – Gerechter Friede im
Blick Evangelische Friedensethik angesichts neuer Herausforderungen. Eine Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland Evangelisches Verlagshaus, 2025, 152 Seiten, kartoniert, 12 x 19 cm 978-3-374-07980-3 12,00 EUR |
Die aktuelle Friedensdenkschrift
der EKD markiert eine deutliche Neuausrichtung der protestantischen
Friedensethik, die sowohl dem
christlichen Ideal der Gewaltfreiheit als auch der veränderten Weltlage
gerecht zu werden versucht. Die EKD hält an der Vision eines „Gerechten Friedens“ fest, ohne die Realität von Gewalt und Bedrohung zu leugnen. Obwohl sie pazifistische Traditionen würdigt, rückt die Anerkennung staatlicher Schutzpflichten in den Vordergrund. Dabei wird deutlich: Die evangelische Friedensethik befindet sich in einem Prozess der Neuorientierung, der noch nicht abgeschlossen ist. Gewaltsame Konflikte und globale Krisen stellen Politik, Gesellschaft und Kirchen vor komplexe Herausforderungen. Die neue Friedensdenkschrift des Rates der EKD setzt sich differenziert mit Fragen von Krieg und Frieden auseinander. Im Zentrum steht dabei eine Weiterentwicklung des ökumenischen Leitbildes des Gerechten Friedens. Auf der Basis biblischer Überlieferung und reformatorischer Tradition bietet die Denkschrift ethische Kriterien, die Christinnen und Christen Orientierung geben können – und sie gibt Anregungen, was Kirchen, Politik und Zivilgesellschaft für eine friedvollere Welt tun können. Die Denkschrift verzichtet auf einfache Antworten und ermutigt stattdessen zum gründlichen Nachdenken und verantwortlichen Handeln. Damit setzt sie ein Gegengewicht zu populistischen Vereinfachungen und gibt Impulse für öffentliche Debatten. Open Access pdf |
 |
Aus Gottes Frieden leben - für
gerechten Frieden sorgen Gütersloher Verlagshaus, 2022, 128 Seiten, kartoniert, 12 x 19 cm 978-3-579-02081-5 8,00 EUR |
Eine
Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. Wer aus dem Frieden Gottes lebt, tritt für den Frieden in der Welt ein. Ebenso einfach wie überzeugend sind die Leitgedanken der EKD-Denkschrift zum Thema Frieden. Sie verbinden sich mit konkreten und spezifischen Handlungsoptionen, die die Notwendigkeit der Prävention hervorheben, gewaltfreien Methoden der Konfliktbearbeitung den Vorrang geben und den zivilen Friedens- und Entwicklungsdiensten eine wichtige Rolle in der Friedensarbeit zuweisen. Diese Friedensschrift der EKD aus dem Jahr 2007 bietet nach wie vor eine nachhaltige Grundorientierung, wie den akuten Gefahren für den Weltfrieden auf rechtsförmige und wirksame Weise begegnet werden kann. |
 |
Zwischen Nächstenliebe und Abgrenzung
Eine interdisziplinäre Studie zu Kirche und politischer Kultur Evangelisches Verlagshaus, 2022, 280 Seiten, kartoniert, 978-3-374-07141-8 29,00 EUR |
Seit geraumer Zeit beschäftigt sich die EKD mit
den Themenbereichen Kirche und Rechtspopulismus bzw. -extremismus sowie
zunehmenden menschenfeindlichen Einstellungen in Deutschland. 2019 hat
die EKD beschlossen, drei Studien zu fördern, die den Zusammenhang
zwischen Kirchenmitgliedschaft, Religiosität, politischer Kultur und
Vorurteilsstrukturen aus verschiedenen sozialwissenschaftlichen
Perspektiven beleuchten. Im vorliegenden Band sind die Abschlussberichte einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, einer qualitativen Analyse von Zusammenhängen zwischen theologischer Argumentation und Narrationen vorurteilsbezogener Kommunikation und Hassrede online (»Hate Mails«) sowie einer ethnografischen Fallstudie zu politisch-kulturellen Herausforderungen in exemplarischen Kirchengemeinden dokumentiert. Die drei Untersuchungen haben zu ertragreichen Ergebnissen geführt, die den Zusammenhang von Kirchenmitgliedschaft oder Religiosität und Vorurteilen erhellen, kirchliche Handlungsbedarfe anzeigen, aber auch deutlich machen, welche Stärken Kirche und Religiosität in Blick auf Vorurteile bieten. |
 |
Ruth Gütter Zukunft angesichts der ökologischen Krise? Theologie neu denken Evangelisches Verlagshaus, 2022, 200 Seiten, kartoniert, 978-3-374-07048-0 25,00 EUR |
Die ökologische Krise und die Corona-Pandemie
stellen nicht nur Politik und Gesellschaft vor große Herausforderungen,
sondern richten auch grundlegende Fragen an den christlichen Glauben und
die Theologie. Stimmen unsere Bilder und Narrative von Gott, vom
Menschen, von der Mitschöpfung noch? Muss das Verhältnis des Menschen
zur Mitschöpfung, das Verständnis von Sünde und Erlösung neu gedacht
werden? Welche Beiträge können alte und neue theologische Vorstellungen
geben, um die Gegenwart so mitzugestalten, dass eine gute Zukunft für
alles Leben möglich ist? Zu diesen Fragestellungen wurde im Juni 2021 eine große digitale theologische Tagung durchgeführt. Die Vorträge, die auf dieser Tagung diskutiert wurden, sowie weitere Beiträge sind im hier vorgelegten Band nachzulesen. Die Herausgeber und die Herausgeberin erhoffen sich eine verstärkte theologische Auseinandersetzung mit der ökologischen Krise in Deutschland wie auch in der weltweiten Ökumene. Mit Beiträgen von Heinrich Bedford-Strohm, Klara Butting, Jan Christensen, Constantin Gröhn, Ruth Gütter, Jörg Herrmann, Georg Hofmeister, Sarah Köhler, Diana Lunkwitz , Christoph Maier, Annette Muhr-Nelson, Anne Pappert, Wolfgang Schürger, Maximilian von Seckendorff und Dietrich Werner. |
 |
Vielfalt und Gemeinsinn Evangelisches Verlagshaus, 2021, 96 Seiten, kartoniert, 978-3-374-07009-1 8,00 EUR |
EKD-Grundlagentext Der Beitrag der evangelischen Kirche zu Freiheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Ein Grundlagentext der Kammer der EKD für Öffentliche Verantwortung Das Gemeinsame zu fördern und dabei die Vielfalt und Freiheit der Einzelnen zu wahren – dieser Balanceakt ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit für Kirche und Gesellschaft. Es gilt, einen verbindenden Rahmen zu bestimmen, der gleichzeitig individuelle, vielfältige Positionierungen ermöglicht. Die Kammer der EKD für Öffentliche Verantwortung beleuchtet, welchen Beitrag der evangelische Glaube mit seinen Ideen, Orten und Praktiken leisten kann: Im Bildungshandeln, im diakonischen Hilfehandeln und im Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit werden entsprechende Haltungen des Gemeinsinns nicht nur veranschaulicht, sondern auch eingeübt. Grundlage solcher Gemeinsinnorientierung ist, dass jeder Mensch gleichermaßen als Geschöpf Gottes angesehen wird. Damit wird ein Miteinander ermöglicht, das Erfahrungen und Ressourcen eröffnet, die nicht nur den kirchlichen, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gemeinsinn zu befördern und zu stärken vermögen. |
 |
Pfingstbewegung und Charismatisierung
Zugänge – Impulse – Perspektiven. Evangelisches Verlagshaus, 2021, 248 Seiten, kartoniert, 978-3-374-06961-3 12,00 EUR |
EKD-Orientierungshilfe Eine Orientierungshilfe der Kammer für Weltweite Ökumene der Evangelischen Kirche in Deutschland Pfingstliche Kirchen sind in vielen Ländern die christliche Gruppierung, die am schnellsten wächst. Weltweit gehört rund ein Viertel der Christinnen und Christen einer pfingstlichen oder charismatischen Gemeinde an. Dadurch verändert sich die konfessionelle Landschaft, zunehmend auch in Europa. Wie kann ein konstruktiver Dialog gelingen, der dennoch kritische Aspekte nicht ausblendet? Dies ist die Leitfrage der Orientierungshilfe der Kammer für Weltweite Ökumene der EKD. Um Dialog zu ermöglichen, führt sie zunächst in Geschichte und Typologie der Pfingstbewegung ein und zeichnet anhand von Fallbeispielen ein breites Panorama ihrer kulturellen Ausprägungen. Ein Schwerpunkt des Bandes liegt dann auf der Diskussion theologischer Grundsatzfragen, die sich im Gespräch mit Pfingstkirchen ergeben. zur Seite Freikirchen |
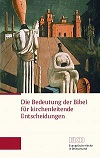 |
Die Bedeutung der Bibel für kirchenleitende Entscheidungen
Evangelisches Verlagshaus, 2021, 120 Seiten, kartoniert, 978-3-374-06994-1 8,00 EUR |
Ein Grundlagentext der Evangelischen
Kirche in Deutschland Evangelisches Selbstverständnis bewegt sich in der Folge der Reformation bis heute im Spannungsfeld von Schriftbindung (»sola scriptura«) und Schriftauslegung. Die Aufklärung rückte die Sicht auf die Bibel als historisch gewachsene Textsammlung ins Zentrum. Neue Auslegungsmethoden eröffneten neue Zugänge zu biblischen Texten. Trotzdem: Nur selten lassen sich Antworten auf heutige Fragen direkt aus der Bibel ableiten. Das Ringen um ein gemeinsames Verständnis der Bibel wird für jene zur Herausforderung, die in der Kirche Verantwortung tragen. Sie sind herausgefordert, kirchliche Entscheidungen an der Bibel auszurichten und zugleich menschlich klug zu entscheiden. Der vorliegende Grundlagentext der Kammer für Theologie der EKD entwickelt hierfür das Modell des »Überlegungsgleichgewichts« in Anlehnung an einen Begriff von John Rawls. Unterschiedliche Instanzen der Urteilsbildung und biblische Einsichten sollen in einem Abwägungsprozess gewichtet und miteinander vermittelt werden. Erfahrungswissen und Einsichten aus den Wissenschaften werden zu biblischen Aussagen so ins Verhältnis gesetzt, dass die orientierende und bindende Kraft der Bibel zum Tragen kommt. |
 |
Sünde, Schuld und Vergebung aus Sicht evangelischer
Anthropologie Ein Grundlagentext der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Evangelisches Verlagshaus, 2020, 136 Seiten, kartoniert, 978-3-374-06743-5 8,00 EUR |
Was ist
Sünde? Was ist
Schuld? Was ist Vergebung?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich dieser EKD-Grundlagentext aus der
Perspektive einer evangelischen Lehre vom Menschen (Anthropologie).
Ihre Beantwortung berührt die Kernbotschaft der Reformation: die
Rechtfertigung des Sünders. Aus christlicher Sicht kann von Sünde und Schuld nicht geredet werden, ohne sie im Licht der Vergebung Gottes wahrzunehmen. Hinter der Sünde verbirgt sich die Not der Gottesferne, die oft genug zu konkreter Schuld führt. Kein Lebensbereich ist von Erfahrungen mit Schuld und Sünde frei. Vergebung macht Sünde nicht ungeschehen, aber sie ermöglicht Neuanfänge. Ein Leben im Glauben an die befreiende Kraft des Evangeliums motiviert dazu, Vergebung an andere weiterzugeben. Mit diesem Text ergänzt der Rat der EKD seinen Text zur Kreuzestheologie »Für uns gestorben« aus dem Jahr 2015. |
 |
Zwischen Autonomie und
Angewiesenheit Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken. Eine Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Gütersloher Verlagshaus, 2013, 160 Seiten, kartoniert, 978-3-579-05972-3 5,99 EUR |
Ehe und Familie im Wandel –
Herausforderungen, Brennpunkte, Orientierungshilfen »Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.« – Menschen sind zur Gemeinschaft bestimmt und auf Liebe, Fürsorge, Erziehung und Pflege angewiesen. Demgegenüber steht der Wunsch nach Erkenntnis, Entdeckung, nach Entwicklung und Eigenständigkeit. In der Ambivalenz von Angewiesenheit und Autonomie wird Familienleben erfahren. Die vorliegende Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland untersucht alle Facetten des modernen Familienlebens, geht ein auf die Herausforderungen und Brennpunkte der Familienpolitik und bietet theologische Orientierung. Kirche ist nach wie vor eine wichtige Ansprechpartnerin für Familien: mit ihren Kasualien, Festen und Feiern, als Ort für Bildung, Erziehung und Begegnung, als Begleiterin in Krisensituationen mit ihren diakonischen Diensten. Gemeinden und Familienzentren haben zudem eine wachsende Bedeutung auch für die religiöse Erziehung und die Weitergabe des Glaubens. Download als pdf siehe dazu Zeitzeichen Heft 10/2014 siehe dazu: Isolde Karle, Liebe in der Moderne |
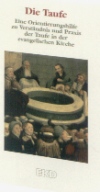 |
Die Taufe
Eine Orientierungshilfe zu Verständnis und Praxis der Taufe in der Evangelischen Kirche Gütersloher Verlagshaus, 2008, 64 Seiten, kartoniert, 12 x 19 cm 978-3-579-05904-4 4,95 EUR |
Die Taufe gilt als die Eintrittstür in
die christliche Gemeinschaft. Zugleich ist sie ein Kernstück der
ökumenischen Zusammengehörigkeit der Christenheit und wird von vielen
Kirchen als das »Sakrament der Einheit« der Christen bezeichnet. Diese Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Verständnis und die Praxis der Taufe in evangelischer Perspektive darzulegen. Und sie will Mut machen: zu einer Erneuerung der Taufpraxis in den Gemeinden, zur Einladung von Erwachsenen zur Taufe, zur angemessenen Gestaltung der Taufe für alle Lebensalter und auch zu einer verstärkten Tauferinnerungskultur. Als Handreichung ist sie für Pfarrer und Pfarrerinnen ebenso geeignet wie für Kirchenvorstände, Gesprächsgruppen oder einzelne, die sich mit dem Verständnis der Taufe beschäftigen wollen. Leseprobe |
|
Wandeln und Gestalten - missionarische Chancen und
Aufgaben der Evangelischen Kirche in ländlichen Räumen EKD Text 87, 2007 |
Download als pdf | |
 |
Der Dienst der Evangelischen Kirche an der Hochschule
Gütersloher Verlagshaus, 1991, 328 Seiten, 355 g, kartoniert, 3-579-01960-0 4,90 EUR |
Eine Studie im Auftrag der Synode der EKD Neubuch in Originalfolie |
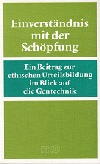 |
Einverständnis mit der Schöpfung Ein Beitrag zur ethischen Urteilsbildung im Blick auf die Gentechnik Gütersloher Verlagshaus, 1991, 96 Seiten, kartoniert, 3-579-01961-9 3,00 EUR |
Innerhalb weniger Jahrzehnte sind den Menschen auf dem
Gebiet der Gentechnik ungeahnte neue Erkenntnisse und
Handlungsmöglichkeiten zugewachsen, und die Geschwindigkeit der
Entwicklung in Forschung und Anwendung nimmt eher zu als ab. Um so
dringlicher ist es, daß nicht allein wissenschaftliche Neugier und
wirtschaftliches Kalkül, sondern im gleichen Maße, ja vorrangig ethische
Überlegungen das Gesetz des Handelns bestimmen. Wir stehen bei der
Gentechnik - wie im Falle anderer moderner Techniken - vor der Frage:
Wie wollen wir leben? Was nötigt uns dazu, Nebenfolgen einer technischen
Entwicklung in Kauf zu nehmen? Was ist das Menschliche am Menschen, das
Natürliche an der Natur, das es zu bewahren gilt? Sind wir fähig, auch
Verzicht zu üben? In Öffentlichkeit und Kirche hat sich das Interesse
lange, zu lange darauf gerichtet, wo und wie sich die neueren
Entwicklungen in Biologie und Medizin auf den Menschen selbst auswirken.
So widmeten sich auch die ersten Stellungnahmen aus der Evangelischen
Kirche in Deutschland ganz (››Von der Würde werdenden Lebens<<, 1985)
oder zum größten Teil (Kundgebung der Synode ››zur Achtung vor dem
Leben«, 1987; beide veröffentlicht in Heft zo der EKD-Texte) den
Problemen der Fortpflanzungsmedizin und Embryonenforschung, Genomanalyse
und Gentherapie beim Menschen. Diese Themen bleiben aktuell und fordern
weiterhin die kritische Aufmerksamkeit. Aber ihre prinzipielle oder
praktische Vorrangstellung fördert den verhängnisvollen Eindruck, die
ethische Problematik begänne erst dort, wo der Mensch unmittelbar
berührt ist. Der hier vorgelegte Beitrag hat es sich darum zur Aufgabe
gemacht, gegenläufig zu der verbreiteten Fragerichtung gerade die
Anwendung der Gentechnik bei Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren zu
thematisieren. In der Diskussion dieses Anwendungsfeldes der Gentechnik steht im allgemeinen der Risikoaspekt im Vordergrund. Dafür gibt es - angesichts sowohl der mit der Gentechnik einhergehenden objektiven Gefährdungspotentiale als auch der von ihr ausgelösten subjektiven Ängste - gute Gründe. Aber mit der Gentechnik ist über den Risikoaspekt hinaus die fundamentalere ethische Frage gestellt, wie das Verhältnis des Menschen zur Natur beschaffen sein und in Welche Richtung es sich verändern soll. Die Ausarbeitung, die hier zur Diskussion gestellt Wird, zeichnet sich dadurch aus, daß sie diese Fragestellung ins Zentrum rückt und unter der Überschrift »Einverständnis mit der Schöpfung« gerade ihre religiöse und theologische Dimension entfaltet. Die Ausarbeitung versteht sich als Diskussionsbeitrag zur ethischen Urteilsbildung. Darin kommt zum Ausdruck, daß die Kirche auf dem Feld der Gentechnik das ethische Urteil nicht vorschreiben und vorwegnehmen, vielmehr eine Hilfe zur eigenverantwortlichen Klärung geben will. Ihr Beitrag im Zeitgespräch öffentlicher Verantwortung unterliegt den allgemeinen Verständigungsregeln, zielt auf Schärfung der Gewissen und nicht Bevormundung, auf Einsicht und nicht blinde Gefolgschaft. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat die Arbeitsgruppe, die diesen Diskussionsbeitrag vorbereitet hat, 1986 berufen. Sie wurde mit Yorbedacht so zusammengesetzt, daß in ihr verschiedene Fachrichtungen und kontroverse Positionen vertreten waren. Der Rat hat das Ergebnis der Arbeitsgruppe im Herbst 1990 entgegengenommen und Wert darauf gelegt, daß es einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Er verbindet damit die Hoffnung, daß das Plädoyer für ein Umdenken im Verhältnis zur Natur bis hinein in die \\§-'issenschaft und Politik aufgenommen und ein neues Einverständnis mit der Schöpfung gewonnen wird. Hannover, im März 1991 Bischof Dr. Martin Kruse Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland |
 |
Verantwortung für ein soziales Europa Herausforderungen einer verantwortlichen sozialen Ordnung im Horizont des europäischen Einigungsprozesses Gütersloher Verlagshaus, 1991, 127 Seiten, 150 g, kartoniert, 3-579-01964-3 3,00 EUR |
Eine Denkschrift der Kammer der Evangelischen Kirche in
Deutschland für soziale Ordnung. Vorwort Dankbar sehen wir in diesen Tagen: Der Prozeß des Zusammenwachsens der Europäischen Gemeinschaft (EG) geht mit großen Schritten voran. Im wirtschaftlichen und im politischen Bereich ist es zu einer Zusammenarbeit der Staaten in Westeuropa gekommen, wie wir dies vor zwanzig Iahren noch für undenkbar hielten. Vieles ist jetzt in Bewegung. Die Veränderungen in Osteuropa bedeuten neue, große Herausforderungen. Bis zum Ende des Iahres 1992 soll der europäische Binnenmarkt vollendet sein. Mit diesem Datum dürften tiefgreifende Auswirkungen auch auf die Sozialkultur und die Arbeitswelt der Menschen in Europa verbunden sein. Ist sichergestellt, daß es nicht auch zu Fehlentwicklungen kommen kann? Haben wir uns genügend nicht nur für die wirtschaftliche, sondern vor allem auch für die soziale Gestaltung dieses Europa eingesetzt? Und vor allem: Haben wir als Kirchen unsere Mitverantwortung für das Gemeinwesen Europa erkannt? Von Jean Rey, dem ehemaligen Präsidenten der Kommission der Europäischen Gemeinschaft, stammt der Ausspruch: ››Die Welt ordnet sich in Kontinenten. Die Christen müssen sich in neuen Aktionen bewähren, die dem neuen Rahmen angemessen sind. Auch die Gestaltung des europäischen Kontinents geht mit Vorrang die Kirchen an.<< In der Tat, die Christen dürfen jetzt nicht einfach Zuschauer sein. Sie müssen erkennen, daß auch sie betroffen und einbezogen sind. Der Glaube an die Frohe Botschaft von der Versöhnung Gottes in ]esus Christus führt uns Christen in eine Mitverantwortung auch für das Gemeinwesen Europa. Es geht um eine Mitverantwortung für die Europäische Gemeinschaft der zwölf EG-Mitgliedsstaaten von heute, für die erweiterte Gemeinschaft von morgen, für das ››gemeinsame europäische Haus« und auch dafür, wie sich Europa gegenüber der außereuropäischen Welt 'verhalten wird. Diese Verantwortung schließt das Mitdenken und Handeln ebenso ein wie das Gebet. Die Kammer der EKD für soziale Ordnung hat eine Denkschrift erarbeitet, die insbesondere die Fragen der sozialen Gestaltung Europas anspricht. Hier geht es um grundlegende Fragen zu den Stichworten Arbeit, Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit, Familie, Ausländer und vieles andere mehr. Der Entwurf beschreibt die neuralgischen Punkte im Einigungsprozeß. Er weist auf die wichtigen sozialpolitischen und sozialkulturellen Probleme hin und formuliert Erfordernisse einer gedeihlichen europäischen Entwicklung. Iminer wieder werden hier auch Stimmen aus dem Raum der Kirchen zitiert und in Erinnerung gebracht. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat die Ausarbeitung der Kammer mit Dank und Zustimmung zur Kenntnis genommen. Es ist sein besonderes Anliegen, daß diese Denkschrift vor allem im Raum der evangelischen Christen in Europa Verbreitung und Aufmerksamkeit findet. Sie soll darüber hinaus aber auch die Engagierten, Entscheidungsträger und Verantwortlichen in Deutschland und in den Nachbarländern ansprechen.“ Ich wünsche der Schrift eine aufgeschlossene und konstruktiv kritische Diskussion. Hannover im Oktober 1991 Bischof Dr. Martin Kruse Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland |
 |
Arbeit, Leben und Gesundheit Perspektiven, Forderungen und Empfehlungen zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz Gütersloher Verlagshaus, 1990, 139 Seiten, 160 g, kartoniert, 3-579-01957-0 3,00 EUR |
Vorwort Gesundheit ist ein Gut, das Gott in die Verantwortung des Menschen gelegt hat. Der arbeitende Mensch darf nicht Raubbau mit dieser Gabe treiben, er darf sie nicht vergeuden, und er darf die Gesundheit seiner Mitmenschen, die mit und für ihn arbeiten, nicht gefährden. Die Kirche muß die Frage stellen: Inwieweit ist der Schutz der Integrität von Person und Leib des arbeitenden Menschen gesichert? Findet diese Arbeit unter Bedingungen statt, welche den Schwachen nicht iiberfordern, den Schutz des Gesunden gewährleisten und die Persönlichkeit fördern sowie die Würde des Menschen wahren? Das Ergehen, das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen in seiner Arbeit ist ein grundlegendes Thema von weitgehender, allgemein menschlicher Bedeutung. Die Arbeit kann maßgeblich zur Lebenszufriedenheit beitragen, sie kann den arbeitenden Menschen aber auch zermürben, belasten und krank machen. Obwohl der Mensch in der modernen Arbeitswelt durch Maschinen immer stärker entlastet worden ist, obwohl die Plackerei und die Arbeitszeit erheblich abgenommen haben, obwohl der Arbeitsschutz so aufwendig und fundiert ist wie nie in der Geschichte, dennoch sind Tendenzen zu beobachten, die nachdenklich stimmen: Die Zahl der gefährlichen Arbeitsstoffe nimmt ständig zu. Die Späteinwirkungen sind vielfach noch nicht abzusehen. Internisten machen uns auf die Zunahme von Organschädigungen und berufsbedingten Erkrankungen aufmerksam. Die' psychischen Belastungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Wir haben es vermehrt mit Allergien zu tun. Aber auch viele »klassische Belastungen« wie zum Beispiel Lärm, Staub, Schmutz und das Bewegen schwerer Lasten bestimmen immer noch viele Arbeitsplätze. Zunehmend müssen neben den Ursachen für Belastungen und Schädigungen des arbeitenden Menschen auch der private Bereich, der Lebenswandel des einzelnen und seine Lebensbedingungen in die Überlegungen mit einbezogen werden. Die Studie ››Arbeit, Mensch und Gesundheit« zeigt die Probleme auf, reflektiert dazu grundlegend theologische, ethische und anthropologische Fragestellungen und formuliert einige wichtige Forderungen zur Verbesserung der Situation. lm Zentrum der Studie steht die Forderung nach einer ››ganzheitlichen Sicht« und entsprechend nach der Schaffung von umfassenderen Verantwortlichkeiten. Es geht den Autoren nicht allein darum, daß es zu einem besseren Schutz des Menschen in der Arbeitswelt kommt, sondern auch darum, daß es zu einem besseren Verständnis des Lebens mit ››Stressoren<< und ››Ressourcen<<, mit belastender Arbeit und Krankheit kommt. Die Studie will zu mehr Weitsicht und Eigenverantwortlichkeit anhalten. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat diese Ausarbeitung der Kammer der EKD für soziale Ordnung mit Zustimmung zur Kenntnis genommen und das Kirchenamt mit seiner Veröffentlichung beauftragt. Er hofft, daß mit dieser Schrift die Diskussion um die Gesundheit des Menschen am Arbeitsplatz und ihre christlich- ethischen Aspekte neue Impulse erfährt und daß die Schrift mit dazu beiträgt, daß Arbeit Verantwortlicher gestaltet wird. Arbeit, das sollen wir Christen wissen, soll den Menschen nicht krank machen, denn sie ist von Gott dazu bestimmt, seinem Wohl zu dienen. Hannover im September 1990 Bischof Dr. Martin Kruse Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland |
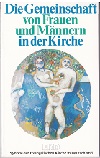 |
Die Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche
Gütersloher Verlagshaus, 1990, 95 Seiten, 110 g, kartoniert, 3-579-01956-2 3,50 EUR |
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland Die Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche - mit diesem Schwerpunktthema hat sich die 7. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland auf ihrer 6. Tagung vom 5. bis zum 10. November 1989 in Bad Krozingen befaßt. Daß dieses Thema auch in der Kirche dringlich ist, war bei der Vorbereitung der Synode ebenso deutlich, wie die Schwierigkeit, zu überzeugenden Beratungsergebnissen zu kommen. Die Erwartungen waren hoch und mußten allmählich zurückgesteckt werden; begreifliche Ungeduld konnte teils für die Durchsetzung neuer Vorstellungen genutzt, teils mußte sie auch gezügelt werden; beträchtliche Ängste und Sorgen mußten ernstgenommen und behutsam abgebaut werden. Daß die Synode am Ende ihren Beschluß nahezu einstimmig fassen konnte, hat allen Beteiligten Hör- und Lernbereitschaft, Zugeständnisse und Hintenanstellen von Bedenken abverlangt. Es ist zu hoffen, daß der hier veröffentlichte Beschlußtext sowie die Vorträge sind Bibelarbeiten den Gemeinden, Diensten und Werken bei ihren eigenen Bemühungen um die Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche hilfreich sein werden. Hannover, im Dezember 1989 Dr.Jügen Schmude, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland |
 |
Evangelische Freiheit - kirchliche Ordnung Beiträge zum Selbstverständnis der Kirche, herausgegeben von der Evangelischen Landessynode in Württemberg Quell Verlag, 1987, 120 Seiten, kartoniert, 3-7918-2319-1 4,90 EUR |
Konrad Gottschick Kirchengeschichtliche Momentaufnahmen zum Thema »Evangelische Freiheit - Ordnung der Kirche« Hans Martin Müller Vom Umgang mit dem Recht in der evangelischen Kirche Martin Heckel Evangelische Freiheit und kirchliche Ordnung- kirchenrechtliche Perspektiven Eberhard Jüngel Ordnung gibt der Freiheit einen Raum |
 |
Versöhnung und Frieden mit den Völkern der Sowjetunion
Herausforderung zur Umkehr. 8 Thesen Gütersloher Verlagshaus, 1987, 63 Seiten, 85 g, kartoniert, 3-579-01994-5 3,00 EUR |
Vorwort 40 Jahre ist es her, seit der Bruderrat der Evangelischen Kirche in Deutschland sein »Wort zum politischen Weg unseres Volkes« veröffentlicht hat, das als »Darmstädter Wort« bekanntgeworden ist. Es war ein Ruf zur Umkehr von den Irrwegen der Vergangenheit, die zum Nationalsozialismus und in der Folge auch zum Krieg gegen die Sowjetunion geführt hatten. Wie schon das Stuttgarter Schuldbekenntnis (194 5) hat erst recht dieser Ruf damals zu heftigen Reaktionen in Kirche und Öffentlichkeit gefiihrt; aber er ist nicht wirklich gehört worden. Vielleicht war die Zeit dafür noch nicht reif. Heute sehen wir, wie vor allem die verdrängte Schuld gegenüber den Völkern der Sowjetunion die gesellschaftliche und politische Entwicklung der Bundesrepublik untergründig und nachhaltig mitbestimmt hat. Eine Auseinandersetzung mit dieser Schuldgeschichte ist längst überfällig. Wenn wir mit diesen Thesen neu auf das Darmstädter Wort antworten, so tun wir das in der Überzeugung, daß die theologische Verantwortung für Kirche und Gesellschaft, die die Mütter und Väter der Bekennenden Kirche wahrgenommen haben, uns auch heute die Richtung weist. Ihr Zeugnis gründete in dem Bekenntnis, daß »Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden« und >›so und mit gleichem Ernst auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben« ist (Barmer Theologische Erklärung, 1934, These 2). Die Herausgeber sehen die hier vorgelegten Thesen in der Linie dieses Zeugnisses und verstehen sie an erster Stelle als theologische Herausforderung. Das Evangelium von der Vergebung der Schuld ermutigt freilich zu einem neuen, besseren Dienst zur Ehre Gottes und zum Heil und Wohl der Menschen. Deshalb zieht es gesellschaftliche und politische Veränderungen nach sich. Der anspruchsvolle Titel der Thesenreihe formuliert so zugleich die theologische Aufgabe und das politische Ziel, um das es uns geht. Die Arbeitsgemeinschaften Solidarische Kirche Lippe und Westfalen haben federführend die Thesen ausgearbeitet. An der Ausarbeitung haben sich auch Mitglieder des Moderamens des Reformierten Bundes und der anderen Herausgeber beteiligt. Diese Stellungnahme ist das Ergebnis eines längeren Prozesses, den die Arbeitsgemeinschaften in ihrem Buch »Brücken der Verständigung. Für ein neues Verhältnis zur Sowjetunion« (Gütersloher Taschenbücher/Siebenstern 579), 1986, dokumentiert haben. Wir legen die Thesenreihe in einer politischen Konstellation vor, die von wegweisenden Initiativen des Generalsekretärs der KPdSU, M. Gorbatschow, bestimmt ist. Sowohl innenpolitisch als auch aufšenpolitisch scheint sich in der UdSSR eine Entwicklung anzubahnen, die -- wenn sie gelingt - einen tiefgreifenden Wandel der sowjetischen Gesellschaft und Politik zur Folge haben wird. Der Westen hat bisher noch keine klare Antwort auf die Politik der Erneuerung entwickelt. Es droht die Gefahr, daß die Chancen für eine Verständigung mit der UdSSR durch Zaudern, Zerreden oder gar durch offenen Widerstand zunichte gemacht werden. Wir hoffen, daß unsere Thesen dazu beitragen, die Zeichen der Zeit zu erkennen, und Christen und Kirchen in der Bundesrepublik herausfordern, für Versöhnung und Frieden mit den Völkern der Sowjetunion energisch einzutreten. Wir widmen diese Thesenreihe dem Präses i. R. der Evangelischen Kirche von Westfalen, unserem Bruder Ernst Wilm, der als einer der ersten den Brückendienst der Versöhnung getan hat. Hartmut Lenhard |
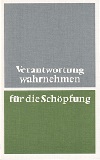 |
Verantwortung wahrnehmen für die Schöpfung Gemeinsame Erklärung des Rates der EKiD und der Deutschen Bischofskonferenz Gütersloher Verlagshaus, 1985, 63 Seiten, 70 g, kartoniert, 3-579-01987-2 2,60 EUR |
Gottes Schöpfung ist uns Menschen anvertraut, daß wir
sie bebauen und bewahren. Nehmen wir jedoch diese Verantwortung in
genügender Weite wahr? Belasten wir nicht Natur und Umwelt häufig in
verantwortungsloser Weise oder scheitern wir auf Grund von
Kurzsichtigkeit und Unwissenheit trotz guten Willens an unserer
verantwortlichen Aufgabe? Christen haben mehr und mehr erkannt, wie sehr die Fragen unserer Umwelt vor allem auch weltanschauliche, kulturelle und religiöse Aspekte umfassen. Bei der Schonung von Tieren, Pflanzen und natürlichen Lebensbedingungen geht es immer zugleich auch um die Wahrnehmung unserer Verantwortung vor Gott dem Schöpfer. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz wenden sich in dieser wichtigen Frage mit einer gemeinsamen Erklärung an die Öffentlichkeit. Sie machen deutlich, daß Verantwortung für die Schöpfung Gottes in rechter Weise wahrgenommen werden muß. Die Erklärung konzentriert sich auf Grundfragen des Naturverständnisses, des Menschenbildes und vor allem auf die biblische Schöpfungstheologie. Darum will sie vor allen Dingen die Christen selbst ansprechen. Die Bedrohung der Natur und Umwelt beunruhigt viele Menschen in hohem Maße. So ist auch die Diskussion über diese Fragen von tiefen Gegensätzen bestimmt. Die Sorge um mögliche weitere Gefährdungen oder unzureichende Abhilfen hat Mauern des Unverständnisses geschaffen, die Trennungen und Konflikte mit sich bringen. Die gemeinsame Erklärung will an die biblischen Aussagen über die Schöpfung Gottes erinnern und auf ihre Aktualität hinweisen. Sie wirbt für eine nüchterne, aufgeschlossene und sachliche Diskussion. Die Bewältigung der Umweltprobleme ist eine gemeinsame Aufgabe, die bei allen eine Veränderung des Verhaltens und ein neues Denken verlangt. Hannover und Köln, den 14. Mai 1985 Joseph Kardinal Höffner, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz Landesbischof D. Eduard Lohse, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland |
 |
Die neuen Informations- und Kommunikationstechniken
Gütersloher Verlagshaus, 1985, 126 Seiten, 140 g, Kartoniert, 3-579-01990-2 3,00 EUR |
Chancen, Gefahren, Aufgaben verantwortlicher Gestaltung Eine Studie der Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland für soziale Ordnung und der Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland für piblizistische Arbeit. |
 |
Frieden politisch fördern: Richtungsimpulse Sechs Expertenbeiträge für die evangelische Kirche in Deutschland Gütersloher Verlagshaus, 1985, 174 Seiten, 185 g, kartoniert, 3-579-01988-0 3,50 EUR |
Vorwort Einige Anmerkungen zur Friedensdiskussion Klaus Ritter Zur Problematik der Denkfigur ››Abschreckung<< Klaus von Schubert . Handlungsspielräume im Ost-West-Konflikt Klaus von Beyme Einfrieren und Nichterstgebrauch von Kernwaffen - Wege in der Gefahr? Karl Kaiser Nord-Süd-Konflikte und ihre Ursachen: Politische Handlungsperspektiven für eine friedlichere Dritte-Welt-Politik Rainer Tetzlaff Eine internationale Friedensordnung als rechtliche und politische Gestaltungsaufgabe - Zum Verständnis rechtlicher und politischer Bedingungen der Friedenssicherung im internationalen System der Gegenwart Jost Delbrück |
 |
Miteinander leben lernen Zum Gespräch der Generationen in der christlichen Gemeinde. Dokumente und Beiträge Gütersloher Verlagshaus, 1985, 126 Seiten, 130 g, Kartoniert, 3-579-01989-9 2,00 EUR |
Geleitwort Der Titel dieses Taschenbuchs ist mehr als nur ein Postulat; er meint auch längst geübte Praxis. Die Kirche hat in den Jahren seit dem Kriege vieles und Gutes von ihren jungen Gemeindegliedern lernen können. Aber auch junge Gemeindeglieder sind in erstaunlichem Maße bereit, von der oft gescholtenen Institution Kirche, in der überwiegend die Älteren das Sagen haben, Anstöße und Korrekturen aufzunehmen, wenn sie Kirche als lebendige Gemeinde erfahren. Die vorliegende Sammlung möchte den beziehungsreichen Prozeß, gemeinsam leben zu lernen, fördern und voranbringen. Dieses Interesse verbindet die - im übrigen sehr unterschiedlich gearteten - Texte. Der Leser wird erkennen, was »offizielle Meinung« der Evangelischen Kirche und was persönlich verantwortetei' Gesprächsbeitrag von engagierten Mitgliedern dieser Kirche ist. In jedem Fall wird er die Texte an der Heiligen Schrift und an der eigenen Erfahrung zu prüfen haben. Ein offenes Miteinander der Generationen lebt - in Kirche und Gesellschaft - von immer neuer Zuwendung und beharrlicher Bemühung. Detmold, den 28. August 1985 Dr. Ako Haarbeck, Landessuperintendent, Vorsitzender der Jugendkamrner der EKD |
 |
Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie Der Staat des Grundgesetzes als Angebot und Aufgabe Gütersloher Verlagshaus, 1985, 48 Seiten, 48 Seiten, kartoniert, 3-579-01971-6 2,00 EUR |
Vorwort des Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland Vor vierzig jahren hat der damalige Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland die Mitschuld der evangelischen Christen an dem Leid bekannt, das durch das nationalsozialistische Deutschland über viele Völker und Länder gebracht wurde. Ein neuer Anfang ist gemacht worden. Die evangelische Kirche hat ihre öffentliche Verantwortung im demokratischen Rechtsstaat bewußt wahrgenommen. Sie legt in dieser Denkschrift Rechenschaft ab über das neue Verständnis des Politischen, das in den vergangenen vierzig jahren unter den evangelischen Christen in Deutschland gewachsen ist. Gerade aus der klaren Zustimmung zur freiheitlichen Demokratie folgt eine Wache Bereitschaft, neue Herausforderungen und Gefahren offen zu erkennen und zu benennen, auch wo Lösungen noch nicht ersichtlich oder umstritten sind. Christen leben in unterschiedlichen Staatsformen und nehmen darin ihre jeweilige politische Aufgabe wahr. Dies gilt auch für die evangelischen Christen in beiden deutschen Staaten. Mit dieser Denkschrift wendet sich der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland an die Christen in der Bundesrepublik Deutschland und bittet sie, diese Ausarbeitung als Angebot für eine vertiefte Verständigung über die politische Aufgabe in unserem Staat anzunehmen. Der Rat dankt den Mitgliedern der Kammer für Öffentliche Verantwortung für die Erarbeitung dieser Denkschrift. Hannover, 1. Oktober 1985 D. Eduard Lohse, Landesbischof Vorwort des Vorsitzenden der Kammer für Offentliche Verantwortung Die Kammer für Öffentliche Verantwortung übergibt dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hiermit eine Denkschrift über ››Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie. Der Staat des Grundgesetzes als Angebot und Aufgabe«. Bei der Ausarbeitung war die Kammer sich einig in dem Ziel, der Zustimmung zur freiheitlichen Demokratie im Sinne des Grundgesetzes in einer Denkschrift Ausdruck zu geben, die als Ortsbestirnmung für das Verhältnis evangelischer Christen zu diesem Staat zu dienen vermag. Auf dem Hintergrund historischer Erfahrungen und angesichts aktueller Herausforderungen soll der Wert einer freiheitlichen demokratischen Verfassung anerkannt und bekräftigt werden. - Zum ersten Mal erfährt die Staatsform der liberalen Demokratie eine so eingehende positive Würdigung in einer Stellungnahme der evangelischen Kirche. Darin wird über einen bedeutsamen Wandel im evangelischen Verständnis des Staates Rechenschaft abgelegt. - Die Zustimmung zur demokratischen Staatsforrri schließt die Überzeugung ein, daß die politische Ordnung weiterhin verbesserungsfähig und verbesserungsbedürfig ist. Schwerwiegende Herausforderungen und Krisen in der Wirklichkeit von Staat und Gesellschaft der Gegenwart verlangen kritische Aufmerksamkeit. Die Kammer für Öffentliche Verantwortung hat mit dieser Denkschrift ein über ein Jahrzehnt von ihr verfolgtes Vorhaben verwirklicht, dem sie seit dem Abschluß der Denkschrift »Frieden wahren, fördern und erneuern« im Oktober 1981 intensive Beratungen gewidmet hat. Im Gange der Beratungen sind unterschiedliche Auffassungen über Notwendigkeit und Angemessenheit, Struktur und Gliederung dieser Denkschrift sowie über die Gewichtung von Gefährdungen der Demokratie vertreten worden. Die Denkschrift ist aus einem eingehenden Austausch von Argumenten und Bewertungen hervorgegangen, für dessen Abschluß auch weiterhin bestehende Divergenzen zurückgestellt worden sind. Das Ergebnis wird dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland von der Kammer einvernehmlich vorgelegt. Die Karnrner bittet den Rat der EKD, diese Denkschrift als Grundlage für eine weiterführende konstruktive Verständigung in unserer Kirche zu veröffentlichen und für eine geeignete Verbreitung in der evangelischen Christenheit Sorge zu tragen. München, 9. September 1985 Prof Dr. Trutz Rendtorff |
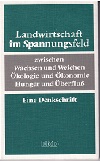 |
Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Wachsen und Weichen, Ökologie und Ökonomie, Hunger und Überfluss Gütersloher Verlagshaus, 1984, 128 Seiten, 135 g, Kartoniert, 3-579-01984-8 4,90 EUR |
Vorwort Auf die Landwirtschaft kommen heute neue Herausforderungen durch bedrängende gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Fragen zu. Die großen Problembereiche unserer Zeit finden nicht zuletzt auch in den Zukunftssorgen der Landwirte ihren Niederschlag: Die Beschäftigungskrise, die Gefährdung der natürlichen Umwelt und der Nord-Süd-Konflikt. So fragt eine wachsende Zahl von Menschen quer durch alle Berufe besorgt: Werden die neuen Technologien zu weiteren Rationalisierungen und zugleich auch zur Verschlechterung der Chancen am Arbeitsmarkt führen? Können sich die Industriegesellschaften weiter entwickeln wie bisher, ohne daß Wälder und Seen, Tiere und Pflanzen, letztlich auch der Mensch bedroht werden? Wie kann vermieden werden, daß der Abstand zwischen den reichen und den armen Nationen dieser Erde trotz mancher Teilerfolge in einigen Entwicklungsländern dennoch immer größer wird? Die Fragen der in der Landwirtschaft tätigen Menschen lautet ähnlich: Wie sieht die Zukunft unserer Landwirtschaft aus im Spannungsfeld zwischen Wachsen und Weichen, Ökonomie und Ökologie, Hunger in der Dritten Welt und Überfluß bei uns? Vornehmlich auf diese drei Themenbereiche konzentriert sich diese Denkschrift. Sie wendet sich nicht nur an die Landwirte, ihre Verbände und an die Agrarpolitiker, sondern auch an die Verbraucher und engagierte Umweltschützer. Sie alle verbindet das gemeinsame Interesse, unsere Landwirtschaft zu erhalten, Natur und Landschaft zu schützen und den Menschen in der Dritten Welt zu helfen. Mit welchen Schritten aber diese Ziele erreicht werden können, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten und Vorschläge, Wert- und Interessenkonflikte sowie eine heftige und kontroverse Diskussion mit mancher Unsachlichkeit und festgefahrenen Fronten. Diese Denkschrift will einen Beitrag zur Versachlichung und Vertiefung der Diskussion leisten und Orientierungshilfen geben. Sie ist entstanden aus der Erfahrung, daß die Kirche nicht nur in gesellschaftliche Konflikte, Spannungen und Sorgen mit eingebunden ist, sondern daß der christliche Glaube den Auftrag zum rechten Umgang mit der Schöpfung und zur solidarischen Hilfe für die notleidenden Mitmenschen dieser Erde einschließt. Ich hoffe, daß diese Denkschrift einen fruchtbaren Beitrag dazu leistet, die Gewissen zu schärfen, gegenseitiges Verständnis in der Diskussion zu wecken und Entscheidungshilfen für die großen Herausforderungen zu geben. D. Eduard Lohse Landesbischof Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland Inhalt Vorwort 1 Einleitung: Agrarische, ökologische und entwicklungspolitische Probleme der Gegenwart - eine Herausforderung an alle Gruppen der Gesellschaft 1.1 Tiefgreifende Strukturveränderungen 1.2 Zuspitzung der Situation landwirtschaftlicher Betriebe 1.3 Zuspitzung der ökologischen Probleme 1.4 Verschärfung der Hunger-Überfluß-Problematik im Weltmaßstab 1.5 Herausforderung für alle Gruppen der Gesellschaft . . 1.6 Beitrag der Kirche 2 Agrarentwicklung - Entstehung der Probleme und Suche nach neuer Ziel- und Wertorientierung 2.1 Bäuerliche Wirtschaftsweise in vorindustrieller Zeit 2.2 Probleme der Anpassung im Industrialisierungsprozeß 2.3 Agrarentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg 2.4 Einkommenspolitische und soziale Probleme bäuerlicher Familien 2.5 Struktur- und umweltgefährdete ländliche Regionen 2.6 Europäische und weltweite Zusammenhänge in der Agrarentwicklung 2.7 Suche nach neuer Ziel- und Wertorientierung 3. Landwirtschaft irn Spannungsfeld zwischen Wachsen und Weichen - Ziele zukünftiger Struktur- und Agrarentwicklung 3.1 Theologische Perspektiven und ethische Kriterien 3.2 Ziele zukünftiger Agrarpolitik und die Leistungsfähigkeit einer bäuerlich geprägten Landwirtschaft 3.3 Perspektiven der Sozialverträglichkeit für landwirtschaftliche Problembetriebe 3.4 Grundpositionen in der EG-Agrarreformpolitik 3.5. Auswirkungen der Reformvorschläge 3.6 Empfehlungen für flankierende Maßnahmen 4. Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie - Zielkonflikte und Lösungsversuche _ . . 4. 1. Das Verhältnis des Menschen zur Natur 4.2. Landwirtschaftsstrukturen, Landbewirtschaftung und Artenschutz 4. 3. Tierhaltung 4.4. Düngung und Pflanzenschutz 4. 5. Kreislauf-Wirtschaft und Alternativen im Landbau 4.6. Empfehlungen für die Landwirte, Verbraucher, Agrarpolitiker und die Forschung 5. Landwirtschaft im Spannungsfeld von Hunger und Überfluß - Wechselwirkungen zwischen Entwicklungspolitik und Agrarpolitik 5. 1. Hunger und Unterentwicklung als Herausforderung 5.2. Verschiedene Ursachen des Hungers 5 .3 Auswirkungen von Agrarexporten 5.4. Weltweite Solidargemeinschaft 6. Agrarische, ökologische und entwicklungspolitische Anliegen der Denkschrift - Zusammenfassung der Grundforderungen 6.1. Grundprobleme 6.2. Grundforderungen 7. Kirchliche Arbeit auf dem Lande - Herausforderungen und Konsequenzen 7.1. Mitverantwortung und Dienst der Kirche im Strukturwandel des Dorfes 7.2. Gottesdienst, Seelsorge und gesellschaftspolitisches Engagement Mitglieder und ständige Gäste der Kammer der EKD für soziale Ordnung . Anhang: Ausgewählte Schaubilder |
 |
Frieden wahren, fördern und erneuern Gütersloher Verlagshaus, 1984, 96 Seiten, 125 g, kartoniert, 3-579-01975-9 3,00 EUR |
Eine Denkschrift der Evangelischen
Kirche in Deutschland 6. Auflage, ergänzt um das Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Friedensdiskussion im Herbst 1983. Die Sorge um den Frieden bestimmt gegenwärtig das Bewußtsein vieler Menschen. Akute Krisen in verschiedenen Teilen der Welt haben Kriegsfurcht ausgelöst. Die'Spannung zwischen den großen Machtblöcken ist gewachsen. Die Rüstung, die der Sicherung des Friedens dienen soll, wird immer mehr auch als Gefährdung des Friedens angesehen. Die Kosten, die sie verschlingt, stehen in einem schreienden Mißverhältnis zum Elend in der Welt. Aber der Weg zu ihrer Verminderung ist politisch umstritten. Eine tiefgreifende Kontroverse über die Frage, wie Christen dem Frieden dienen sollen, durchzieht auch unsere Kirche. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland ist seiner Kammer für Öffentliche Verantwortung dankbar, daß sie sich der schwierigen Aufgabe gestellt hat, für diese Auseinandersetzung eine Orientierungshilfe zu erarbeiten. Die Mitglieder der Kammer haben aus den gegensätzlichen Positionen dieser Kontroverse heraus einen Konsens darüber erzielt, was in der Kontinuität des Zeugnisses unserer Kirche für den Frieden gegenwärtig nach den verschiedenen Seiten zu bedenken ist. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat sich diesen Konsens zu eigen gemacht. Es versteht sich von selbst, daß dies sowohl in der Kammer als auch im Rat eine hohe Bereitschaft zum Kompromiß verlangte. Für das Zeugnis und den Dienst der Kirche für den Frieden ist es entscheidend wichtig, daß die Gegensätze in der ethischen und politischen Beurteilung aufeinander bezogen werden. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hofft, mit dieser Denkschrift hierfür eine Hilfe leisten zu können und auf diese Weise das christliche Zeugnis und den christlichen Dienst für den Frieden zu fördern. Oktober 1981, D. Eduard Lohse, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland |
 |
Weltbevölkerungswachstum als Herausforderung an die Kirchen
Eine Studie der Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschalnd für Kirchlichen Entwicklungsdienst Gütersloher Verlagshaus, 1984, 54 Seiten, 100 g, geheftett, 3-579-01986-4 3,00 EUR |
Vorwort Die Zahl der Menschen auf der Welt wächst heute in einem Maße wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Viele Menschen unter uns sprechen darum von einer ››Bevölkerungsexplosion« und sind besorgt, die Menschheit könnte an Übervölkerung und daraus resultierender Aggressivität zugrundegehen. Andere hingegen halten das für eine unzulässige Dramatisierung und befürchten, daß damit abgelenkt werden könnte von anderen Aspekten des Nord-Süd-Verhältnisses, die die Industrieländer viel unmittelbarer betreffen. Tatsächlich kann der Hinweis auf das Bevölkerungswachstum in den Entwicklungsländern dazu verleiten, bei der Einschätzung der Entwicklungsprobleme der Dritten Welt zu vereinfachenden und darum irreführenden Schlußfolgerungen zu gelangen. Wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, daß dieses Thema in der Entwicklungsdiskussion der evangelischen Kirche und ihrer Hilfswerke bisher nur mit großer Zurückhaltung aufgegriffen worden ist. Aber es dient einer sachgemäßen Bewertung der Problematik des Bevölkerungswachstums nicht, wenn dieses Thema tabuisiert wird. Es bedarf vielmehr dringend einer sachlichen Erörterung. Denn die erheblichen Folgelasten, die das zu erwartende Wachstum der Weltbevölkerung mit sich bringt, drohen alle Bemühungen um eine Verbesserung der Lebensbedingungen in den Entwicklungsländern zunichte zu machen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) begrüßt es darum, daß die Kammer der EKD für Kirchlichen Entwicklungsdienst dieses Thema aufgegriffen hat. Wer über die vielen Fragen, die sich im Zusammenhang der Bevölkerungsentwicklung stellen, auch nur in etwa unterrichtet ist, wird nicht verwundert sein, daß die von der Kammer vorgelegte Studie nicht mit Lösungen aufwarten kann, die den Anspruch erheben, die Probleme der Bevölkerungsentwicklung über kurz oder lang aus der Welt zu schaffen oder unzähligen Menschen auf der Erde in absehbarer Zeit ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Tatsächlich gibt es keine Lösung, die unter Einsatz spektakulärer Mittel dafür sorgt, daß alles sich zum Guten wendet. Denn in erster Linie geht es nicht um neue Mittel und Methoden, sondern darum, daß die Menschen in Nord und Süd sich in ihrer Lebenseinstellung neu orientieren, um den Herausforderungen einer sich ständig verändernden Situation Rechnung tragen zu können. Zu einer solchen Neuorientierung möchte die Studie beitragen. Sie maßt sich allerdings nicht an, Christen und Kirchen in der Dritten Wfelt Ratschläge zur Bewältigung der Bevölkerungsproblematik in ihren Ländern zu erteilen. Als Bürger eines Landes, in dem jeder einzelne die begrenzten Vorräte der Erde stärker belastet als 50 Menschen in Afrika, haben wir dazu nicht das moralische Recht. Die vorliegende Studie richtet sich vielmehr an die Glieder unserer eigenen Kirche und möchte ihnen dazu verhelfen, die vielschichtigen Zusammenhänge, in denen sich die Bevölkerungsentwicklung vollzieht, besser zu verstehen. Sie enthält wichtige Informationen zur Bevölkerungsproblematik (Teil I), beschreibt zunachst die Einstellungen und Überzeugungen anderer Religionen und danach die Positionen anderer Kirchen in der Ökumene (Teil II) und nennt die Grundlagen, die für die Standortklärung des evangelischen Christen in diesen Fragen wichtig sind (Teil IH). Damit will die Studie nicht abschließende und erschöpfende Antworten einer kirchlichen Lehrmeinung anbieten, sondern Denkanstöße geben, die zu eigener, begründeter Urteilsbildung anregen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hofft, daß kirchliche Gemeinden und Gruppen in unserem Lande die Studie in diesem Sinne eifrig nutzen. Hannover, im Juni 1984 D. Eduard Lohse, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland |
 |
Möglichkeiten und Grenzen eines politischen Zeugnisses der
Kirche und ihrer Miitarbeiter Ein Votum des Theologischen Ausschusses der Arnoldshainer Konferenz Neukirchener Verlag, 1982, 24 Seiten, 40 g, Geheftet, 3-7887-0711-9 2,00 EUR |
Vorwort Seit Jahren kommt der Streit in der Kirche und in der Öffentlichkeit nicht zur Ruhe, ob die Kirchen, ihre Gemeinden, Mitarbeiter und Mitglieder sich zu Recht oder zu Unrecht in gesellschaftlichen Fragen engagieren. Unser öffentliches Leben bietet mit seinen im Großen wie im Kleinen ausgetragenen Konflikten reichlich Gelegenheit zu solcher Auseinandersetzung: Arbeitslosigkeit, Ausländerprobleme, Umweltzerstörung, Rassismus, Friedensfragen, Probleme der Dritten Welt sind geselschaftliche Fragen, die von vielen auch als Herausfordrung an die Kirchen angesehen werden und die es diesen nicht erlauben, sich auf die Pflege eines innerkirchlichen Bereiches oder des privaten Glaubenslebens zurückzuziehen. Es ist richtig: Das Evangelium spart den gesellschaftlichen Alltag sowenig aus wie den privaten. Aber sind Demonstrationen im Talar, Gottesdienste auf besetztem Gelände und die Teilnahme an Hausbesetzungen die rechten Mittel kirchlichen Zeugnisses und Dienstes? Die Kirchenleitungen haben es mehr und mehr empfunden, daß die vorhandenen Ordnungen nicht ausreichen, um diese Konflikte innerhalb der Kirche und zwischen Gesellschaft und Kirche zu lösen. Diese Situation veranlaßte die Arnoldshainer Konferenz, ihren Theologischen Ausschuß mit der Ausarbeitung einer Arbeitshilfe über »Möglichkeiten und Grenzen eines politischen Zeugnisses der Kirche und ihrer Mitarbeiter« zu beauftragen. Dabei war nicht außer acht gelassen, daß diese Problematik in den letzten Iahren bereits vielfach verhandelt worden ist, darunter z.B. in der Denkschrift der EKD von 1970 »Aufgaben und Grenzen kirchlicher Äußerungen zu gesellschaftlichen Fragen« und in dem Votum aus der EKU von 1974 »Zum politischen Auftrag der christlichen Gemeinde. Bannen II«. Ietzt aber richtete sich die Erwartung auf die Erarbeitung von Gesichtspunkten, in denen die Kirchenleitungen übereinstimmen und die ihnen bei Gesprächen mit kirchlichen und außerkirchlichen Partnern eine Hilfe sein können. Deshalb waren-nicht so sehr weitere theoretische Abhandlungen als vielmehr möglichst praxisnahe Erwägungen erwünscht. Daß die grundsätzliche Frage- nach dem Recht oder Unrecht eines politischen Zeugnisses von seiten der Kirchen nicht iibergangen werden konnte, war allen Beteiligten selbstverständlich. Wenn das Votum pointiert von Pfarrem spricht, so nicht, weil der Ausschuß die Verantwortung anderer Mitarbeiter in diesem Zusammenhang nicht bedacht hätte, sondern weil Pfarrer durch ihre Ordination für die Verkündigung des Wortes Gottes in Verantwortung genommen sind und weil sie mit ihren Aktivitäten sehr schnell in das Blickfeld der Öffentlichkeit geraten und ›› die Kirche« mit ihnen identifiziert wird. Das Votum strebt keine Veränderung bestehender Gesetze an. Es will vielmehr in den Blick rücken, worauf bei entstehenden Spannungen zu achten ist und wie der Versöhnungsauftrag der Kirche verwirklicht werden will, im ernsthaften Dialog unterschiedlicher Meinungen und im Hören auf die biblische Botschaft. Die Vollkonferenz hat das Votum am 30. April 1982 entgegengenomrnen und leitet es nun den Kirchen mit der Bitte zu, es allen Gemeinden und Mitarbeitern bekanntzumachen, damit es Leitungen, Gemeinden, Mitarbeitern und betroffenen Gemeindegliedern helfen möge, in den Konflikten unserer Zeit miteinander umzugehen, wie es ihrer Gliedschaft in der Kirche Iesu Christi entspricht. D. Helmut Hild, Vorsitzender der ARNOLDSHAINER KONFERENZ |
 |
Das Bekenntnis zu Jesus Christus und die Friedensverantwortung
der Kirche Eine Erklärung des Moderamens der Reformierten Bundes Gütersloher Verlagshaus, 1982, 40 Seiten, 50 g, geheftet, 3-579-01979-1 2,50 EUR |
Die Erklärung ist der Brief des Moderamens an die Gemeinden, Kirchen und
Einzelmitglieder des Reformierten Bundes von Oktober 1981 im Anhnag
beigefügt. Der Reformierte Bund, der Zusammenschluß reformierter Kirchengemeinden, Gemeindeverbände, Synodalverbände, Kirchen und Einzelpersonen in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West), hat durch sein Leitungsgremium, das Moderamen, im Oktober 1981 einen Brief an seine Mitglieder versandt. Dieses Schreiben, das zur Friedensfrage Stellung nimmt, wird in dieser Publikation erneut vorgelegt. Im April 1982 beauftragte die Hauptversammlung des Reformierten Bundes einen Ausschuß, »unter Zugrundelegung der bisher vorliegenden reformierten Stellungnahmen zur Friedensfrage« eine Vorlage zum Schwerpunktthema ››Frieden« für die Vollversammlung des Reformierten Weltbundes in Ottawa (August 1982) zu erarbeiten. Das Ergebnis dieser Arbeit, in der Pfarrer Dr. Rolf Wischnath federführend tätig war, wurde vom Moderamen am 12. Juni 1982 einstimmig angenommen und wird hiermit publiziert. Problernatische ››Ausgewogenheit«, Zweideutigkeit und Unentschlossenheit in der Evangelischen Kirche in Deutschland haben dieses Sondervotum herausgefordert. Wir wissen uns aufgerufen, der alles Leben zerstörenden Gotteslästerung atomarer Bewaffnung mit dem Bekenntnis des Gkmløens entgegenzutreten. Die nukleare Vorbereitung des universalen Holocaust ist kein ››Adiaphoron« (entscheidungsfreies Thema), sie geschieht im Gegensatz zu den Grundartikeln des christlichen Glaubens. In dieser Einschätzung stimmen wir überein mit der Denkschrift »Kirche und Kernbewaffnung« der Nederlandse Hervormde Kerk, der wir uns dankbar verbunden wissen. Die Friedensfrage ist eine Bekenntnisfrage. Als Deutsche leben wir im Brennpunkt der Spannungen zwischen den beiden großen militärischen Machtblöcken, in einer Zone größter Atomwaffendichte der Welt, als Abschußrampe und Zielscheibe »eines begrenzten atomaren Krieges«, den Politiker schon einkalkulieren. Aus dieser gefährdeten Situation erheben wir unsere Stimme und bitten die Brüder und Schwestern in aller Welt, mit uns entschlossen dem heraufkommenden Grauen der Vernichtung entgegenzutreten und sich mit allen denen zu verbünden, die das, was wir als Christen ››Gotteslästerung« nennen, als »Logik des Wahnsinns« verurteilen. Die atomare Rüstung, die die Politiker noch mit der Notwendigkeit einer ››Verteidigung« zu begründen versuchen, ist längst in den Bann ratloser Angst, weltweiter Schrecken und kriegerischer Ausbrüche gefallen. Hans-Joachim Kraus, Moderator |
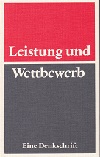 |
Leistung und Wettbewerb Sozialethische Überlegungen zur Frage des Leistungsprinzips und der Wettbewerbsgesellschaft Gütersloher Verlagshaus, 1979, 88 Seiten, 110 g, Kartoniert, 3-579-04293-9 3,00 EUR |
Eine Denkschrift
der Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland für
soziale Ordnung Geleitwort Das Problem der Leistung gehört zu den bedrängenden Fragen unserer Zeit. In vielen Bereichen der Gesellschaft herrscht Leistungsdruck. Übertriebenes Leistungsdenken hat in unserer Wettbewerbsgesellschaft unheilvoll wirkende Mechanismen aufkommen lassen. Die Kritik am Leistungsprinzip ist daher weit verbreitet; sie wird freilich nicht immer sachlich vorgetragen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat die Kammer für Soziale Ordnung beauftragt, die Probleme von Leistung und Wettbewerb theologisch und sozialethisch im Zusammenhang zu untersuchen. Die vorliegende Denkschrift ist das Ergebnis mehrjähriger Arbeit. In ihr werden die grundlegenden Fragen dieses Themenkreises im Blick auf die Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung behandelt und aus christlicher Sicht beurteilt. Die Denkschrift bewertet auch Alternativen. Der begrenzte Umfang ließ es nicht zu, alle Gesichtspunkte so ausführlich zu behandeln, wie es wünschenswert erscheinen mag. Dies gilt z. B. für die Probleme des internationalen Wettbewerbs, insbesondere in den Beziehungen zwischen den Industriestaaten und den Entwicklungsländern. Als Diskussionsbeitrag will die Denkschrift den evangelischen Christen und Gemeinden helfen, sich in den sozialethischen und sozialpolitischen Auseinandersetzungen unserer Zeit zu orientieren und sich eine gemeinsame Meinung zu bilden. Der Rat der EKD hofft darüber hinaus, daß sie nachstehenden Überlegungen auch außerhalb der Kirche, bei den Kritikern wie den Verteidigern der bestehenden Sozial- und Wirtschaftsordnung, Beachtung finden und das Nachdenken über den Menschen befruchten. Denn den Menschen zu sehen und seine Würde zu achten, ist heute zu einer vordringlichen gemeinsamen Aufgabe geworden. Stuttgart, im Oktober 1978 D. Helmut Claß Landesbischof, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland |
 |
Rolf Rendtorff Arbeitsbuch Christen und Juden Zur Studie des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland Gütersloher Verlagshaus, 1979, 288 Seiten, 410 g, kartoniert, 978-3-579-04745-4 8,00 EUR |
Das Judentum in seiner Geschichte 16 I. Gemeinsame Wurzeln 31 II. Das Auseinandergehen der Wege 109 III. Juden und Christen heute 181 ausführliches Inhaltsverzeichnis zur Seite Christentum / Judentum |
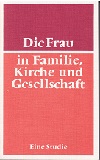 |
Die Frau in Familie, Kirche und Gesellschaft Eine Studie zum gemeinsamen Leben von Frau und Mann Gütersloher Verlagshaus, 1979, 191 Seiten, 180 g, kartoniert, 3-579-04779-5 3,00 EUR |
Vorwort Das Verhältnis von Frau und Mann ist eine elementare Lebensfrage. Es war stets dem geschichtlichen Wandel unterworfen. Es berührt den einzelnen ebenso wie das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Veränderungen stoßen auf unterschiedliche Lebenssituationen, Anschauungen und Haltungen. Jeder ist betroffen, kaum einer in derselben Weise. Das erklärt die Leidenschaft der Diskussion dieses Themas oder ihre Verweigerung - auch heute. Verkündigung und Dienst der Kirche können und dürfen hierbei nicht unbeteiligt bleiben. Geht es einmal darum, Freiheit und Bindung der Botschaft des Evangeliums auch für die gegenwärtig sich wandelnde Situation von Frau und M_ann zu erkennen und bewußt zu machen, hat die Kirche andererseits für ihren eigenen Bereich in Predigt, Seelsorge, Unterricht und Ordnung die daraus sich ergebenden Folgerungen zu ziehen. Die Vielfalt der Lebensumstände und der in unserer Gesellschaft vertretenen Anschauungen, nicht zuletzt die der vorfindlichen theologischen Positionen läßt weder eine hurtige, noch eine umfassende, gar eine gleichsam „kirchenamtliche“ Patentlösung zu. Es geht vielmehr darum, für unsere heutige Situation sorgfältig und neu darauf zu hören, was die biblische Botschaft über Sinn und Ziel des menschlichen Lebens, was sie über das Miteinander von Frau und Mann aussagt, wie es auszulegen und in die Praxis unseres Handelns zu übertragen ist. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat einen Ausschuß beauftragt, die aktuellen Fragen zur Situation der Frau in Familie, Kirche und Gesellschaft zu untersuchen und Gesichtspunkte für individuelle, gesellschaftliche und kirchliche Lösungen zu entwickeln. Aus der Arbeit dieses Ausschusses ist die vorliegende Studie erwachsen, die wesentliche Erkenntnisse aus der innerdeutschen, der internationalen und der ökumenischen Diskussion einbezogen hat. Hiermit wird ein Beitrag zum Gespräch in Kirche und Öffentlichkeit vorgelegt. Dem Leser dürfte nicht entgehen, daß neben Aussagen, die eine breite Zustimmung finden werden, auch Widersprüche deutlich geblieben sind. Dies geschah mit Willen, denn es spiegelt unsere heutige Lage. Hinter allem steht die Hoffnung, den Meinungsaustausch im Für und Wider weiterzuführen, einzelnen Lesern und Gruppen Anstöße für die Klärung der eigenen Position zu vermitteln - vielleicht gerade dort, Wo es auf den einzelnen »anstößig« Wirkt. Wer stets nur die eigene Meinung bestätigt finden möchte, sollte das Buch aus der Hand legen. Wer bereit ist, sich auf das Nach-Denken fremd anmutender, ja, auch beunruhigender Einstellungen einzulassen, wird selbst dann Gewinn davontragen, wenn er nicht zustimmen kann. Dem Ausschuß ist für seine Arbeit zu danken. Er wollte und konnte mit der Studie keinen Schlußpunkt setzen. Im Gegenteil. Denn das Verhältnis zwischen Frau und Mann ist und bleibt eine elementare Lebensfrage - heute und in Zukunft. Hannover, im April 1979 Walter Hammer, Präsident der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland |
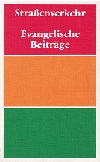 |
Straßenverkehr Evangelische Beiträge. Aktueller Kommentar der Kammer der EKD für soziale Ordnung. Verantwortung für den Straßenverkehr. Gütersloher Verlagshaus, 1977, 112 Seiten, 100, kartoniert, 3-579-04590-3 3,10 EUR |
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland erteilte
der Kammer der EKD für soziale Ordnung den Auftrag, in Zusammenarbeit
mit der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Verkehrsfragen ein Papier
zu erarbeiten, das die Gefährdung von Mensch und Gesellschaft im
Straßenverkehr darstellt und dabei auch die umfassenderen Zusammenhänge
berücksichtigt. Die Kammer hat bei ihrer Arbeit feststellen. müssen, daß die hohe Zahl der Verkehrsopfer in der Bundesrepublik weitgehend nicht mehr als erschreckend empfunden wird. Wir alle stehen in der Gefahr, uns daran zu gewöhnen und den Verlust an Leben durch den Straßenverkehr als unvermeidliches Schicksal hinzunehmen. Müssen wir Christen dies nicht als Herausforderung erkennen, gerade weil es unser Auftrag ist, menschliches Leben vor Gott zu verantworten? Sicher ist es nicht einfach, dieser Verantwortung angemessen nachzukommen. Trotz mancher Erfolge bei dem Versuch, diesen Gefährdungen des Menschen im modernen Straßenverkehr zu begegnen, sind auch die Experten weithin ratlos. Dabei mangelt es nicht an Vorschlägen. Die eigentliche Schwierigkeit liegt in den vielfältigen Ursachen der Verkehrsunfälle - und hier sind vor allem diejenigen Ursachen zu nennen, die im Verhalten des Menschen und in den Strukturen und Verhaltensmustern unserer Gesellschaft liegen. Die in dieser Schrift vorliegenden Beiträge wollen eine Hilfe und Orientierung für Christen sein und die Richtung angeben, in der nach weiteren Lösungen zu suchen ist. Die Ausarbeitung «Verantwortung für den Straßenverkehr» ist ein «aktueller Kommentar» der Kammer der EKD für soziale Ordnung. Sie wurde unter Mitarbeit der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Verkehrsfragen verfaßt und gebilligt, vom Rat der EKD im Frühjahr 1977 beraten und zustimmend zur Kenntnis genommen. Der aktuelle Kommentar ist so angelegt, daß nach einer knappen Einführung (<<Problemskizze››) mit einigen. «kritischen Fragen» zum Denken angeregt und die Problematik sachlich entfaltet wird (<<Anleitung zum Nachdenken über . . .››). Es werden keine abschließenden Lösungen vorgeschlagen, auch wird nicht versucht, den Standort der evangelischen Christen in dieser Frage all gemeingültig zu bestimmen. Vielmehr werden aus der Sicht der Verfasser einige Denkanstöße vermittelt. Diese Ausarbeitung eignet sich besonders als Diskussionspapier für interessierte Kreise. Der zweite Beitrag in dieser Schrift, <<Straßenverkehr, Gesellschaftsstruktur und soziales Verhalten››, wurde von einem Autorenteam unter Leitung des Erlanger Sozialethikers Prof. Dr. Hans Schulze verfaßt. Er war Ausgangsbasis der Arbeit, die zu dem «aktuellen Kommentar» führte. Diese wissenschaftliche Studie nennt noch weitere wesentliche Gesichtspunkte und vervollständigt so den Problemhorizont. Sie geht ausführlich auf anthropologische, sozialpsychologische, politische, rechtliche, technische und theologisch-ethische Fragen des Straßenverkehrs ein. Dieser systematische Entwurf wird - darauf hat die Kammer der EKD für soziale Ordnung ausdrücklich hingewiesen - allen denen empfohlen, die zum persönlichen Studium, zur Vorbereitung von Gesprächskreisen in der Gemeinde, zur theologischen und verkehrswissenschaftlichen Vertiefung oder für die Zurüstung zum Unterricht eine ausführliche Darstellung der Verkehrsproblematik in sozialethischer Sicht wünschen. Hannover, im Juni 1977 Walter Hammer, Präsident der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland |
 |
Evangelische Beiträge zur Bildungspolitik Herausgegeben von der Kirckenkanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland Mit einem Geleitwort von Landesbischof Helmut Claß Gütersloher Verlagshaus, 1976, 87 Seiten, 110 g, kartoniert, 3-579-03590-8 3,00 EUR |
Geleitwort Bildungspolitik muß versuchen, im Blick auf die Gesellschaft von morgen .iem Wohl aller zu dienen. Heute sind die Systeme institutionalisierter Bildung weltweit in einem Umbruch begriffen. Im November 1975 wurde auf der 5. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Nairobi eine »wachsende Diskrepanz zwischen den durch das Bildungswesen vermittelten Fähigkeiten und den wirklichen Bedürfnissen« festgestellt. Mit diesem Problem hat sich jede Bildungsplanung verantwortlich auseinanderzusetzen. Auf einem Symposion hat sich im Herbst vergangenen Iahres der vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland berufene Bildungspolitische Ausschuß eingehend mit der bildungspolitischen Situation in unserem Land beschäftigt. Die dieser Klausurtagung zugrunde liegenden Texte werden, ergänzt durch zwei Diskussionsbeiträge, in der vorliegenden Schrift dokumentiert. Neben einer kritischen Bilanz der eigenen Bemühungen enthalten sie Überlegungen zu grundsätzlichen Fragen und Vorschläge fiir das Handeln der Evangelischen Kirche in der gegenwärtigen Bildungspolitik. In einer Stellungnahme »zur schulpolitischen Situation in der BRD« vom 24. 10. 1975 hat der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland für diesen besonderen Bereich der Bildung auf einige unaufgebbare Grundorientierungen hingewiesen. Die Dringlichkeit und Tragweite bildungspolitischer Entscheidungen steht außer Frage. Angesichts des eingeschränkten Spielraums für die Durchführung neuer Bildungskonzepte muß sich jede einzelne Maßnahme daran messen lassen, ob sie den einzelnen als Glied seiner Gesellschaft befähigt, die absehbaren weltweiten Herausforderungen von morgen zu bestehen. Ich hoffe, daß die in diesem Heft zusammengefaßten Texte dazu beitragen, die anstehenden Gespräche über Grundlagen und Ziele der Bildung auf kirchlicher wie staatlicher Ebene zu fördern und zu vertiefen. Stuttgart/Hannover, 31. März 1976 D. Helmut Claß, Landesbischof und Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland |
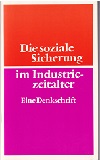 |
Die soziale Sicherung im Industriezeitalter Eine Denkschrift der Kammer für soziale Ordnung der EKiD. Herausgegeben vom Rat der EKiD Gütersloher Verlagshaus, 1973, 60 Seiten, 70, geheftet, 3-579-04580-6 2,00 EUR |
Vorwort Jeder Mensch ist zur Sicherung seines Lebens auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Dies gilt insbesondere in der Kindheit, im hohen Alter sowie in Fällen der Krankheit, beschränkter Leistungsfähigkeit und besonderer Notlagen, die Menschen daran hindern, sich durch eigene Arbeitzu versorgen. In früheren Zeiten gewährte vor allem die Solidarität der Familie, der Sippe, der Nachbarschaft und kleinerer Gemeinschaften dem einzelnen soziale Sicherung. Im Industriezeitalter bestehen mit steigender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zwar größere Möglichkeiten, jedermann mit dem Nötigen zu versorgen. Seit einem Jahrhundert sind aber tiefgreifende Wandlungen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen eingetreten, so daß dieser Schutz nicht mehr in gleicher Weise gesichert ist. Diese Veränderungen werden sich in der Zukunft möglicherweise noch verstärken. Daher ist eine soziale Sicherung nur noch dann gewährleistet, wenn systematisch umfassende gesellschaftliche Maßnahmen und personale Hilfen entwickelt werden und in der richtigen Weise ineinandergreifen. Bei einer Prüfung dieser Frage zeigt es sich, daß wir in der Bundesrepublik Deutschland zwar ein hochentwickeltes System sozialer Sicherungen haben. An wichtigen Stellen versagen aber gleichzeitig sowohl die gesellschaftlichen Einrichtungen als auch der persönliche Einsatz von Mitmenschen. Die hohe Bewertung von Arbeit und Leistung führt dazu, daß diese Schwächen unserer Gesellschaft weithin nicht klar erkannt werden. Die fortlaufenden wirtschaftlichen und sozialen Veränderungsprozesse verursachen darüber hinaus neue menschliche Notlagen. Dies ist vor allem der Grund für die Tatsache, daß es bei uns trotz steigenden Lebensstandards weiter bittere Notstände und Ungerechtigkeiten gibt. Der Rat der EKD ist mit den Verfassern dieser Denkschrift der Überzeugung, daß noch eine Reihe weiterer Fragen auf dem Gebiet der sozialen Sicherung im Industriezeitalter mitbedacht werden müßte. Die laufende Verbesserung der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und überhaupt das weite Feld der leiblichen und seelischen Gefährdungen, die heute den Menschen bedrohen, müßten in einer umfassenden Würdigung der sozialen Sicherung berücksichtigt werden. Nicht weil diese Fragen weniger wichtig wären, sondern weil sie eine ausführlichere Behandlung erfordert hätten, als es im Rahmen dieser Denkschrift möglich ist, sind sie in den folgenden Kapiteln nicht besprochen. Die vorliegende Denkschrift versucht, bei Anerkennung der Leistungen unseres sozialen Sicherungssystems dessen Mängel aufzuzeigen. Es sollen Anstöße zu einer Neubesinnung darüber gegeben werden, wie heute soziale Verantwortung wahrzunehrnen ist. Die Denkschrift weist darum auch auf diejenigen Bereiche hin, in denen möglicherweise einschneidende Maßnahmen erforderlich sind. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung sollte dahin gelenkt werden, daß befriedigende Verhältnisse auch denen verschafft werden, deren Lebensbedingungen mangelhaft oder ungesichert sind. Die Verfasser der Denkschrift sind sich darüber im klaren, daß damit eine schwierige Aufgabe bezeichnet wird, deren Erfüllung nur schrittweise gelingen kann und das Zusammenwirken aller Beteiligten erfordert. Der Rat der EKD übergibt diese Arbeit der Kammer für soziale Ordnung der Öffentlichkeit in der Hoffnung, daß die hier vertretenen Gesichtspunkte und Ziele eine gebührende Beachtung finden. Den kirchlichen Gemeinden will die Denkschrift zu einem Nachdenken über ihre Aufgaben und Möglichkeiten verhelfen. Neue Formen sozialer Verantwortung und persönlichen Einsatzes für die Mitmenschen müssen gesucht Werden, um heute das Gebot Christi »Liebe deinen Nächsten« zu verwirklichen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland D. Dietzfelbinger, Berlin, im April 1975 |
 |
Hans Schulze Ethik im Dialog Kommentar zur Denkschrift der EKiD. Aufgaben und Grenzen kirchlicher Äußerungen zu gesellschaftlichen Fragen. Gütersloher Verlagshaus, 1972, 172 Seiten, 260 g, kartoniert, 978-3-579-03554-3 9,00 EUR |
Ethik im Dialog Einführung 7 Themenverzeichnis 12 Denkschrifl mit Kommentar: Einleitung 15 I Warum soll und muß sich die Kirche zu politischen und gesellschaftlichen Fragen äußern? 34 II Wer redet? . 71 III. Zu wem wird gesprochen? . 100 IV. Wann soll sich die Kirche äußern? 115 V. Gesichtspunkte zur Erarbeirung kirchlicher Stellungnahmen 128 VI. Aufnahme und Auswirkung kirchlicher Kußerungen in der Gemeinde und öffentlichkeit 149 Literaturverzeichnis 155 Fremdwortverzeichnis 169 Die Denkschrift Aufgaben und Grenzen kirchlicher Äußerungen zu gesellschaftlichen Fragen ist nicht mehr lieferbar |
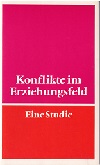 |
Konflikte im Erziehungsfeld Am Beispiel politischer Auseinandersetzungen in der Schule. Eine Studie der Jugendkammer der EKiD Gütersloher Verlagshaus, 1972, 56 Seiten, 70, Geheftet, 3-579-04552-0 2,00 EUR |
Vorwort Die Jugendkanuner der Evangelischen Kirche in Deutschland legt mit dieser Studie ein Ergebnis ihrer im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland durchgeführten Untersuchungen zu den Iugendprotesten und Konflikten im Erziehungsbereich vor. Die Studie steht in sachlichem Zusammenhang mit der Grundsatzerklärung, in der die Synode der EKD im November 1971 in Frankfurt festgestellt hat: »Die Mitverantwortung der Kirche für den Menschen und seine Zukunft im Rahmen der Bildungsplanung« - man muß hinzufügen: und ebenso der Erziehungspraxis - ››ist in der ihr aufgetragenen Botschaft begründet. Diese Botschaft sagt uns, daß Gott sich in Iesus Christus des Menschen angenommen hat und daß daruin jeder Mensch vor Gott wertgeachtet ist, ungeachtet seiner Begabung und Leistung. Sie befreit Lernende und Lehrende zu selbst- und mitverantwortlicher Mündigkeit wie zu kommunikativem Miteinander. Darum ist die Kirche aufgerufen, für den Menschen, für seine Würde und Redrte, für Erziehung und Bildung aller, insbesondere der Benachteiligten, einzutreten. Dies schließt die Mitverantwortung für nüditerne Analyse und sachgemäße Gestaltung der entsprechenden Strukturen ein.<< In diesem Licht versteht die Iugendkammer ihre Analyse der Erziehungskonflikte und den daraus erwachsenden Entwurf einer neuen gemeinsamen Praxis. Sie ist sich dessen wohl bewußt, daß diese Studie einen theologischen Horizont hat, auch wenn er nur an wenigen Stellen angedeutet wird. Die Kammer Will mit ihrem Beitrag zu einem vertieften Verständnis der Konflikterfahrungen und zu einer neu zu begründenden Verständigungsbereitschaft im pädagogischen Bereidi helfen. Dazu gehört, daß im gegenwärtigen Spannungsfeld der Erziehung das Gespräch über die Sache des Glaubens neu eröffnet wird. In dieser Absicht waren sich die Mitglieder der Kammer einig, auch wenn nicht jede Einzelaussage der Analyse und Beurteilung einhellige Zustimmungn gefunden hat. Nachdem der Rat der EKD die Studie am 21. April 1972 zur Veröffentlichung freigegeben hat, möchte die Jugendkammer sie zur offenen Diskussion stellen. Sie verbindet damit die Hoffnung, daß die Studie vor allem erzieherisch tätigen und interessierten Kreisen als Grundlage, Anregung und Ermutigung zu weiterführenden Gesprächen dienen wird. Hannover und Rummelsberg, den 26. Mai 1972 Jugendkammer der Evangelischen Kirche in Deutschland Neukamm Vorsitzender |
 |
Sport Mensch und Gesellschaft Eine sozialethische Studie der Kammer für soziale Ordnung der EKiD. Herausgegeben vom Rat der EKiD Gütersloher Verlagshaus, 1972, 40 Seiten, 55 g, geheftet, 3-579-04560-1 2,60 EUR |
In den zwischen Kirche und Sport in der Bundesrepublik
Deutschland geführten Gesprächen ist immer wieder von seiten der
Sportbewegung der Wunsch geäußert worden, die Kirche möge an der Klärung
wichtiger sozialethischer Fragen des heutigen Sports mitarbeiten. Schon
1966 hat der Deutsche Sportbund in seiner »Charta des Deutschen Sports«
auch die Kirchen zur Partnerschaft aufgerufen. Der Rat der EKD beauftragte deshalb die ››Kammer für soziale Ordnung<<, eine Kommission zu bilden. Diese Kommission hat in Zusammenwirken mit der Kammer und einer Anzahl Weiterer sachkundiger Persönlichkeiten die hier vorliegende Äußerung erarbeitet. Damit soll keinesfalls ein abschließendes kirchliches Won zu den dabei erörterten Fragen gesagt sein. Vielmehr handelt es sich um einen Gesprächsbeitrag zur gegenwärtigen Diskussion über den Sport. Die Studie soll dazu mithelfen, daß Barrieren durchbrochen werden, die den Sport an der Erfüllung wichtiger Funktionen für die Menschen und die Gesellschaft hindern. Es verbindet sich damit die Hoffnung, daß dadurch nicht nur zwischen leitenden Gremien, sondern auch in den örtlichen Gemeinden wechselseitige Gespräche im Geist freimütiger Kritik und gegenseitiger Hörbereitschaft zustandekommen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland D. Dietzfelbinger Berlin, im März 1972. |
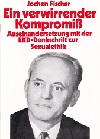 |
Jochen Fischer Ein verwirrender Kompromiß Auseinandersetzung mit der EKD - Denkschrift zur Sexualethik Aussaat, 1971, 48 Seiten, 48 Seiten, geheftet, DIN A5 3-7615-0085-8 4,00 EUR |
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem WEISSEN
KREUZ (Sexualethik und Seelsorge) Zu dem Buch: ln dieser temperamentvollen Streitschrift weht etwas vom Kampfgeist der Lutherzeit. Endlich wieder wagt es ein Mann von wissenschaftlichem Rang und öffentlicher Geltung, ein unüberhörbares Nein zu einer Verlautbarung seiner Kirche zu sagen. Worum geht es dabei? Um nicht mehr und nicht weniger als um die Beziehung von Mann und Frau, um die Geschlechtlichkeit mit allen darum kreisenden Problemen - um ein fundamentales Thema unserer Tage also. Fünf Jahre lang hat sich eine vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland bestellte Kommission gemüht, zu diesem Komplex ein wegweisendes und hilfreiches Wort zu sagen. An der nunmehr veröffentlichten „Denkschrift zu Fragen der Sexualethik“ hat der Verfasser der vorliegenden Stellungnahme anfangs selber mitgearbeltet, sich dann aber aus grundsätzlichen Erwägungen aus der Mitwirkung zurückgezogen. Warum und wieso, das begründet er hier mit unbestechlichem Bekennermut, damit die gefährliche Widersprüchllchkeit nicht nur der beanstandeten „Denkschrift“, sondern auch des zeitgenössischen theologischen Opportunismus entlarvend. An diesem in das Zentrum unseres Mensch- und Christseins treffenden „Pamphlet“ werden sich die Geister auch innerhalb der Kirche scheiden. Jochen Fischer Geb. 1913 in Berlin. Von 1939-1957 Arzt im öffentlichen Gesundheitswesen (Kreisarzt, Medizinaldezernent). Seit 1957 beratender Sozialhygieniker und Direktor im Diakonischen Werk der EKD in Stuttgart. Seit 1968 als Psychosomatiker in einer bewegungstherapeutischen Kuranstalt tätig. Er gehört zu den Mitbegründern der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung, die 1949 ins Leben gerufen wurde. Von 1952 bis 1957 leitete er eine Eheberatungsstelle. Er hielt zahlreiche Vorträge vor Jugendlichen, in Verlobtenseminaren, Eheseminaren und Elternkursen im ln- und Ausland. Außer einer großen Zahl von Fachveröffentlichungen auf den Gebieten der Sozialhygiene, Psychohygiene, Theologie und Pädagogik schrieb er u. a. mehrere Bücher über Jugend- und Ehefragen: Über die Ehe hinaus, 48 Selten, Bielefeld, 1956; Wir zwei wollen es besser machen, 268 Seiten, Lahr, 1964; Die Lebensalter der Ehe, 143 Seiten, Hamburg, 1965; Nicht Sex, sondern Liebe, Hamburg, 1966; Neue Moral unter die Lupe genommen, Wuppertal, 1967; Wörterbuch zur Sexualpädagogik und ihren Grenzgebieten Jugend-, Ehe- und Familienkunde (2 200 Stichwörter), 445 Seiten, Wuppertal, 1969. |
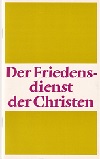 |
Der Friedensdienst der Christen Eine Thesenreihe zur christlichen Friedensethik Gütersloher Verlagshaus, 1970, 30 Seiten, 50 g, kartoniert, 3-579-04536-9 2,60 EUR |
Erarbeitet von der Kammer der
Evangelischen Kirche in Deutschland für öffentliche Verantwortung. Die vorliegende Thesenreihe ist von der Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland fiir öffentliche Verantwortung im Rahmen ihrer langfristigen Studien zum Thema ›>Kriegsverhütung und Friedenssicherung« erarbeitet worden. Ein Sammelband mit Einzelbeiträgen zu einer Ethik des Friedens, die der .Ausarbeitung der Thesen zugrunde liegen, wird vorbereitet. Wie schon bei früheren Gelegenheiten hat sich auch bei diesen Thesen keine volle Zustimmung zu allen Formulierungen und den hinter ihnen stehenden Auffassungen unter den Mitgliedern der Kammer erzielen lassen. Gleichwohl sind diese Thesen geeignet, dem gegenwärtig in der kirchlichen und politischen Öffentlichkeit geführten Gespräch zur Sicherung des Friedens ethische Kriterien anzubieten und neue Impulse zu geben. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat daher diese Ausarbeitung als Gesprächsbeitrag zur Veröffentlichung freigegeben. Tübingen, den 1. Dezember 1969 Professor D. Dr. Ludwig Kaiser, Vorsitzender der Kammer für öffentliche Verantwortung |
 |
Zur Reform des Ehescheidungsrechts in der Bundesrepublik
Deutschland Eine Denkschrift der Familienrechtskommission der EKiD. Herausgegeben vom Rat der EKiD Gütersloher Verlagshaus, 1970, 32 Seiten, geheftet, 3-579-04537-7 2,00 EUR |
Eine Denkschrift der
Familienrechtskommission der Evangelischen Kirche in Deutschland. Hrsg.
vom Rat d. Evang. Kirche in Deutschland Die vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland eingesetzte Eamilienrechtskommission hatte in der Vergangenheit mehrfach audi zu Einzelproblemen des Ehescheidungsrechts Stellung genommen. Sie gewann dabei die Überzeugung, daß Teilreformen nicht genügen. In der Frage, unter welchen Grundgesichtspunkten das Ehescheidungsredit neu gestaltet werden kann, einigte sich die Kommission nach langen Beratungen auf ein gemeinsames Votum, das in der hier vorgelegten Denkschrift ››Zur Reform des Ehescheidungsrechts in der Bundesrepublik Deutschland« dargelegt und begründet wird. Die Übereinstimmung in den Grundgedanken, die eine einstimmige Annahme der Denkschrift in der Kommission ermöglichte, bedeutet jedoch nicht, daß jedes Mitglied der Kommission jedem konkreten Einzelvorschlag zugestimmt hätte. Die Neuordnung des Ehescheidungsrechts ist eine bedeutende gesetzgeberische Aufgabe, die zu Recht großes Interesse in der Öffentlichkeit findet. Mit der Veröffentlichung dieser Denkschrift, die vom evangelischen Verständnis der Ehe aus« gehend Vorschläge für die Reform des Ehescheidungsrechts macht, möchte der Rat cler Evangelischen Kirche in Deutschland einen Beitrag in die öffentliche Diskussion einbringen, der nach seiner Auffassung besondere Beachtung verdient. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland D. Dietzfelbinger Hannover, den 2 7. November 1969 |
 |
Friedensaufgaben der Deutschen Eine Studie. Vorgelegt von der Kammer für öffentliche Verantwortung der Evang. Kirche in Deutschland Gütersloher Verlagshaus, 1968, 22 Seiten, 40 g, geheftet, 3-579-04698-5 2,60 EUR |
Die vorliegende Studie ist ein
Arbeitsergebnis der Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland für
öffentliche Verantwortung. Sie ist aus einer Zusammenarbeit
evangelischer Christen in beiden Teilen Deutschlands hervorgegangen. Sie
bemüht sich um eine Haltung, welche die Position beider Seiten kennt und
ernst nimmt, aber auch wagt und dem Ziel der Friedenserhaltung
unterordnet. Die Studie soll ein Gesprächsbeitrag sein. Unter den Mitgliedern der Kammer hat sie keine einhellige Zustimmung gefunden. Auch im Rat der EKD bestehen über ihren Inhalt unterschiedliche Auffassungen. Trotzdem hat der Rat zugestimmt, daß die Kammer die Studie zur öffentlichen Diskussion stellt. Es ist nicht Aufgabe der Evangelischen Kirche in Deutschland, ihre Gliedkirchen und deren einzelne Glieder rnit den Erwägungen einer solchen Studie zu binden, wohl aber ihnen zu einer Auseinandersetzung mit den gestellten Fragen zu verhelfen. Die Vielfalt der Meinungen darf dabei nicht verschwiegen werden; sie muß vielmehr zu einer offenen und sachlichen Diskussion führen. Dazu soll die Studie beitragen, zumal sie selbst eine Frucht eingehender Aussprachen zwischen Christen aus beiden Teilen Deutschlands ist. Tübingen, den 1. März 1968 Professor D. Dr. Ludwig Kaiser, Vorsitzender der Kammer für öffentliche Verantwortung |
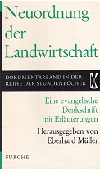 |
Eberhard Müller Die Neuordnung der Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland als gesellschaftliche Aufgabe Eine evangelische Denkschrift mit Erläuterungen Furche Verlag, 1966, 124 Seiten, Kartoniert, 3,60 EUR |
Stundenbücher
Band 63 Der Text d. Denkschrift d. Rates d. Evang. Kirche in Deutschland Dokumentarband in der Reihe der Stundenbücher Ein wesentlicher Grund für die Spannungen und Nöte der gegenwärtigen Menschheit ist die Krise in der Landwirtschaft. Sie ist kein nationales Sonderproblem oder Sonderinteresse, alle werden davon betroffen. Dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland liegt daran, bei den Christen in aller Welt ein Bewußtsein der Mitverantwortung für die Fragen der Landwirtschaft zu wecken. Die Evangelische Denkschrift, die dazu beitragen will, »alle Glieder unserer Gesellschaft für ein Mitdenken und Mittun bei der Lösung dieser Fragen zu gewinnen, um damit zugleich den deutschen Landwirten selbst Rat und Hilfe zuteil werden zu lassen<<, wird hier in einer kommentierten Fassung vorgelegt. Die Kommentatoren haben auch die Denkschrift mitverfaßt; sie wollen mit ihren Erläuterungen die Diskussion über die angeschnittenen Probleme fortführen und zugleich die Mißverständnisse klären, die über die Denkschrift entstanden sind. |
 |
Bildung Information Medien Die Denkschriften der EKiD Band 4/3 Gütersloher Verlagshaus, 1991, 175 Seiten, 160 g, kartoniert, 978-3-579-00420-4 7,00 EUR |
Gütersloher Taschenbüche
420 Die Denkschriften der EKiD Band 4/3 Gutachten und Stellungnahmen zur Medienpolitik. Die neuen Informations und Kommunikationstechniken |
 |
Bildung und Erziehung Die Denkschriften der EKiD Band 4/1 Gütersloher Verlagshaus, 1987, 301 Seiten, 290 g, kartoniert, 978-3-579-00417-4 7,00 EUR |
Gütersloher Taschenbüche
417 Die Denkschriften der EKiD Band 4/1 Kirche und Schule (Dokument der Bekennenden Kirche) Stellungnahme zum Religionsunterreicht Bildungspolitische Entscheidungen Leben und Erziehen - Wozu? Zusammenhang von Leben, Glauben und Lernen Erwachsenenbildung als Aufgabe der evangelischen Kirche |
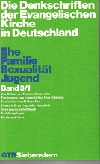 |
Ehe, Familie, Sexualität, Jugend Die Denkschriften der EKiD Band 3/1 Gütersloher Verlagshaus, 1982, 326 Seiten, 300 g, kartoniert, 978-3-579-00416-7 7,00 EUR |
Gütersloher Taschenbücher
416 Die Denkschriften der EKiD Band 3/1 Zur Reform des Ehescheidungsrechts Ergänzungen zum evangelischen Eheverständnis Konfessionsverschiedene Ehe Denkschrift zu Fragen des Sexualität Schwangerschaftsabbruch Erziehungsfragen Kirche und Sport |
 |
Soziale Ordnung - Wirtschaft - Staat Die Denkschriften der EKiD Band 2/3 Gütersloher Verlagshaus, 1992, 443 Seiten, 400 g, kartoniert, 978-3-579-00422-8 8,00 EUR |
Gütersloher Taschenbücher
422 Die Denkschriften der EKiD Band 2/3 Solidargemeinschaft von Arbeitenden und Arbeitslosen - Sozialethische Probleme der Arbeitslosigkeit Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Wachsen und Weichen, Ökologie und Ökonomie, Hunger und Überfluß Menschengerechte Stadt - Aufforderung zur humanen und ökologischen Stadterneuerung |
 |
Soziale Ordnung Die Denkschriften der EKiD Band 2 Gütersloher Verlagshaus, 1978, 260 Seiten, 210 g, kartoniert, 3-579-04803-1 7,00 EUR |
Gütersloher Taschenbücher
415 Die Denkschriften der EKiD Band 2 Eigentumsbildung in Sozialer Verantwortunjg Empfehlungen zur Eigentumspolitik Die Neuordnung der Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland als gesellschaftliche Aufgabe Mitbestimmung in der Wirtschaft Die soziale Sicherung im Industriezeitalter Soziale Ordnung des Baubodenrechts Teilzeitarbeit von Frauen Gutachten und Stellungnahmen zur Medienpolitik |
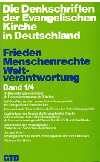 |
Frieden - Menschenrechte - Weltverantwortung Teil 4
Die Denkschriften der EKiD Band 1/4 Gütersloher Verlagshaus, 1993, 213 Seiten, 200 g, kartoniert, 978-3-579-00425-9 7,00 EUR |
Gütersloher Taschenbücher
425 Die Denkschriften der EKiD Band 1/4 Weltbevölkerungswachstum als Herausforderung an die Kirchen Auf dem Weg zu einer neuen Entwicklungspolitik der Europäischen Gemeinschaft Transnationale Unternehemn als Thema der Entwicklungspolitik Kundgebung der Synode der EKD in Deutschland zum Entwicklungsdienst als Herausforderung und Chance für die EKD und ihre Werke Bewältigung und Schuldenkrise - Prüfstein der Nord-Süd-Beziehungen Ost und West - herausgefordert zu mehr Gerechtigkeit in der Weltwirtschaft Plädoyer für Afrika |
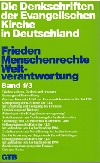 |
Frieden - Menschenrechte - Weltverantwortung Teil 3
Die Denkschriften der EKiD Band 1/3 Gütersloher Verlagshaus, 1993, 380 Seiten, 350 g, kartoniert, 978-3-579-00424-2 8,00 EUR |
Gütersloher Taschenbücher
424 Die Denkschriften der EKiD Band 1/3 I. Friedenssicherung und Friedensförderung [zur Seite Krieg und Frieden] Frieden wahren, fördern und erneuern Rüstung und Entwicklung Wort des Ratesb der EKD zur Friedensdiskussion im Herbst 1983 Kundgebung der 6. Synode der EKD zur Erhaltung und Festigung des Friedens Entwicklung und Rüstung Wehrdienst oder Kriegsdienstverweigerung? II. Menschenrechte im eigenen Land und weltweit Gesichtspunkte zur Neufassung des Ausländerrechts Zur Verbesserung der Lage von de facto-Flüchtlingen Stellungnahme des Rates der EKD zur Aufnahme von Asylsuchenden (1990) Wanderungsbewegungen in Europa Sinti und Roma |
 |
Frieden, Versöhnung und Menschenrechte
Teil 2 Die Denkschriften der EKiD Band 1/2 Gütersloher Verlagshaus, 1981, 222 Seiten, 210 g, kartoniert, 3-579-04802-3 7,00 EUR |
Gütersloher Taschenbücher
414 Die Denkschriften der EKiD Band 1/2 Die christliche Friedensbotschaft, die weltlichen Friedensprogramme und die politische Arbeit für den Frieden Friedensuafgaben der Deutschen Der Friedensdienst der Christen Gewalt und Gewaltanwednung in der Gesellschaft Die Menschenrechte im ökumenischen Gespräch Stellungnahme der Fragen der KSZE-Schlußakte, der Menschenrechte und der Religionsfreiheit Christen und Juden Verständnishilfe: Was ist Zionismus? |
 |
Ludwig Raiser Frieden, Versöhnung und Menschenrechte Teil 1 Die Denkschriften der EKiD Band 1/1 Gütersloher Verlagshaus, 3. Auflage 1988, 247 Seiten, 240 g, kartoniert, 978-3-579-00413-6 7,00 EUR |
Gütersloher Taschenbücher
413 Die Denkschriften der EKiD Band 1/1 Aufgaben und Grenzen kirchlicher Äußerungen zu gesellschaftlichen Fragen Die Lage der Vertriebenen und das verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn Vertrebung und Versöhnung. Erklärung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland Der Entwicklungsdienst der Kirche. Ein Beitrag für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt Soziale Gerechtigkeit und internationale Wrtschaftsordnung. Memorandum der gemeinsamen Konferenz der Kirchen für Entwicklungsfragen zu UNCTADIV Anti-Rassismus Programm des Ökmenischen Rates der Kirchen |
| nicht mehr lieferbare Denkschriften | ||
 |
Freiheit digital Die Zehn Gebote in Zeiten des digitalen Wandels. Evangelisches Verlagshaus, 2021, 248 Seiten, kartoniert, 978-3-374-06858-6 vergriffen, nicht mehr lieferbar |
Eine Denkschrift der Evangelischen
Kirche in Deutschland Die Digitalisierung zieht sich durch nahezu alle Lebensbereiche. Vieles verändert sich – doch gerade darin stellen sich zentrale ethische Grundfragen neu: Wie gehen Menschen miteinander um, welche Verantwortung tragen sie für Umwelt und Leben? Den digitalen Wandel in Freiheit und Verantwortung gestalten – das ist das leitende Anliegen dieser Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Es sind zeitlose Fragen nach Zukunftssicherung, Arbeit und Muße, Treue und Untreue oder Wahrheit und Lüge, die im Kontext der Digitalisierung neu betrachtet werden. Die Denkschrift ermutigt, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, blendet kritische Aspekte aber nicht aus. Sie schafft dabei eine Verbindung zu einem zentralen Text der biblischen Tradition: den Zehn Geboten. Diese erweisen sich auch in Zeiten des digitalen Wandels als ethische Grundorientierung für ein Leben in Freiheit und Verantwortung. Leseprobe |
 |
Rechtfertigung und Freiheit 500 Jahre Reformation 2017. Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Gütersloher Verlagshaus, 2014, 112 Seiten, kartoniert, 12 x 19 cm 978-3-579-05973-0 |
EKD Grundlagentext Als Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung hat die Reformation nicht allein Kirche und Theologie, sondern das gesamte private und öffentliche Leben verändert und bis in die Gegenwart (mit) geprägt. Sie wirkte u.a. als Bildungsimpuls, trug zur Ausbildung der modernen Grundrechte von Religions- und Gewissensfreiheit bei, veränderte das Verhältnis von Kirche und Staat, hatte Anteil an der Entstehung des neuzeitlichen Freiheitsbegriffs und des modernen Demokratieverständnisses. Die Fragen, die die Reformatoren in Briefen, Predigten und Traktaten stellten, griffen auf, was die Menschen damals unmittelbar bewegte. Bei einem Reformationsjubiläum am Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts muss deutlich gemacht werden, inwiefern die religiösen Einsichten der Reformation auch eine Antwort auf Fragen heutiger Menschen darstellen. Als offene Lerngeschichte ist die Reformation für jede Generation Gestaltungsaufgabe. Heute geht es um die Bedeutung der reformatorischen Rechtfertigungslehre und Freiheitserfahrung in einer Zeit verstärkter gesellschaftlicher Umbrüche. •Das zentrale Thema der Reformation damals und heute •Kernpunkte reformatorischer Theologie: theologische Grundgedanken und gegenwärtige Herausforderungen |
 |
Der Gottesdienst Eine Orientierungshilfe zu Verständnis und Praxis des Gottesdienstes in der evangelischen Kirche Gütersloher Verlagshaus, 2009, 96 Seiten, Broschur, 12,0 x 19,0 cm 978-3-579-05910-5 vergriffen, nicht mehr lieferbar |
EKD - Texte Die vorliegende Orientierungshilfe verbindet in knapper, allgemein verständlicher Form Informationen über die Geschichte des christlichen Gottesdienstes mit theologischen Grundlinien seines evangelischen Verständnisses und seiner liturgischen Grundstruktur. Darüber hinaus bietet sie praktische Hinweise zu seiner Gestaltung. Für Pfarrer und Pfarrerinnen, Prädikanten und Prädikantinnen, Lektoren und Lektorinnen, Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen und alle anderen an der Vorbereitung und Gestaltung von Gottesdiensten unmittelbar Beteiligten soll dieser Text genauso eine Hilfe sein wie für Kirchenvorstände und Gesprächsgruppen und für Einzelne, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen. Leseprobe |
 |
Das Abendmahl Eine Orientierungshilfe zu Verständnis und Praxis des Abendmahls in der evang.Kirche. Vorgelegt vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, hrsg. vom Kirchenamt der EKD.
Gütersloher Verlagshaus 2003, 64 Seiten,
|
EKD -
Texte In den letzten Jahrzehnten haben sich Stellenwert und liturgische Praxis des Abendmahls in den evangelischen Kirchen tiefgreifend verändert. Immer wieder wird über das Verständnis und die Praxis des Abendmahls nachgedacht, oft auch kontrovers diskutiert. Wie häufig soll das Abendmahl gefeiert werden und in welcher Form? Welche Stücke der Liturgie sind unverzichtbar? Darf anstelle von Wein auch Traubensaft verwendet werden? Sollte dem Abendmahl eine Beichte vorausgehen? Wer darf am Abendmahl teilnehmen? Schließlich als eigentliche Frage: Was bedeutet denn das Abendmahl überhaupt? Dieses vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland vorgelegte Buch versucht Orientierung zu vermitteln. Es bietet in klar verständlicher Sprache eine gemeinsame evangelische Deutung des Abendmahls an und gibt praktische Hinweise für den Umgang mit dem Abendmahl. Eine wichtige Orientierungshilfe für alle, die dieses bedeutende Sakrament der evangelischen Kirchen besser verstehen wollen. |
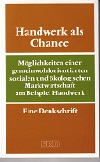 |
Handwerk als Chance Möglichkeiten einer gemeinwohlorientierten sozialen und ökologischen Marktwirtschaft am Beispiel Handwerk Gütersloher Verlagshaus, 1997, 144 Seiten, 160 g, kart, 3-579-02366-7 |
|
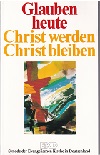 |
Glauben heute Christ werden. Christ bleiben Gütersloher Verlagshaus, 1990, 64 Seiten, 80 g, kartoniert, 3-579-01997-X |
Hrsg. von der Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland Mit einem Brief an alle, denen der Glaube und die Kirche am Herzen liegen und dem Vortrag Die Entdeckung des Glaubens im Neuen Testament von Professor Dr. Hans Weder Beschluß der 7. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland auf ihrer 5. Tagung zum Schwerpunktthema »Glauben heute Christ werden - Christ bleiben<< Die Synode der EKD macht sich die Ausarbeitung »Glauben heute »Chríst werden - Christ bleiben« als Grundlage für das Gespräch und die Neiterarbeit in Gemeinden, Diensten und Einrichtungen zu eigen. In der Tagung der Synode im Iahr 1990 möchte sich die Synode dem Thema »Glauben heute« wieder zuwenden. Die Synode der EKD bittet den Rat der EKD, den nachfolgenden Brief .zn die Glieder ihrer Kirchen zusammen mit der Ausarbeitung zum Schwerpunktthema und dem biblischen Vortrag von Prof. Dr. Hans Weder, Zürich, den Gliedkirchen zur Weiterleitung zu übersenden. Bad Wildungen, 10. November 1988 Der Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland Jürgen Schmude |
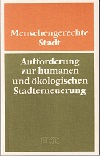 |
Menschengerechte Stadt Aufforderung zur humanen und ökologischen Stadterneuerung Gütersloher Verlagshaus, 1985, 178 Seiten, 175 g, Kartoniert, 3-579-01983-X |
Vorwort Seit Ende des Zweiten Weltkrieges nahm die industriegesellschaftliche Verstädterung in bisher ungekanntem Ausmaß zu und dehnte sich weltweit aus. Viele Großstädte haben sich zu Verdichtungsräumen erweitert. Dadurch hat sich nicht nur die Struktur und die Lebensatmosohäre in der Stadt nachhaltig verändert, sondern auch der Arbeits.ind Lebensbereich eines jeden einzelnen. Noch tiefer greifende Veränderungen sind durch die Einführung neuer Technologien, der Mikroelektronik und der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, zu erwarten. Einerseits hat diese Urbanisierung der Menschheit unbestritten Gewinn gebracht und die Lebensmöglichkeiten des Menschen gesteigert. Die Erschließung neuer Arbeitsmöglichkeiten half vielen Menschen, ihre Existenz sicherer zu gestalten und ihren Lebensstandard zu erhöhen. Die städtische Lebensform hat soziale Kontrollen abgebaut und die Chancen freigewählter Kommunikation erhöht. Ohne den städtischen Hintergrund wären die Entwicklung unserer Kultur und unseres Bildungswesens sowie die Leistung von Wissenschaft und Technik kaum denkbar.- Derngegenüber werden wir heute bei der Entwicklung großstädtischer Ballungsräume mit bedrohlichen Erscheinungen konfrontiert. Der Prozeß der Urbanisierung hat vielerorts Nebenwirkungen hervorgerufen, durch die auch positive Errungenschaften wieder in Frage gestellt werden. So wird die Natur weitgehend aus dem städtischen Lebenszusammenhang verdrängt. Der Versuch, sie zu beherrschen, ist vielfach in ihre Zerstörung urngeschlagen. Die großstädtischen Lebensbedingungen bringen nicht nur Mobilität mit sich, sondern auch Hektik, Anonymität, soziale Isolation und Einsamkeit bei vielen Menschen. Psychische und soziale Belastungen bringen Gefährdungen für Familie, Kinder, Minderheiten und Benachteiligte. Aber auch für Baudenkmäler ergeben sich heute erhebliche Probleme. Die geschichtliche Identität wird durch den raschen Veränderungsprozeß in Frage gestellt. In den 70er Jahren rückte in den Mittelpunkt des Interesses von Synoden und Kirchengemeinden die Frage, inwieweit die Kirche bei der Gestaltung dieser Entwicklung Mitverantwortung zu übernehmen hat. Zum ersten Mal forderte das »Forum Kirche und Stadt« während des 13. Kirchbautages (1973) in Dortmund die Landeskirchen und Verantwortlichen in den Gemeinden auf, Initiativen zu entfalten, um humanes Leben in den Städten zu schützen und destruktiven Entwicklungstendenzen entgegenzuwirken. Seitdem wurde die Kirche als Träger öffentlicher Belange immer dringlicher darauf hingewiesen, sie habe ihre vom Gastgeber eröffneten Chancen der Mitgestaltung bisher noch zu wenig ausgeschöpft. Die Kammer der EKD für soziale Ordnung hat im Auftrag des Rates der EKD die vorliegende Studie erarbeitet und sich dabei auf die Beratung durch zahlreiche Fachleute und betroffene Bürger gestützt. Hauptanliegen dieser Studie ist es, zu einer Neubesinnung in Kirche und Öffentlichkeit anzuleiten. Sie ordnet die innerkirchlichen Fragen der Seelsorge, der Verkündigung und der diakonischen Präsenz in der Stadt diesen leitenden Gesichtspunkten zu. Die konkreten Vorschläge und Forderungen der Studie orientieren sich an bestimmten Leitvorstellungen und Kriterien. Im Mittelpunkt steht die Perspektive der ››überschaubaren, offen gegliederten Stadt« als Gegengewicht zur funktional durchratiorialisierten Stadt. Das bedeutet: Die Stadt soll geöffnet werden für Lebensformen, in denen die kulturelle Aneignung durch die Bewohner möglich wird, sie soll geöffnet werden für überschaubare, untergliederte und naturnahe Strukturen, sie soll offen bleiben für die geschichtliche Kontinuität. Der Aufbau der Studie entspricht diesem Ansatz. Er beschränkt sich darauf, einige wichtige Problemfelder und Aufgabenstellungen zu umreißen und Lösungsmöglichkeiten exemplarisch anzudeuten. Die Studie wendet sich sowohl an diejenigen, die in großstädtischen Bereichen Verantwortung tragen oder übernehmen wollen, als auch an die Gemeinden, die in der Wahrnehmung ihres ganzheitlichen Auftrages unmittelbar betroffen sind. Ich wünsche ihr eine aufgeschlossene und durchaus auch konstruktiv-kritische Diskussion. D. Eduard Lohse Landesbischof, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland |
 |
Für uns gestorben: Die Bedeutung von Leiden und Sterben Jesu
Christi Gütersloher Verlagshaus, 2. Auflage 2015, 192 Seiten, Broschur, 12,1 x 1,9 x 19,2 cm 978-3-579-05976-1 vergriffen, nicht mehr lieferbar |
Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) Christliche Theologie steht vor der Aufgabe, das Verständnis der Liebe Gottes im Kreuz immer wieder neu zu erklären und zu entfalten. Der vorliegende Text »Für uns gestorben« tut dies in vorbildlicher Weise und schlägt einen weiten Bogen. Er hilft den Reichtum christlicher Tradition im Blick auf den Kerngehalt evangelischen Glaubens zu entdecken. Dieses Buch ist nicht nur an Christinnen und Christen in der Evangelischen Kirche adressiert, sondern ist ein Gesprächsangebot an alle, die nach Bedeutung und Sinngehalt des christlichen Glaubens fragen, auch dann, wenn sie diesen nicht teilen oder ihm sogar ablehnend gegenüberstehen. EKD Denkschriften |
 |
Kirchenamt der EKD Solidarität und Selbstbestimmung im Wandel der Arbeitswelt Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zu Arbeit, Sozialpartnerschaft und Gewerkschaften Gütersloher Verlagshaus, 2015, 144 Seiten, kartoniert, 978-3-579-05977-8 vergriffen |
»Wertschöpfung durch Wertschätzung« Dass der Mensch von Gott beauftragt ist, in der Schöpfung zu arbeiten, sie zu gestalten und sie zu bewahren und dies in Kooperation mit anderen zu tun, ist grundlegende christliche Überzeugung. Der Grundsatz des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt: »Wertschöpfung durch Wertschätzung« bringt den Grundgedanken christlicher Arbeitsethik ganz wunderbar zum Ausdruck. Entspricht die heutige Arbeitswelt diesen Grundsätzen? Um diese Frage dreht sich der hier vorliegende Text der Kammer für soziale Ordnung, der vom Rat der EKD als Denkschrift angenommen worden ist. In ihm werden zunächst evangelische Kriterien zur Gestaltung der Arbeitswelt entwickelt, dann die Entwicklung der Arbeitswelt in den letzten Jahren ausführlich analysiert und beschrieben, bevor dann Schlussfolgerungen angestellt und Konsequenzen gezogen werden. Mit diesem Text werden Maßstäbe zur Gestaltung der Arbeitswelt vorgelegt. Sie sind im Dialog mit Gewerkschaften und Arbeitgebern erarbeitet worden und werden in vielfältigen Veranstaltungen und Initiativen in der nächsten Zeit in die Gesellschaft eingespeist werden. |
|
Wandeln und Gestalten - missionarische Chancen und
Aufgaben der Evangelischen Kirche in ländlichen Räumen EKD Text 87, 2007 |
Download als pdf | |
 |
Unternehmerisches Handeln
in evangelischer Perspektive Gütersloher Verlagshaus, 2008, 128 Seiten, kartoniert, 12 x 19 cm 978-3-579-05905-1vergriffen, nicht mehr lieferbar |
Der christliche Glauben hat zu
unternehmerischem Handeln ein durchaus positives
Verhältnis. Dennoch ist das Verhältnis von
Protestantismus und Unternehmertum immer wieder von
Spannungen geprägt, die zum Teil auf Missverständnissen
beruhen. Deshalb lädt diese Denkschrift der EKiD zu
einem neuen Dialog ein. zur Seite Werte / Ethik |
 |
Gelobtes Land? Land und Staat Israel in der Diskussion. Eine Orientierungshilfe Gütersloher Verlagshaus, 2012, 144 Seiten, Gebunden, 11,9 x 19,2 cm 978-3-579-05966-2 Denkschrift der EKD |
Für ein angemessenes Verständnis des
Staates Israel aus christlicher Sicht – eine Orientierungshilfe Die hier vorgelegte Orientierungshilfe greift ein ebenso aktuelles wie sensibles und zugleich herausforderndes Thema in einer Zeit auf, in der viele Christinnen und Christen angesichts der ungelösten politischen Konflikte im Nahen Osten verunsichert sind. Sie fragen nach politischen Lösungswegen, einem angemessenen Verständnis des Staates Israel aus christlicher Sicht und einer theologisch verantworteten und zeitgemäßen Deutung biblischer Landverheißungen. Die Orientierungshilfe benennt Aspekte jüdischen und muslimischen Verständnisses des Landes Israel und der Stadt Jerusalem. Die Kirchengeschichte des »Heiligen Landes« wird ebenso skizziert wie die gegenwärtige Situation der Kirchen in der Region und unterschiedliche theologische Argumentationsmuster. Leserinnen und Lesern wird damit die Chance geboten, die komplexe Thematik aus verschiedenen Perspektiven in den Blick zu nehmen, um so zu einem begründeten, eigenständigen Urteil zu kommen. So ist diese Orientierungshilfe eine Art Reiseführer durch das von Verheißungen geprägte Land Israel. Sie bringt sowohl die starke Verbundenheit der Christen mit Israel und Palästina als auch ihre Verantwortung für alle im Nahen Osten lebenden Menschen zum Ausdruck. Download als pdf |