| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Märtyrer | ||
 |
Zeugen für Christus Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts. 8., erweiterte und aktualisierte Auflage Ferdinand Schöningh, 2023, 2300 Seiten, Hardcover, 978-3-506-79130-6 99,00 EUR |
Das deutsche Martyrologium sammelt die
Biografien katholischer Christen im 20. Jahrhundert, die um ihres
Glaubens willen einen gewaltsamen Tod erlitten. Es handelt sich um
widerständige Personen aus den
Verfolgungen des Nationalsozialismus, des Kommunismus und der
Missionsgebiete. Die größte Gruppe bilden die Männer und Frauen aus der
Gegnerschaft zur NS-Ideologie. Die Personen stammten aus allen Regionen
des Deutschen Reiches, waren Priester und Laien, Junge und Alte aus
verschiedensten Berufen und Aufgaben.Mehr als 170 Fachleute aus dem In-
und Ausland haben die etwa 1000 Lebensbilder gesammelt und mit einem
Werk-, Quellen- und Literaturverzeichnis und, soweit möglich, einem
Porträtfoto, versehen. Das zweibändige Werk bietet ein unverzichtbares
Nachschlagewerk für Wissenschaft, Kirche und die interessierte
Öffentlichkeit. Inhaltsverzeichnis Blick ins Buch |
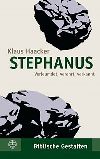 |
Klaus Haacker Stephanus Verleumdet, verehrt, verkannt Evangelisches Verlagshaus, 2014, 200 Seiten, kartoniert, 12 x 19 cm 978-3-374-03725-4 16,80 EUR |
Biblische Gestalten Band 28 Der Bericht vom Schicksal des Stephanus nimmt in der Apostelgeschichte breiten Raum ein. Sein Tod markiert eine Zäsur in der Geschichte des Urchristentums: von anfänglicher Beliebtheit im Volk hin zu Kriminalisierung und Vertreibung. Als erster Märtyrer wurde Stephanus für die christliche Frömmigkeit zum Heiligen, zum Fürsprecher bei Gott, dem Wunder zugeschrieben wurden. Das ließ ihn auch zum Patron vieler Kirchen und zum Thema der kirchlichen Kunst werden. Häufig diente er als Vorbild für das Christsein in einer feindlichen Umgebung. Problematisch ist eine neuzeitliche Auslegungstradition, die das Opfer zum Täter umdeutet und Stephanus selbst die Schuld an seinem gewaltsamen Tod zuschreibt. Haacker unterstreicht demgegenüber die psychologische und historische Plausibilität des lukanischen Berichts von der Rolle der ›falschen Zeugen‹. Insgesamt ist ein Band entstanden, der die Dramatik der biblischen Stephanusgeschichte herausarbeitet und prägnante Beispiele ihrer Wirkungsgeschichte bis ins 20. Jahrhundert Revue passieren lässt. Klaus Haacker, Dr. theol., Prof. em., lehrte von 1974 bis 2007 an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Er war u. a. von 1977 bis 2007 Herausgeber der Theologischen Beiträge und von 1998 bis 2010 Vorsitzender des interkonfessionellen Rhein-Main-Exegetentreffens. Seine Publikationen befassen sich vor allem mit Jesus, Paulus und der Apostelgeschichte sowie dem Verhältnis von Christentum und Judentum. Seit 2011 lebt Haacker in Berlin und nimmt dort u. a. Lehraufträge an der Humboldt-Universität wahr. Leseprobe Apostelgeschichte 6,8 - 7,59, Stephanus, der erste Märtyrer |
 |
Legendae martyrum
urbis Romae - Märtyrerlegenden der Stadt Rom Band 1 Lateinisch - deutsch Herder Verlag, 2022, 272 Seiten, Gebunden, 12,8 x 19,5 cm 978-3-451-32930-2 45,00 EUR |
Fontes
Christiani Reihe 5 Band 96/1 Obwohl Rom in der christlichen Erinnerung als Hotspot der Christenverfolgung verankert ist, gab es in der Stadt selbst zunächst keine dementsprechenden literarischen Traditionen. Erst ab dem späten 4. Jahrhundert entstanden eine Reihe von Märtyrerlegenden, die als Zeugnisse für die sich allmählich in Rom ausprägende Vorstellung von der heroischen Frühgeschichte des dortigen Christentums gelten können, das nach diesen Legenden sehr früh bis in die senatorischen Kreise vorgedrungen ist. Die Texte lassen einen tiefen Einblick in die Frömmigkeit, Mentalität und theologische Bildung der späten Autoren und ihrer Adressaten zu, besonders der römischen Asket(inn)enkreise und des wohlhabenden senatorischen Adels der Spätantike. Sie reflektieren zum Beispiel das in diesen Kreisen virulente Verhältnis zum Reichtum und zu den weiter bestehenden nichtchristlichen Religionspraktiken, die Frage der Vorsehung und immer wieder die Rolle und Bedeutung sexueller Enthaltsamkeit aus religiösen Gründen. Da eine ganze Reihe der Legenden, zum Beispiel zu Agnes, Caecilia, Laurentius oder Sebastian, eine reiche Wirkungsgeschichte, insbesondere im kunstgeschichtlichen Bereich, erfahren haben, sind sie nicht nur für Historiker von Interesse, sondern auch für weitere kulturwissenschaftliche Disziplinen. Leseprobe |
 |
Legendae martyrum
urbis Romae - Märtyrerlegenden der Stadt Rom Band 2
Lateinisch - deutsch Herder Verlag, 2022, 360 Seiten, Gebunden, 12,8 x 19,5 cm 978-3-451-32931-9 50,00 EUR |
Fontes
Christiani Reihe 5 Band 96/2 Obwohl Rom in der christlichen Erinnerung als Hotspot der Christenverfolgung verankert ist, gab es in der Stadt selbst zunächst keine dementsprechenden literarischen Traditionen. Erst ab dem späten 4. Jahrhundert entstanden eine Reihe von Märtyrerlegenden, die als Zeugnisse für die sich allmählich in Rom ausprägende Vorstellung von der heroischen Frühgeschichte des dortigen Christentums gelten können, das nach diesen Legenden sehr früh bis in die senatorischen Kreise vorgedrungen ist. Die Texte lassen einen tiefen Einblick in die Frömmigkeit, Mentalität und theologische Bildung der späten Autoren und ihrer Adressaten zu, besonders der römischen Asket(inn)enkreise und des wohlhabenden senatorischen Adels der Spätantike. Sie reflektieren zum Beispiel das in diesen Kreisen virulente Verhältnis zum Reichtum und zu den weiter bestehenden nichtchristlichen Religionspraktiken, die Frage der Vorsehung und immer wieder die Rolle und Bedeutung sexueller Enthaltsamkeit aus religiösen Gründen. Da eine ganze Reihe der Legenden, zum Beispiel zu Agnes, Caecilia, Laurentius oder Sebastian, eine reiche Wirkungsgeschichte, insbesondere im kunstgeschichtlichen Bereich, erfahren haben, sind sie nicht nur für Historiker von Interesse, sondern auch für weitere kulturwissenschaftliche Disziplinen. Leseprobe |
 |
Justin (der Märtyrer) Apologiae - Apologien Griechisch - Deustch Fontes Christiani Herder Verlag, 2021, 272 Seiten, Leinen, 12,8 x 19,5 cm 978-3-451-32900-5 45,00 EUR |
Fontes
Christiani Reihe 5 Band 91 Die Apologien Justins jetzt in einem Band Die Apologien Justins, der in der Mitte des 2. Jahrhunderts in Rom lebte und lehrte und dort das Martyrium erlitt, gelten als Hauptwerk der frühchristlichen Apologetik. In ihnen spiegelt sich die Auseinandersetzung des frühen Christentums mit seiner paganen Umwelt. Justin verteidigt das Christentum gegen Vorwürfe und Verdächtigungen und versucht es zugleich als die wahre vernunftgemäße Philosophie zu profilieren. Der vorliegende Band bietet eine neue deutsche Übersetzung mit kommentierenden Anmerkungen und einer fundierten Einleitung in dieses bedeutende Werk der frühen christlichen Apologetik. Leseprobe |
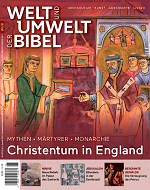 |
Mythen, Märtyrer, Monarchie: Christentum in England
Katholisches Bibelwerk e. V., 2023, 80 Seiten, 290 g, broschur, DIN A4, 28 x 22 cm 978-3-948219-54-3 12,80 EUR |
Welt und Umwelt der Bibel
Heft 1/2023 Band 107 Seit dem 2. Jh. entwickelt sich in England das Christentum. Der erste König war ein getaufter Wikinger. Die Normannen bauten Kathedralen und Klöster. Jahrhunderte waren geprägt von Streit und konstruktiven Diskussionen: Das Verhältnis von politischer und religiöser Macht gehörte zu den Grundfragen. In diesen Jahrhunderten entstanden großartige Werke der Literatur und die berühmten Bibelausgaben wie die King James Bible. Scharfsinnige theologische Überlegungen vonMenschen wie Anselm von Canterbury oder Thomas More berührten auch das europäische Festland und wurden gemeinsam vorangetrieben. Und immer wieder gab es Frauen und Männer, die als Vorbilder und auch Märtyrer dem Christentum Gesicht verliehen. Und bis heute erhält die Kirche von der britischen Insel neue Impulse. zur weiteren Beschreibung |
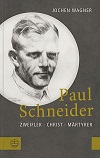 |
Jochen Wagner Paul Schneider Zweifler – Christ – Märtyrer Evangelisches Verlagshaus, 2024, 114 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-07526-3 15,00 EUR |
Zeit seines Lebens setzt sich Paul
Schneider mit seinem Glauben auseinander. Mal zweifelt er an
sich und seinem Glauben, dann wieder gewinnt er aus ihm neue Kraft.
Schneider kämpft im Ersten Weltkrieg, studiert anschließend
Evangelische Theologie und wird Pfarrer. An seiner Seite ist seine
Frau Margarete Dieterich, deren Bedeutung für sein Leben und Wirken
kaum überschätzt werden kann. In der Zeit des Nationalsozialismus wird der Zweifler zu einem mutigen Christen. Er ist Teil der Bekennenden Kirche, wird wegen seiner kritischen Äußerungen mehrfach verhaftet und kommt schließlich ins Konzentrationslager Buchenwald. Trotz massiver Misshandlungen lässt er sich nicht davon abhalten, seinen Mithäftlingen aus dem Fenster seiner Zelle Mut zuzusprechen und das Unrecht der SS-Leute anzuklagen. Noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wird Paul Schneider, »der Prediger von Buchenwald«, am 18. Juli 1939 mittels einer Giftinjektion im Konzentrationslager ermordet. Der mutige Christ gilt als Märtyrer der Bekennenden Kirche.. Inhaltsverzeichnis Jochen Wagner, Dr. theol., studierte Evangelische Theologie an den Universitäten Marburg und Mainz sowie an der Theologischen Hochschule in Ewersbach. Seit 2007 im Pastorat, war er von 2014 bis 2020 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Region Südwest – Rheinland-Pfalz und Saarland sowie von 2017 bis 2022 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Koblenz. Seit 2020 ist er freikirchlicher Referent der ACK in Deutschland. 2019 erhielt er den Internationalen Menno Simons Predigtpreis. |
 |
Beat Näf Städte und ihre Märtyrer Aschendorff, 2016, 192 Seiten, kartoniert, 978-3-402-16106-7 50,00 EUR |
Paradosis. Beiträge zur Geschichte
der altchristlichen Literatur und Theologie Band 51 Der Kult der Thebäoschen Legion. Vor rund 1700 Jahren soll eine ganze römische Legion Soldaten beim heutigen Saint Maurice - das nach dem Kommandanten Mauritius benannt ist - für ihre christliche Überzeugung getötet worden sein. Diese Legende ist im ausgehenden 4. Jahrhundert entstanden. Heilige der Thebäischen Legion sind Patrone zahlreich er Kirchen und Städte . Historisch gesehen zeugt die Legende unter anderem von der Ausbreitung des Christentums, des Mönchtums sowie der in der Spätantike einsetzenden christlichen Bautätigkeit. Die Kultur der Märtyrerverehrung hat während vielen Jahrhunderten kollek tiveSinnstiftung geleistet und tut es noch immer: Geschichtliche Kontingenzen und ihre emotionalen Auswirkungen werden dabei auf ein die Zeiten überdauerndes Netzwerk von Orten und Erzählungen bezogen: ein ritualisiertes Tun, das sowohl religiöse und wissenschaftliche wie ebenso allgemein geläufige kulturelle Praktiken und Techniken anwendet. Was Macht und Ohnmacht der Märtyrer ausmacht, kommt dadurch in erstaunlich stabilen Formen immer wieder neu zur Wirkung. |
 |
Gerd Buschmann Das Martyrium des Polykarp Die erste umfassende Kommentierung des frühesten selbständigen frühchristlichen Märtyrerberichts. Vandenhoeck u. Ruprecht, 1997, 400 Seiten, Leinen, 978-3-525-51681-2 140,00 EUR |
Kommentar zu den Apostolischen Vätern (KAV) Am Übergang vom Urchristentum zur Alten Kirche läutet das Martyrium Polykarps die neue literarische Gattung des Märtyrerberichts ein, die fortan vielfältig beerbt wird. In innerkirchlicher Absicht betont das Martyrium Polykarps die Parallele zwischen dem Leiden des Herrn und dem des Märtyrers, um einer enthusiastischen Martyriumssehnsucht zu wehren und eine angemessene Märtyrerverehrung einzuüben. Diese erste umfassende Kommentierung des frühesten uns erhaltenen selbständigen frühchristlichen Märtyrerberichts arbeitet insbesondere die kerygmatisch-erbauliche und inner-kirchlich-polemische Intention des Schreibens heraus. Dazu wird neben der Form des Schreibens unter anderem auch seine theologische Intention deutlich gemacht. Formal ist das Martyrium Polykarps nicht einfach als ein ,,Protokoll" des Geschehens angelegt, inhaltlich wird Polykarps Verhalten als evangeliumsgemäß dargestellt, in Kontrast zu enthusiastischem Martyriumsdrang. Zugleich setzt mit dieser Schrift in der Alten Kirche die liturgisch gefeierte Märtyrerverehrung ein, aber noch als bescheiden-angemessener, Christus-zentrierter Märtyrerkult. Der Kommentar bietet außerdem eine synoptische Ausgabe der griechischen Handschriften des Martyriums Polykarps und der Textwiedergabe in Eu sebs Kirchengeschi chte, literar- und formkritische Analysen mit Paralleltexten sowie Exkurse zur Entstehung des Begriffs ,,Märtyrer"", zum Verhördialog und zum eucharistischen Märtyrergedächtnisgebet. |
 |
Ignacio Ellacuria Eine Kirche der Armen Für ein prophetisches Christentum Herder Verlag, 2011, 230 Seiten, kartoniert, 13,5 x 21,5 cm, 978-3-451-34122-9 22,00 EUR |
Theologie der Dritten Welt, Herder Verlag Ignacio Ellacuría SJ ist einer der herausragenden lateinamerikanischen Intellektuellen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als Philosoph, Theologe und Universitätsrektor wollte er einen Beitrag zur gesellschaftlichen Veränderung leisten. Leitend waren für ihn dabei die Option für die Armen und die wechselseitige Verwiesenheit von Glaube und Gerechtigkeit. Sein Denken brachte ihn in einen tödlichen Konflikt mit den Mächtigen, die durch eine Veränderung der Verhältnisse ihre Interessen bedroht sahen. Ellacuría hat dafür mit seinem Leben bezahlt. In El Salvador und weit darüber hinaus wird er als Märtyrer verehrt. |
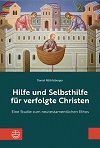 |
Daniel Röthlisberger Hilfe und Selbsthilfe für verfolgte Christen Eine Studie zum neutestamentlichen Ethos Evangelisches Verlagshaus, 2021, 512 Seiten, Hardcover, 978-3-374-06764-0 45,00 EUR |
Seit den Anfängen des Christentums bis heute ist das Leiden um des
Glaubens willen Bestandteil christlicher Existenz. Die Studie erforscht
anhand des Neuen Testaments die historischen Ursprünge von Verfolgung
und fragt nach den Formen und Inhalten innerchristlicher Hilfe und
Selbsthilfe. Der Autor zeigt auf, inwieweit das jeweilige Tun und Lassen
aus neutestamentlicher Sicht gefordert, begründet, legitimiert, an
Bedingungen geknüpft, begrenzt oder etwa kritisiert wird. Ermittelt
werden neben den handlungsleitenden Motiven die dem Handeln
zugrundeliegenden Normen und Werte. Auch klärt die Studie, inwieweit
besagtes Handeln präskriptive oder paradigmatische Bedeutung haben kann.
Die untersuchten Themen beinhalten Fragen zum Gebet, zu Flucht und
Verstecken, materiellem und psychischem Beistand sowie zu Apologien und
Rechtsmitteln, ebenso zu Gegengewalt und Gewaltverzicht sowie zur
Bergung und Bestattung von Märtyrern. Daniel Röthlisberger, Dr. phil., Jahrgang 1981, hat auf dem zweiten Bildungsweg in Deutschland und Belgien Theologie studiert und mit einem Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung an der Universität Dortmund promoviert. Er ist Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, im Ehrenamt Vorstandsmitglied der Internationalen Informationsstelle für Religionsfreiheit (IIRF Deutschland) und der Bibliothek für Hugenottengeschichte, mehrfacher Buchautor und Referent im Bereich Religionsfreiheit. |
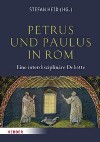 |
Stefan Heid Petrus und Paulus in Rom Eine interdisziplinäre Debatte Herder Verlag, 2011, 552 Seiten, Gebunden, Schutzumschlag, 17 x 24 cm 978-3-451-30705-8 105,00 EUR |
Das Buch bietet in 22 Aufsätzen die seit Jahren umfassendste
Auseinandersetzung mit folgenden Fragen: Was wissen wir von
Petrus in
Rom? War er je dort? Starb er als Märtyrer? Wie sind das Schicksal von
Petrus und Paulus miteinander verknüpft? Radikale Anfragen an
widerspenstige Quellen, Kontroversen zwischen Experten und neue Zugriffe
auf historische Erinnerungen offenbaren die Leidenschaft, aus der
Forschung lebt und aus der neue Gewissheiten erwachsen. siehe auch Arbeiten zur Kirchengeschichte Band 1, Lietzmann, Petrus und Paulus in Rom |
 |
Roman Siebenrock Christliches Martyrium Warum es geht Topos Verlagsgemeinschaft, 2008, 103 Seiten, kartoniert, 978-3-8367-0662-9 12,00 EUR |
Topos Taschenbuch 657 Der Begriff Märtyrer ist aufgrund von Vorkommnissen in der islamischen Welt seit einiger Zeit in den Medien wieder stärker präsent geworden. Was aber macht das Martyrium für die öffentliche Wahrnehmung über alle Zeiten hinweg so interessant? Anhand von konkreten Beispielen arbeitet der Autor die wesentlichen Merkmale des authentischen christlichen Martyriums heraus. Eine unverzichtbare Handreichung, nicht erst seit dem 11. September. |
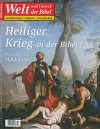 |
Heiliger Krieg
in der Bibel? Die Kämpfe der Makkabäer, Katholisches Bibelwerk Stuttgart, 2007, 72 Seiten, kartoniert, DIN A 4 978-3-932203-58-9 9,80 EUR |
Welt und Umwelt der
Bibel Heft 3 / 2007 Die Kämpfe der Makkabäer im 2. Jh. v. Chr. wurden zum Vorbild für Märtyrer, die für ihre Überzeugung zu sterben bereit waren, aber auch für Fanatiker, die ihre Ideologie mit Gewalt durchzusetzen versuchen. Und die Konflikte dieser Zeit stellten Weichen, denen sich das Zu-Stande-Kommen des späteren Judentums und des Christentums verdanken. Die religiös und politisch wichtigen Gruppierungen (Pharisäer, Saddzäer, Essener ... ), die in der Zeit Jesu die Geschichte Israels steuerten, entstanden in den Auseinandersetzungen dieser Zeit um die Frage nach dem richtigen Gottesdienst. Doch nach und nach waren alle Lebensbereiche betroffen: Die Kämpfe der Makkbäer im 2. Jh. v. Chr. wurden zum Vorbild für Märtyrer, die für ihre Überzeugung zu sterben bereit waren, aber auch für Fanatiker, die ihre Ideologie mit Gewalt durchzusetzen versuchen. In den Makkabäerbüchern wurde der Glaube an die Auferstehung zum ersten Mal formuliert. Auch Überlegungen über die Belohnung und Bestrafung von Verstorbenen (bis hin zum Fegefeuer) entstammen diesen Texten. |
 |
Bernhard Kriegbaum Kirche der Traditoren oder Kirche der Märtyrer? Die Vorgeschichte des Donatismus Tyrolia, 1986, 186 Seiten, Broschur, 978-3-7022-1587-3 20,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 16 Die historische und die theologische Forschung fragt sich schon seit langem und verstärkt seit den 1950er Jahren nach den wirklichen Ursachen des Ausbruchs und der Zählebigkeit des nordafrikanischen Schismas des Donatismus. Erkennbar ist dabei die zunehmende Tendenz, die Bedeutung der außerreligiösen Faktoren geringer zu veranschlagen und die autonome provinziale Tradition des nordafrikanischen Christentums höher zu veranschlagen. Die vorliegende theologische Dissertation lässt sich in diesen Trend gut einordnen. Dass die traditio in Afrika so hohen Stellenwert erhielt, lässt sich auf die zu schnelle Mission ohne tiefgreifende innere Christianisierung, das Fehlen eines eigenen Lehrdisputs und den Unterschied von westlichem und östlichem Konzilstypus zurückführen. Ausschlaggebend für das Zustandekommen der Spaltung der Kirche war letzten Endes aber die tiefreichende Vertrauenskrise innerhalb der Kirche und sogar innerhalb des Episkopats. Wohl selten in der Geschichte gab es ein deutlicheres Beispiel für die Notwendigkeit des Dialogs innerhalb der Kirche, als es die Vorgeschichte des donatistischen Schismas liefert. |
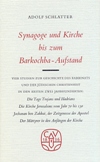 |
Adolf Schlatter Synagoge und Kirche bis zum Barkochba - Aufstand Calwer Verlag, 1966, 304 Seiten, Leinen, 3-7668-0206-2 978-3-7668-0206-4 6,00 EUR |
VIER STUDIEN ZUR GESCHICHTE DES
RABBINATS
UND DER JÜDISCHEN CHRISTENHEIT
IN DEN ERSTEN ZWEI JAHRHUNDERTEN: Die Tage Trajans und Hadrians Die Kirche Jerusalems vom Jahr 70 bis 130 Jochanan ben Zakkai, der Zeitgenosse der Apostel Der Märtyrer in den Anfängen der Kirche Daß es für das Verständnis der Geschichte Jesu und seiner Gemeinde eine entscheidende Voraussetzung sei, die Frömmigkeit und Theologie des zeitgenössischen Judentums zu kennen, das war eine der grundlegenden Überzeugungen Schlatters. So wurde er ein Bahnbrecher in der mühevollen Erforschung des palästinischen Rabbinats. Noch heute haben seine Arbeiten nach dem Urteil von Professor Jeremias In Göttingen nichts von ihrer Aktualität und faszinierenden Lebendigkeit verloren. Die vier Studien, die in diesem Band vereinigt sind, geben ein sehr anschauliches Bild von der inneren Geschichte der jüdischen Gemeinde in den Jahrzehnten vom ersten zum zweiten jüdischen Aufstand und zugleich von der judenchristliehen Kirche jener Zeit. Inhaltsverzeichnis Leseprobe |