| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
|
Innsbrucker Theologische Studien, Tyrolia Hrsg. v. Emerich Coreth / Walter Kern / Hans Rotter, in Verbindung mit den Professoren der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck |
||
 |
Christos Garidis Über die Kompatibilität der Energienlehre des hl. Gregorios Palamas mit dem trinitätstheologischen Grundaxiom von Karl Rahner Tyrolia, 2023, 266 Seiten, Softcover, 978-3-7022-4162-9 29,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien
Band 103 Energien und Selbstmitteilung Gottes im Vergleich ihrer ontologischen und erkenntnistheoretischen Dimension. Die Lehre von den Energien Gottes des hl. Gregorios Palamas (1296/97-1359) prägt seit Jahrhunderten die Theologie des Ostens, während die Lehre Karl Rahners (1904-1984) von der Selbstmitteilung Gottes in der westlichen Theologie eine wachsende Akzeptanz erfährt. Diese Abhandlung unternimmt einen systematischen Vergleich zwischen dem Konzept der Energie und jenem der Selbstmitteilung Gottes hinsichtlich ihrer innertrinitarischen und außertrinitarischen Bezogenheit. Ausgehend von den Gottesbildern und den ontologischen Voraussetzungen des Gott-Welt-Verhältnisses bei Palamas und Rahner werden die innertrinitarischen Beziehungen der Energie und der Selbstmitteilung zum Wesen und zu den trinitarischen Personen Gottes expliziert. Die außertrinitarische Bezogenheit der Energie und Selbstmitteilung (beide sind als ungeschaffene Gnade Gottes gedacht) wird aus der Struktur der menschlichen Natur als Gnadenempfänger, aus den anthropologischen Bedingungen, die den Gnadenempfang ermöglichen bzw. hindern, und aus den Folgen des Gnadenempfangs für den Menschen erschlossen. In einem letzten Schritt wird die Art der erlangten Erkenntnis Gottes bei Palamas und Rahner durch den Empfang der ungeschaffenen Gnade ermittelt. |
 |
Justin Arickal Ambivalente Gottesbilder als hermeneutische Herausforderung Ein interdisziplinärer Trialog zwischen Erich Zenger, Karl Rahner und Edith Stein Tyrolia, 2023, 463 Seiten, Softcover, 978-3-7022-4161-2 48,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien
Band 102 Wenn der "Gott der Liebe" zu Gewalt aufruft Die biblischen Schriften bezeugen eine Vielzahl von Gottesbildern, die nicht selten ambivalent sind oder einander zu widersprechen scheinen. Vor allem die mehrdeutigen Gottesbilder des Alten Testaments, die Gott einerseits als "Gott der Liebe und Barmherzigkeit", andererseits aber auch als "Gott der Rache und Gewalt" bezeugen, stellen eine große hermeneutische Herausforderung dar. Besonders irritierend und provokant sind dabei Gottesbilder, die Gewalt gegen Kinder beinhalten.Die vorliegende Studie befasst sich mit der Frage, wie solche ambivalenten und gewaltkonnotierten Gottesbilder vor dem Hintergrund der Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus verstanden werden können. Hierzu wählt der Autor einen multiperspektivischen Ansatz, der die biblisch-theologische Hermeneutik Erich Zengers, die systematisch-theologische Hermeneutik Karl Rahners und die existentiell-spirituelle Hermeneutik Edith Steins analysiert und in einen kritisch-konstruktiven Trialog miteinander bringt. Auf diese Weise werden Verstehenshorizonte herausgearbeitet, durch die sich neue Wege zu einem theologisch verantwortbaren Umgang mit schwierigen Gottesbildern eröffnen.Ausgezeichnet mit dem Pax-Bank-Förderpreis für theologische Forschungsbeiträge Studienjahr 2022/23 |
 |
Isabella Bruckner Gesten des Begehrens Mystik und Gebet im Ausgang von Michel de Certeau Tyrolia, 2023, 402 Seiten, Softcover, 978-3-7022-4125-4 45,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien
Band 101 Das Gebet auf dem Prüfstand Die Erfahrung des Gebets steht als Kernelement theoretischer wie praktischer Spiritualität im Zentrum der jüdisch-christlichen Tradition. Angesichts der fortgeschrittenen Säkularisierung der europäischen Gesellschaften und der Erosion der klassischen Metaphysik einerseits sowie der ambivalenten "Rückkehr" und Repolitisierung des Religiösen andererseits ist die Bedeutung des Gebets jedoch zu einer offenen Frage geworden. In diesem Kontext intendiert das Buch den Topos des Gebets im Nachgang der Werke des Theologen, Historikers und Kulturwissenschaftlers Michel de Certeaus SJ (1925-1986) einer neuen Lesbarkeit zuzuführen. Certeau vollzieht in seinen Arbeiten bereits früh die Wende von einer theologisch orientierten Forschung hin zu den Disziplinen der Humanwissenschaften. Gerade seine interdisziplinär angelegten Studien zur christlichen Spiritualität und Mystik sowie seine Untersuchungen zur säkularen Alltagskultur bieten sich deshalb für eine Reinterpretation des Gebets an. Als hermeneutischer Schlüssel erweist sich dabei die psychoanalytische Konzeption Jacques Lacans, von welcher insbesondere Certeaus spätere Arbeiten stark geprägt sind. Die darin zentrale Kategorie des Begehrens (désir) fungiert als wesentlicher Bezugspunkt für die psychoanalytisch informierte Übersetzung des Gebets in einen posttraditionalen Kontext. Dieser Ansatz erlaubt es, das Gebet als einen Ort der Konfrontation des Subjekts mit seiner Sterblichkeit und Verletzlichkeit zu betrachten sowie als eine Möglichkeit, das Begehren auf symbolische Weise zu realisieren, wodurch es den inhärenten Mangel der Existenz nicht verdrängt, sondern ihn als Bedingung der Liebe und Ausgangspunkt weltschöpferischer Kreativität gastfreundlich offen und aufrecht hält. Ausgezeichnet:Karl-Rahner-Preis 2022 Inhaltsverzeichnis |
 |
Hernán Rojas Wohin, Herr, willst du mich bringen? Eine Theologie der Berufung im Gespräch mit Karl Rahner Tyrolia, 2023, 540 Seiten, Softcover, 978-3-7022-4036-3 49,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien
Band 100 Berufung theologisch ergründet Nach dem christlichen Glauben wird jeder Mensch von Gott zum Leben in Fülle und zur Nachfolge seines Sohnes Jesus Christus berufen. Was heißt das aber theologisch? Und: was hat das mit der konkreten Lebensgestaltung eines Menschen von heute zu tun? Die vorliegende Studie fragt nach dem Berufungsphänomen in theologisch-systematischer Perspektive und sucht nach Antworten in der Heiligen Schrift, in den Geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola und in vier theologische Ansätze des 20. Jahrhunderts. Im Hauptteil wird das Augenmerk auf die Theologie Karl Rahners gerichtet. Obwohl Berufung auf dem ersten Blick kein zentrales Konzept für Rahners Denken zu sein scheint, erweist sich die Beschäftigung mit seiner Theologie dennoch als überaus fruchtbar, um das christliche Berufungsverständnis zu vertiefen."Berufung" begreift bereits in der Bibel etwas Grundlegendes des Handelns Gottes mit den Menschen. Der Versuch, eine vollständigere Theologie der Berufung zu entwickeln, zeigt auch, dass Berufung als ein Schlüssel für die Interpretation der gesamten menschlichen Existenz verstanden werden kann. Ausgezeichnet mit dem Karl-Rahner-Preis 2021 Leseprobe |
 |
Matthias Eller Extra Ecclesiam nulla salus Geschichte und Deutung einer anstößigen Lehre Tyrolia, 2021, 788 Seiten, Softcover, 978-3-7022-3995-4 59,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien
Band 99 Außerhalb der Kirche kein Heil? Das Axiom »extra Ecclesiam nulla salus« (wörtlich: »außerhalb der Kirche kein Heil«) zählt in seiner Sperrigkeit und Missverständlichkeit zu den anstößigsten Lehrformeln der katholischen Glaubensüberlieferung. Auf dem Weg biblischer, theologie- und lehramtsgeschichtlicher sowie systematischer Erkundung dokumentiert, analysiert und diskutiert diese Studie erstmals in deutscher Sprache umfassend und detailliert die Ursprünge, die Entwicklungsgeschichte und den dogmatischen Kerngehalt dieses heilsökonomischen Grundsatzes. Kompakte Zwischenbilanzen und Ertragsübersichten bündeln die aus der Heiligen Schrift und den historischen Quellen erschlossenen Erkenntnisse. Die systematische Zusammenschau identifiziert das Extra-Ecclesiam-Axiom schließlich seiner christologisch-soteriologischen Mitte entsprechend als kondensierten Ausdruck der um der Wahrheit der göttlichen Liebe und der menschlichen Freiheit willen notwendigen, stellvertretend in der Welt, vor aller Welt und für alle Welt vollzogenen sakramentalen Sendung der Kirche Christi zum Heil der gesamten Menschheit. |
 |
Aaron Langenfeld Frei im Geist Studien zum Begriff direkter Proportionalität in pneumatologischer Absicht Tyrolia, 2021, 40 Seiten, Softcover, 978-3-7022-3951-0 39,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien
Band 98 Mehr Mensch durch das Wirken Gottes Die christliche Theologie ist grundlegend geprägt von der Annahme, dass Gott und Mensch nicht in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Vor diesem Hintergrund ist Karl Rahners berühmt gewordene Aussage zu verstehen, dass der Mensch durch das Wirken Gottes nicht weniger, sondern mehr er selbst wird, die einen entscheidenden hermeneutischen Schlüssel zu seinem gesamten Denken darstellt. Allerdings hat diese Aussage auch vielfach entschiedenen Widerspruch erfahren, der die Begründungsbedürf-tigkeit des rahnerschen Grundaxioms selbst herausgestellt hat. Die vorliegende Arbeit versucht genau diese Lücke zu schließen und die Idee einer direkten Proportionalität von Gott und Welt unter den Vorzeichen aktueller freiheitstheoretischer Debatten zu vertei-digen. Innerhalb dieser defensio wird die stets vernachlässigte Pneumatologie als ent-scheidende Schnittstelle anthropologischer und theologischer Reflexion identifiziert und so innovativ als relevanter Begründungszusammenhang einer zeitgemäßen Hermeneutik des Glaubens erschlossen. Die vorliegende Studie wurde im Dezember 2020 von der Universität Innsbruck als Habili-tationsschrift im Fach Fundamentaltheologie angenommen. Lesepürobe |
 |
Daniel Remmel Die Leiblichkeit der Offenbarung Zur anthropologischen, offenbarungstheologischen und christologischen Relevanz der Lebensphänomenologie Michel Henrys Tyrolia, 2021, 630 Seiten, 982 g, Softcover, 978-3-7022-3922-0 59,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien
Band 97 „Und das Wort ist Fleisch geworden“ Die Neuere Französische Phänomenologie weckt seit einiger Zeit das Interesse des systematisch-theologischen Diskurses. Verglichen mit Emmanuel Levinas oder Jean-Luc Marion hat die Lebensphänomenologie von Michel Henry (1922–2002) aber bis hierhin nur wenig Aufmerksamkeit erhalten. Diese Lücke zu schließen ist das Anliegen dieser Studie. Sie fragt danach, wie man im Gespräch mit dem Ansatz Henrys theologische Grundbegriffe wie Offenbarung, Schuld und Erlösung deuten kann und wie man das Menschsein überhaupt und die Gottessohnschaft Jesu Christi unter besonderer Berücksichtigung der Leiblichkeit zur Sprache bringen kann. So ergibt sich eine Theologie, die sich am Grundwort des Johannesprologs („Und das Wort ist Fleisch geworden“, Joh 1,4) orientiert und das christliche Menschen-, Welt- und Gottesbild von der Inkarnation her denkt. Die Studie gliedert sich dabei in drei Teile: Zunächst rekonstruiert sie die Lebensphänomenologie im Horizont diverser phänomenologischer Ansätze (Husserl, Heidegger, Sartre, Derrida, Merleau-Ponty und Levinas). Sodann sucht sie das Gespräch mit aktuellen transzendental- und bewusstseinsphilosophischen Ansätzen (Krings, Henrich, Pothast, Frank), um eine Verständigung über den Subjektbegriff im Spannungsfeld von Bewusstsein, Freiheit, Leiblichkeit, Passivität und Intersubjektivität zu erzielen. Im letzten Teil werden die Reflexionslinien in einer theologischen Perspektive zusammengeführt, indem die Relevanz der Lebensphänomenologie für die theologische Anthropologie, die Offenbarungstheologie und die Christologie herausgearbeitet wird. Neben Thomas Pröpper dient dabei insbesondere Karl Rahner als Gesprächspartner. Ausgezeichnet mit dem Karl-Rahner-Preis 2020 Philosophie und Theologie im Dialog Leseprobe |
 |
Roman Siebenrock Karl Rahner in der Diskussion Erstes und Zweites Innsbrucker Rahner-Symposium: Themen - Referate - Ergebnisse Tyrolia, 2002, 320 Seiten, Paperback, 978-3-7022-2267-3 29,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien
Band 56 Das erste und zweite Innsbrucker Rahner-Symposium von 1993 und 1999 gaben jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die über das Werk Karl Rahners monographisch in jüngerer Vergangenheit gearbeitet haben, die Möglichkeit, ihre Thesen und Methoden zu erproben, sich persönlich zu begegnen und künftige Wege der Theologie zu erkunden. Die Veröffentlichung der einschlägigen Referate und Positionspapiere dieser beiden Symposien geben nicht nur einen Überblick über die wichtigsten Interpretationsthesen der jüngeren Vergangenheit in einer kaum übersehbaren Interpretationslandschaft, sondern dokumentieren auch die Wirkungsgeschichte des Werkes Karl Rahners in einer Generation, die ihn selbst nicht mehr persönlich kennenlernen konnte. Dabei werden die Hauptdiskussionsthemen von Kirche und Glaube heute zum Thema. Noch hat das Werk Karl Rahners seine Kraft nicht eingebüßt, theologische Verantwortung in der eigenen Gegenwart wahrzunehmen - auch dann noch von ihm inspiriert, wenn andere Optionen gewählt werden. In einer Zeit, in der die Gefahr wächst, daß uns das Werk Karl Rahners verlorengeht, werden in diesem Band Interpretationsstandards und methodische Kriterien zur Diskussion gestellt, die eine kritische Rezeption dieses Werkes im Dienst von Theologie und Kirche jenseits von Immunisierung und Hetze auch morgen ermöglichen. Univ.Prof. Dr. ROMAN SIEBENROCK, geb. 1957, ist Universitätsprofessor am Institut für Fundamentaltheologie der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Innsbruck. Lange Zeit war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karl-Rahner-Archiv. |
 |
Paul Rulands Menschsein unter dem An-Spruch der Gnade Das übernatürliche Existential und der Begriff der natura pura bei Karl Rahner Tyrolia, 398 Seiten, Broschur, 978-3-7022-2266-6 36,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien
Band 55 Neuscholastische Topoi im Werk Karl Rahners. Dieses Buch zeigt Zusammenhänge in den Schriften des großen Theologen auf. Für die Frage nach dem Verhältnis von Natur und Gnade hat die Gnadentheologie Rahners im Rahmen der katholischen Theologie dieses Jahrhunderts und darüber hinaus eine herausragende Bedeutung. Seinem fast allgemein rezipierten Theologumenon vom „übernatürlichen Existential“ kommt im heutigen theologisch-wissenschaftlichen Denken der Status eines „ersten Prinzips“ (Hansjürgen Verweyen) zu. Die sich einer genetisch-systematischen Methode bedienende eingehende Analyse von Rahners Gnadentheologie läßt äußerst präzise den neuscholastischen Hintergrund seines Denkens hervortreten und liefert damit zugleich eine neue methodisch-hermeneutische Perspektive für die Interpretation des Rahnerschen Werkes. Gerade auch in Konfrontation mit der Position Henri de Lubacs wird deutlich, wie sehr sich Rahner trotz aller Weiterentwicklung seiner Theologie grundsätzlichen Topoi der Neuscholastik bis in sein Spätwerk hinein verpflichtet gefühlt hat. |
 |
Johannes Herzgsell Dynamik des Geistes Ein Beitrag zum anthropologischen Transzendenzbegriff von Karl Rahner Tyrolia, 354 Seiten, 502 g, Broschur, 978-3-7022-2303-8 32,50 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien
Band 54 In der Studie wird ein zentraler Begriff der Philosophie und Theologie Karl Rahners unter drei Aspekten werkgenetisch und systematisch rekonstruiert: Die dynamische Offenheit des Menschen für Gott (philosophisch-fundamental-theologischer Aspekt); diese Hinordnung ist immer schon durch die Selbstmitteilung Gottes gnadenhaft erhöht (gnadentheologischer Aspekt); in ihr läßt sich die Unmittelbarkeit Gottes unter anderem im Trost ohne Ursache, im Enthusiasmus und in der Mystik bewußt erleben und erfahren (spirituell-theologischer Aspekt). |
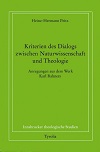 |
Heinz-Hermann Peitz Kriterien des Dialogs zwischen Naturwissenschaften und Theologie Anhand von Implikaten im Werk Karl Rahners Tyrolia, 1998, 450 Seiten, Broschur, 978-3-7022-2184-3 39,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien
Band 53 Ein neuer, interessanter Vorstoß im Dialog zwischen Naturwissenschaften und Theologie. Das Verhältnis zwischen Naturwissenschaften und Theologie bleibt häufig bei einer bloßen Abgrenzung friedlich-schiedlichen Nebeneinanders stehen. Im Gegensatz zu dieser Auffassung, für die immer wieder plädiert wird, zeigt die vorliegende Publikation, dass die Diskussion hier nicht stehenbleiben muss. Eine für beide Seiten nützliche Auseinandersetzung kann sich auf ein “Zwischengebiet” begeben, das mit der Naturphilosophie zwar nicht deckungsgleich, aber verwandt ist – man kann es auch “Weltanschauung” nennen. Besonders interessant ist, dass Heinz-Hermann Peitz auf seinem Denk-Weg mehrfach Anregungen des Theologen Karl Rahner auffindet und wie er diese zur Geltung bringt. |
 |
Peter Ebenbauer Hansjürgen Verweyens Fundamentaltheologie kritisch erörtert Tyrolia, 1998, 282 Seiten, Broschur, 978-3-7022-2180-5 26,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 52 Die Geschichte Gottes mit den Menschen vermag – gerade auch durch ihren Höhepunkt in Jesus von Nazaret – zu überzeugen. Hansjürgen Verweyen hat entschiedener als sonst jemand in den letzten Jahren für die Möglichkeit der Letztbegründung der christlichen Glaubensentscheidung plädiert: in seinem Hauptwerk ”Gottes letztes Wort” (619 S.; 1991, 2. Aufl. 1992). Er verbindet die philosophische Erörterung der in der Freiheit des Menschen aufbrechenden Hinordnung auf – universal – alle Menschen mit dem theologischen Ur-Datum der – radikalen – Selbstauslieferung Jesu für das Heil jedes Menschen. Diesen sehr bedenkenswerten Ansatz konfrontiert der Verfasser mit anderen gegenwärtigen Entwürfen hermeneutischer, politisch-praktischer und transzendentaler Art, um selbst im Vergleich mit Verweyen konsequenter die “freiheitsbegabte Vernunft” und offener die Überzeugungskraft des ganzen Jesus-Ereignisses und der ganzen Geschichte des Christentums zur Geltung zu bringen. Zur Seite Fundamentaltheologie |
 |
Wilhelm Guggenberger Niklas Luhmanns Systemtheorie Eine Herausforderung der christlichen Gesellschaftslehre Tyrolia, 1998, 256 Seiten, Broschur, 3-7022-2137-9 978-3-7022-2137-9 25,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 51 Die Systemtheorie: Auseinandersetzung und Weiterführung unter christlichen Gesichtspunkten. Die Steuerung der modernen hochkomplizierten Massengesellschaft ist ein Problem, das den Menschen seit geraumer Zeit beschäftigt. Die Komplexität der Strukturen – ein dem Chaos nahekommendes Übermaß an Möglichkeiten – ist reduzierbar durch die funktionale Differenzierung der Gesellschaft in „autopoietische“, d. h. selbstbezüglich-geschlossene Teilsysteme. So gelangt man in evolutionärer Entwicklung zwar zu enormer Leistungsfähigkeit, zerstört aber gleichzeitig im Keim das soziale Gefüge samt seiner Umwelt: Gewaltsame Weltbemächtigung schlägt um in absolute Selbstentmachtung des Menschen. Das Ergebnis ist ambivalent: Niklas Luhmann bietet mit seiner Systemtheorie zwar erhellende Analysen der modernen Gesellschaftsstrukturen, aber keine Hilfe zur Therapie. Wilhelm Guggenberger plädiert für eine Sozialethik auf christlich-religiöser Basis, deren Aufgabe es ist, die Theorie der Systembildung durch Umweltausschluss – nicht ohne Kritik – zu berücksichtigen. Er zeigt erste Schritte einer ausgewogenen Rezeption auf. |
 |
Josef Pichler Paulusrezeption in der Apostelgeschichte 13,16-52 Untersuchungen zur Rede im pisidischen Antiochien Tyrolia, 404 Seiten, Broschur, 3-7022-2096-8 978-3-7022-2096-9 38,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 50 Apostelgeschichte 13,16-52 Wahrheit oder Fälschung? Möchte man hier fragen. Lukas berichtet nicht authentisch über Paulus, sondern führt paulinisches Gedankengut weiter. Die bibelwissenschaftliche Untersuchung geht von einem scheinbar widersprüchlichen Befund aus: Lukas widmet dem von ihm hochgeschätzten Paulus den Haupteil seiner Apostelgeschichte – aber die Missionsreden, die Paulus nach-denkend selbst formuliert, sind zwar nicht vor-, aber nachpaulinisch. Ein „unpaulinischer Paulinismus“? In Wirklichkeit handelt es sich um ein fundamentales und exemplarisches Pastoralproblem: Das Doppelwerk des Lukas (Evangelium und Apostelgeschichte) ist an eine Gemeinde(gruppe) in Kleinasien gerichtet, die ursprünglich heidenchristlich war, ihre Gründung auf Paulus zurückführte und sein theologisches Erbe pflegte. Aber ihre Situation hat sich verändert durch Einwanderung nach dem Aufstand von 70 n.Chr. aus Palästina geflüchteter Judenchristen. Das brachte andere Fragen mit sich. Lukas nimmt deshalb paulinische Ausdrücke und Gedanken auf, aber er aktualisiert sie und akzentuiert sie neu durch eine hellenistisch-zeitgemäße „Legitimationstechnik“. |
 |
Bernd J. Claret Geheimnis des Bösen Zur Diskussion um den Teufel Tyrolia, 440 Seiten, Broschur, 978-3-7022-2074-7 40,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien Band 49 Ein fundierter Beitrag zur aktuellen theologischen Diskussion über die Existenz des Bösen in der Welt. Gibt es nichts Wichtigeres zu diskutieren? Die vorliegende Arbeit beantwortet diese Frage eindeutig. In Auseinandersetzung mit H. Haags Plädoyer “Abschied vom Teufel” und im Gespräch mit W. Kasper und K. Lehmann wird die mit der Frage nach dem Ursprung des Bösen verbundene theologische Problematik erhellt. Woher kommt ursprünglich das Böse? Das ist, zusammen mit der Frage nach dem Wesen des Bösen, die zentrale Frage der Untersuchung. Sie wird angesichts des vom Menschen verübten eminent Bösen zu einer quälenden Frage – vor allem dann, wenn gewichtige Gründe dafür sprechen, daß der Mensch als letzter Quellort und gleichsam Erfinder des Bösen – das nicht nur zum Himmel, sondern auch nach der Hölle schreit – eher nicht in Frage kommt. Bezogen auf konkrete Erfahrungen der Begegnung mit dem Bösen zeigt die Studie im Rückgriff auf Ricœurs Phänomenologie der Verfehlung, daß die mit dem Teufel verbundene Problematik die Frage nach der Vertretbarkeit einer “ethischen Weltanschauung” berührt, die den Grund des Bösen in der menschlichen Freiheit sucht. Im Anschluß an Ricoeur wird dargelegt, inwiefern das wirklichkeitsgesättigte Symbol des Teufels – wie kein anderes Symbol des Bösen – die Vernunft herausfordert und die philosophisch-theologische Reflekion in Gang bringt, kurzum: das Geheimnis der Bosheit “zu denken gibt”. Der Verfasser zeigt auf, was wirklich Lehre der Kirche ist. Er stellt vollständig die heutige deutschsprachige Literatur zum Thema vor. Bestürzend die von ihm z.B. anhand von Dostojewskis “Brüder Karamasoff” entwickelte Dramatik des “Geheimnisses des Bösen”. PD Dr. Bernd J. Claret, geb. 1963, 1991-2001 Wiss.Assistent am Lehrstuhl für Dogmatik und Theologische Propädeutik der Universität Bonn;2002-2005 Dozent für Dogmatik (Trier), 2008 Habilitation für das Fach Dogmatik. Seit 2009 Lehrtätigkeit als Privatdozent. |
 |
Dietmar W. Winkler Koptische Kirche und Reichskirche Altes Schisma und neuer Dialog Tyrolia, 1997, 376 Seiten, Broschur, 978-3-7022-2055-6 35,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien Band 48 Geschichte und Aufarbeitung eines Schismas geschieht hier detailgenau und übersichtlich: ein wichtiger Beitrag zum heutigen ökumenischen Dialog. Die vor allem in Ägypten lebenden Kopten sind seit dem 6. Jhdt. getrennt von der römisch-katholischen und der byzantinisch-orthodoxen “Reichskirche”. Anhand der Forschung der letzten Jahrzehnte wird gezeigt, wie es zum Schisma kam: In den Differenzen über das Verhältnis der göttlichen und der menschlichen Natur in Jesus Christus spiegelt sich das jeweils verschiedene Verständnis der theologischen Begriffe. Auch nichttheologische Faktoren (Eingreifen Kaiser Justinians, Vorrangstreit der östlichen Patriarchen) haben Schuld an der Trennung (seit 537). Dietmar W. Winkler dokumentiert sämtliche konfessionellen Dialoge der Gegenwart. Basis und Leitidee erreichter und zu erreichender Versöhnung: zurückzufragen hinter die geprägten Lehrformeln zu dem von der lebendigen Liturgie bezeugten gemeinsamen Glauben. Dieser Band hat Chancen, ein oder das umfassende Nachschlagewerk für dieses Thema zu werden. |
 |
Arno Zahlauer Karl Rahner und sein produktives Vorbild Ignatius von Loyola Tyrolia, 384 Seiten, Broschur, 3-7022-2054-2 978-3-7022-2054-9 36,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien,
Tyrolia Band 47 Die Studie zeigt eindrucksvoll die Spiritualität des Ignatius von Loyola und die von ihr tief geprägte Theologie Karl Rahners. Wie sehr Karl Rahner als Jesuit von der Spiritualität, besonders von den „Exerzitien“ seines Ordensvaters geprägt wurde, ist eine eher neuere „Entdeckung“. Arno Zahlauer geht den frühesten Zeugnissen über den ignatianischen Ursprung des geistlichen Leben Rahners nach. Er konnte im Innsbrucker Karl-Rahner-Archiv die einzigartige Dokumentation der Denk- und Lebensgeschichte des jungen Rahners auswerten: Der spirituelle Traditionsstrom von Origenes (3. Jhdt.) zu Bonaventura (13. Jhdt.) erschließt die innere Welt unmittelbarer Gotteserfahrung, die das ganze Werk Rahners (transzendental) bestimmt. Als ergänzende (kategoriale) Linie würdigt der Autor die Herz-Jesu-Frömmigkeit , die Rahner pflegte und theologisch auslegte. Unter beiden Aspekten (transzendental/kategorial) wurde Ignatius von Loyola für Rahner – nach dessen eigener Formulierung – das „produktive Vorbild“. ARNO ZAHLAUER, Dr. theol., geb. 1964. Studium der Philosophie und Theologie in Freiburg und Innsbruck. Sechs Jahre lang als Sekretär des Erzbischofs Oskar Saier tätig. Priester und geistlicher Begleiter. Seit 2000 in der Exerzitienarbeit tätig. Direktor des geistlichen Zentrums St. Peter, Erzdiözese Freiburg. |
|
Ralf Stolina Die Theologie Karl Rahners: Inkarnatorische Spiritualität Menschwerdung Gottes und Gebet Tyrolia, 320 Seiten, Broschur, 3-7022-2053-4 978-3-7022-2053-2 26,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien,
Tyrolia Band 46 Sowohl eine systematische Vorstellung der zentralen theologischen Aussagen Karl Rahners als auch eine ausführliche Darlegung seiner Theologie des Gebets bietet dieser Band. Die an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Münster verfasste Dissertation leistet ein Zweifaches: Erstens eine systematische Grundlegung von der Mitte des theologischen Werkes Karl Rahners aus: der Selbstmitteilung Gottes in Jesus, der Inkarnation des Gottes- im Menschensohn. Der Verfasser wird spezifischen Rahner-Theologumena, die nicht selten ungemäß verstanden werden, voll und ganz gerecht (z. B. dem „übernatürlichen Existenzial“, dem „Glaubenslicht“, dem Unterschied transzendental/kategorial). Zweites wird aus dem Schrifttum Rahners seine von der Christologie durchpulste Theologie des Gebets in erstmaliger Ausführlichkeit und Gründlichkeit aufgebaut und ausgebreitet. Ralf Stolina plädiert für eine recht verstandene Gotteserfahrung im Gebet – in der Mystik des Alltags; er räumt der Spiritualität des Ignatius von Loyola einen außergewöhnlichen Stellenwert ein. |
|
 |
Franz Gmainer-Pranzl Glaube und Geschichte bei Karl Rahner und Gerhard Ebeling Ein Vergleich transzendentaler und hermeneutischer Theologie Tyrolia, 378 Seiten, Broschur, 3-7022-2044-5 978-3-7022-2044-0 36,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 45 Was bedeutet die Geschichte für den christlichen Glauben? Zwei prominente Theologen des 20. Jahrhunderts geben unterschiedliche Antworten. Franz Gmainer-Pranzl versucht in seiner 1994 mit dem „Karl-Rahner-Preis für theologische Forschung“ ausgezeichneten Arbeit einen Vergleich. Nach Karl Rahner ist der Mensch darauf ausgerichtet, daß Gott sich ihm mitteilt. Der göttliche Auftrag kann aber nur in der Geschichtlichkeit der Welt verwirklicht werden. Christen sind deshalb auf die Geschichte verwiesen, in der sie ihre Berufung ausdrücken und verwirklichen können. Nach Gerhard Ebeling ergeht Gottes Wort an die Menschen. Es trifft ihr Gewissen und bringt ihre wahre Stellung in der geschichtlichen Welt zwischen Gut und Böse zur Sprache. Geschichte wird so zum „Bewährungsfeld des Menschen“. Franz Gmainer-Pranzl stellt beide Entwürfe differenziert und ausführlich dar. Er weist kompetent und fachkundig auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Transzendentaler und Hermeneutischer Theologie hin. Gegenüber beiden – dem katholischen und dem evangelischen – Theologen bleibt die kritische Frage, ob nicht – auf verschiedene Weise – die Freiheit des Menschen durch Gottes Vorwegbestimmung aufgehoben wird. |
|
Dirk Ansorge Johannes Scottus Eriugena: Wahrheit als Prozeß Eine theologische Interpretation von "Periphyseon" Tyrolia, 1996, 370 Seiten, Broschur, 3-7022-2029-1 978-3-7022-2029-7 35,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 44 Das Denken Karl Rahners wird als „transzendental“ bezeichnet. Dieses Wort benennt bei Kant, der es in die Philosophie einführte, die im menschlichen Subjekt liegenden Voraussetzungen objektiver Erkenntnis. Es gibt in Bezug auf Rahner Anlass zum Verdacht, er reduziere die Theologie auf Anthropologie, gar auf radikalen Subjektivismus; oder wenigstens zum Vorwurf, er gehe unwissenschaftlich mit einem eigentümlichen Kantischen Begriff um. Die Arbeit untersucht in klarem Aufbau den Sprachgebrauch von „transzendental“ bei Rahner von den früheren Schriften „Geist in Welt“ und „Hörer des Wortes“ bis zum späten zusammenfassenden „Grundkurs des Glaubens“ und in Kants Hauptwerk „Kritik der reinen Vernunft“, um in einem Vergleich Gemeinsamkeit und Unterschied zu registrieren. Das Resultat ist eine tiefschürfende Rechtfertigung des sich wandelnden und nicht problemlosen Sprachgebrauchs bei Rahner. Eine philosophische Dissertation mit Sinnspitze Theologie! |
|
 |
Stephan Kessler Gregor der Grosse als Exeget Eine theologische Interpretation der Ezechielhomilien Tyrolia, 1995, 290 Seiten, Broschur, 3-7022-2005-4 978-3-7022-2005-1 28,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 43 Diese umfassende und grundlegende Arbeit zeigt anhand des Ezechielkommentars von Gregor dem Großen den Übergang der Exegese von der Spätantike zum Mittelalter. Die Schriftauslegung des Papstes Gregor des Großen (540-604) in seinem Kommentar zum Propheten Ezechiel ist beispielhaft für die Exegese im Übergang von der Antike zum Mittelalter. Sie hat das Schriftverständnis der folgenden Jahrhunderte wesentlich mitgeprägt und besonders die Lehre von den vier Schriftsinnen vorbereitet, die über die fundamental(istisch)e wörtliche Textdeutung hinausweist. Gregor trieb Exegese in einem ganzheitlichen Kontext: Seine Schriftauslegung ist getragen und beseelt von der eigenen geistlichen Erfahrung. Diese auch tiefere Bedeutungsschichten auslotende Form der Exegese ist von Interesse auch für die heutige Diskussion der bibelwissenschaftlichen Methoden. Die Arbeit erforscht zugleich den Einfluß des ganzen geistes- und kulturgeschichtlichen Umfeldes sowie der frühchristlichen Theologie. |
 |
Reinhard Messner Bewahren und Erneuern Studien zur Messliturgie. Festschrift für Hans Bernhard Meyer SJ zum 70. Geburtstag Tyrolia, 1995, 416 Seiten, Broschur, 3-7022-1968-4 978-3-7022-1968-0 39,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 42 Eine „Editio typica tertia“ des Missale Romanum ist geplant; und seit etlichen Jahren berät die IAG-„Studienkommission für die Messliturgie und das Messbuch“ über Verbesserungen. Zu dieser Erneuerungsarbeit soll der Band einen wissenschaftlich fundierten Beitrag leisten. Die 21 Autoren – Liturgiker und Pastoraltheologen – befassen sich mit Schriftlesungen und Homilie, Orationen, dem Eucharistischen Hochgebet, Gesang und Musik, der rituellen Struktur, behandeln grundsätzliche Themen wie etwa die Rolle der Gemeinde. Sie fragen, wie die Feier heute wesensgemäß vollzogen werden kann, und geben Impulse für eine Weiterentwicklung. Dass es nicht um willkürlichen Umbau des Gewordenen geht, zeigt der Titel der Festschrift an. Die wesentliche Sinn- und Feiergestalt der Eucharistie bleibt unantastbar. Doch gerade, damit die Gestalt recht erfahren und verwirklicht wird, muss man von Zeit zu Zeit auch Bücher, Texte, Ordnung revidieren. |
 |
Margit Eckholt Vernunft und Leiblichkeit bei Nikolaus Malebranche Tyrolia, 1994, 480 Seiten, Broschur, 978-3-7022-1932-1 42,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien,
Tyrolia Band 41 Die christologische Vermittlung seines rationalen Systems Gegen die Einstufung von Malebranche als Cartesianer zweiter Garnitur, der sich in ontologistische „Mystik“ der Gottesschau verstieg, wird gezeigt: Malebranche blieb durchaus dem kritischen Denken Descartes´ verpflichtet. Er hat dieses jedoch, indem er in den Grund der Vernunft lotete, christologisch zu begründen versucht. Denn ganzheitlich gesehen sei der Mensch aufgrund seiner Leib-Seele-Einheit (erb)sündig verfasst und auf Versöhnung in und durch Geschichte angewiesen; er ist nicht nur Vernunft, sondern „inkarnierte Vernunft“, und das Versöhnungsprinzip ist für ihn die „Raison incarée“ in Person: Jesus Christus. Von besonderem Interesse sind die Ausführungen über die Gottesbeweise bei Descartes und Malebranche: Frau Dr. Eckholt legt eine Lanze ein für das recht verstandene „ontologische Argument“. |
 |
Franz Gruber Diskurs und Konsens im Prozess theologischer Wahrheit Tyrolia, 1993, 350 Seiten, kartoniert, 3-7022-1881-5 978-3-7022-1881-2 25,50 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 40 Der Verfasser geht aus von dem Befund, es gebe keine dem heutigen philosophischen Problemstand entsprechende theologische Theorie der Wahrheit. Dieses Defizit und zugleich Momente seiner Überwindung findet er in drei Fallbeispielen aus diesem Jahrhundert, der „Modernismuskrise“ (A. Loisy; E. Le Roy), der wissenschaftstheoretischen Reflexion (W. Pannenberg; H. Peukert) und der Debatte über die päpstliche Unfehlbarkeit. Besonders eindringlich ist der Autor bei Rahner jenen Ansätzen auf der Spur, die der Theologie „auf die Sprünge helfen“ können. Er erhofft dies von Diskurs und Konsens „kollektiver Wahrheitsfindung“ (so schon Rahner) – nicht als alleinigem Heilmittel, aber doch als unverzichtbarem Beitrag - wie dies J. Habermas wahrheitstheoretisch entwickelt hat und mit Ingolf U. Dalferths Analyse religiöser Rede von Gottes Offenbarung theologisch angewendet werden kann. Eine qualifizierte Herausforderung, sich damit kritisch auseinander zu setzen. |
 |
Nikolaus Knoepffler Der Begriff transzendental bei Karl Rahner Zur Frage seiner Kantischen Herkunft Tyrolia, 214 Seiten, Broschur, 3-7022-1880-7 978-3-7022-1880-5 16,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 39 Das Denken Karl Rahners wird als „transzendental“ bezeichnet. Dieses Wort benennt bei Kant, der es in die Philosophie einführte, die im menschlichen Subjekt liegenden Voraussetzungen objektiver Erkenntnis. Es gibt in Bezug auf Rahner Anlass zum Verdacht, er reduziere die Theologie auf Anthropologie, gar auf radikalen Subjektivismus; oder wenigstens zum Vorwurf, er gehe unwissenschaftlich mit einem eigentümlichen Kantischen Begriff um. Die Arbeit untersucht in klarem Aufbau den Sprachgebrauch von „transzendental“ bei Rahner von den früheren Schriften „Geist in Welt“ und „Hörer des Wortes“ bis zum späten zusammenfassenden „Grundkurs des Glaubens“ und in Kants Hauptwerk „Kritik der reinen Vernunft“, um in einem Vergleich Gemeinsamkeit und Unterschied zu registrieren. Das Resultat ist eine tiefschürfende Rechtfertigung des sich wandelnden und nicht problemlosen Sprachgebrauchs bei Rahner. Eine philosophische Dissertation mit Sinnspitze Theologie! |
 |
Jozef Niewiadomski Dramatische Erlösungslehre Ein Symposion Tyrolia, 1992, 392 Seiten, Broschur, 3-7022-1841-6 978-3-7022-1841-6 28,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 38 Der Band enthält die Beiträge des Symposions, welches im Herbst 1991 abgehalten wurde, um zu dem Entwurf einer Erlösungslehre des Innsbrucker Dogmatikers Raymund Schwager Stellung zu beziehen. Schwager setzt seit den 1970er Jahren die nicht unumstrittene Kulturtheorie des französischen, in den USA lehrenden Literaturwissenschaftlers René Girard konsequent in die Theologie ein. In dem vorliegenden Band kommen neben evangelischen und katholischen Theologen, Pädagogen, Psychologen, und Philosophen zu Wort, wodurch ein Panorama lebendiger Gegenwartstheologie, aber auch ein Stück Kulturphilosophie und Kulturkritik der besten Art geboten wird. |
 |
Andrea Tafferner Gottes- und Nächstenliebe in der deutschsprachigen Theologie des 20. Jahrhunderts Tyrolia, 1992, 336 Seiten, Broschur, 3-7022-1840-8 978-3-7022-1840-9 25,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 37 Andrea Tafferner bietet in ihrer vorliegenden Dissertation, für die sie den „Karl-Rahner-Preis für theologische Forschung“ des Jahres 1992 erhielt, eine repräsentative Dokumentation katholischer und evangelischer Theologen. Für ihre Forschung untersuchte sie deren Werke bezüglich des Verhältnisses von Gottes- und Nächstenliebe. Dabei wird vor allem auch die Zeitgebundenheit (Drittes Reich, Zweites Vaticanum) theologischer Aussagen deutlich. Im Anschluss daran finden sich sieben verschiedene Ansätze, wie eine spezifisch christliche Liebe formuliert werden kann. Diese stellt Andrea Tafferner zur Diskussion und schließt ihre Arbeit mit einer eigenen Stellungnahme. Ausgehend vom biblischen Ursprung und den jüdischen Wurzeln des Christentums plädiert sie für eine „Vorleistungen erbringende Nächstenliebe“. Eine ausführliche Bibliographie rundet die Arbeit ab. Dieses theologisch-wissenschaftliche Buch kann auch interessierten Laien empfohlen werden. |
 |
Wolfgang Palaver Politik und Religion bei Thomas Hobbes Eine Kritik aus der Sicht der Theorie René Girards Tyrolia, 1991, 388 Seiten, 550 g, Broschur, 978-3-7022-1788-4 28,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 33 Der englische Staatsphilosoph Thomas Hobbes (1588-1679) ist immer wieder aktuell. In den 1980er Jahren war sein Name mit friedens- und demokratiepolitischen Debatten und Fragen verbunden. Wolfgang Palaver untersucht in seiner Dissertation mittels der Theorie des französischen Literatur- und Kulturwissenschaftlers René Girard das Verhältnis von Religion und Politik bei Hobbes auf mehreren Ebenen. Neben den Texten von Hobbes und denen zeitgenössischer Autoren beschäftigt sich Palaver mit den von Hobbes berücksichtigten, aber auch ausgelassenen biblischen Traditionen zu diesem Thema. Sie werden nach ihrem Gehalt im Kontext der biblischen Offenbarung sowohl in historisch-kritischer Hinsicht als auch von einem systematischen Standpunkt her (dem der Theorie Girards) befragt. Um kritische Urteile über die Position von Hobbes zu fällen, bedient sich der Autor eines bibeltheologischen Entwurfs, der den Fragen nach Gewalt und Gewaltverzicht und jenen nach der Legitimierung politischer Macht durch theologische Denkstrukturen unter Auswertung der gegenwärtigen theologischen Diskussion nachgeht. |
 |
Engelbert Guggenberger Karl Rahners Christologie und heutige Fundamentalmoral Tyrolia, 1990, 224 Seiten, Broschur, 3-7022-1715-0 978-3-7022-1715-0 25,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 28 Die Theologie Karl Rahners hat eine Doppelstruktur: Der Mensch ist durch seine Geistnatur hingeordnet auf den transzendenten Gott, und diese natürliche Wesensbestimmung ist nochmals umfangen von dem gnadenhaften Angebot Gottes, dem Menschen sein eigenes Leben mitzuteilen. Die Höchstform dieser Selbstmitteilung Gottes ist die Menschwerdung in Christus. Zugleich sind wir Menschen von Natur aus und durch die Offenbarung Gottes hineinverwiesen in die Welt und ihre Geschichte und darin entscheidend in das Offenbarungsgeschehen, das sich mit Jesus von Nazareth ereignet hat. Aus diesem zwei-einen Verhältnis – auf Gott hin/innerhalb dieser Welt – folgt das Doppelgebot der voneinander untrennbaren Gottes- und Nächstenliebe. |
 |
Bernd J. Hilberath Der Personbegriff der Trinitätstheologie in Rückfrage von Karl Rahner zu Tertullians "Adversus Praxaen" Tyrolia, 1986, 366 Seiten, Broschur, 978-3-7022-1588-0 38,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 17 Mit seiner Habilitationsschrift, welcher der „Karl-Rahner-Preis für theologische Forschung“ des Jahres 1986 zuerkannt wurde, liefert Hilberath im Blick auf das Geheimnis der Dreifaltigkeit (Trinität) einen Beitrag zum besseren Verständnis auch dessen, was menschliches Personsein bedeutet. Nicht die Gottesfrage überhaupt, sondern namentlich die Dreieinigkeitslehre ist heute mehr denn je auch in der ökumenischen theologischen Diskussion zum Problem geworden. Hilberath untersucht den Vorschlag von K. Rahner, den Begriff Person in der Trinität durch „distinkte Subsistenzweise“ zu ersetzen, prüft den modernen Personbegriff, der Rahner zu seiner Initiative veranlasst hat, und geht auf den Beginn der lateinischen Theologie zurück, wo Tertullian den Begriff „persona“ als erster systematisch in der Trinitätslehre anwendet. |
 |
Bernhard Kriegbaum Kirche der Traditoren oder Kirche der Märtyrer? Die Vorgeschichte des Donatismus Tyrolia, 1986, 186 Seiten, Broschur, 978-3-7022-1587-3 20,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 16 Die historische und die theologische Forschung fragt sich schon seit langem und verstärkt seit den 1950er Jahren nach den wirklichen Ursachen des Ausbruchs und der Zählebigkeit des nordafrikanischen Schismas des Donatismus. Erkennbar ist dabei die zunehmende Tendenz, die Bedeutung der außerreligiösen Faktoren geringer zu veranschlagen und die autonome provinziale Tradition des nordafrikanischen Christentums höher zu veranschlagen. Die vorliegende theologische Dissertation lässt sich in diesen Trend gut einordnen. Dass die traditio in Afrika so hohen Stellenwert erhielt, lässt sich auf die zu schnelle Mission ohne tiefgreifende innere Christianisierung, das Fehlen eines eigenen Lehrdisputs und den Unterschied von westlichem und östlichem Konzilstypus zurückführen. Ausschlaggebend für das Zustandekommen der Spaltung der Kirche war letzten Endes aber die tiefreichende Vertrauenskrise innerhalb der Kirche und sogar innerhalb des Episkopats. Wohl selten in der Geschichte gab es ein deutlicheres Beispiel für die Notwendigkeit des Dialogs innerhalb der Kirche, als es die Vorgeschichte des donatistischen Schismas liefert. zur Seite Märtyrer |
 |
Lothar Lies Origenes' Eucharistielehre im Streit der Konfessionen. Die Auslegungsgeschichte seit der Reformation Tyrolia, 1985, 424 Seiten, 590 g, Broschur, 978-3-7022-1572-9 43,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 15 Das Buch beinhaltet die reich belegte Geschichte der Eucharistielehre seit der Reformationszeit. Die vorliegende Habilitationsschrift hat die Wirkungsgeschichte des Origenes in der Neuzeit zum Gegenstand, und zwar des näheren die Rezeption seiner Eucharistielehre vom Zeitalter der Reformation bis zur Gegenwart. Von Erasmus bis Balthasar dehnt der Verfasser das Feld seiner Untersuchungen aus, findet bestimmte Interpretationsmuster und stellt schließlich fest, dass es weder bei Protestanten noch bei Katholiken zu einer adäquaten Rezeption der Eucharistieauffassung des Origenes gekommen ist. |
 |
Hans Kraml Die Rede von Gott - sprachkritisch rekonstruiert aus Sentenzenkommentaren Tyrolia, 184 Seiten, Broschur, 978-3-7022-1522-4 20,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 13 In der vorliegenden Dissertation soll, durch die sprachanalytisch orientierte Philosophie dazu angeregt, die Absicht des Die Redens von Gott in den mittelalterlichen Sentenzenkommentaren rekonstruiert werden. Ziel der Arbeit ist der Versuch, in Hinblick auf die gegenwärtige Diskussion und gelegentliche Ratlosigkeit aufzuzeigen, was eine Annahme Gottes oder Ablehnung Gottes beinhaltet, das so zu formulieren, dass man darüber mit Argumenten kritisch diskutieren kann, und zu zeigen, dass das so entfaltete Gottesverständnis mit dem mittelalterlicher Theologen übereinstimmt. Die Arbeit ist ein engagiertes, klar argumentierendes und bemerkenswert lesbares Plädoyer für die Auffassung der Theologie als praktische Wissenschaft. Sie wurde inspiriert durch die Einsichten Wittgensteins. Die Rekonstruktionsversuche erfolgen mittels der Methoden der Erlanger Schule. |
 |
Franz J. Niemann Jesus als Glaubensgrund in der Fundamentaltheologie der Neuzeit Zur Genealogie eines Traktats Tyrolia, 488 Seiten, Broschur, 978-3-7022-1444-9 47,00 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 12 Gegenstand dieser Dissertation, die vom Fürstentum Liechtenstein mit dem „Preis für wissenschaftliche Forschung an der Universität Innsbruck ausgezeichnet wurde, ist der Traktat „De Christo legato divino“. Es wird nach der Legitimation des Christentums gefragt, in dessen Zentrum Jesus steht. Jesus, der sich durch sein Leben, seine Lehre, sein Wirken, seine Wunder, durch die sich in ihm erfüllenden alttestamentlichen Prophezeiungen und durch seine Auferstehung als Gesandter Gottes (legatus divinus) legitimiert und das Christentum als Offenbarungsreligion ausweist. Die Arbeit erörtert, wie diese Argumente in der neuzeitlichen Theologie ausgeführt wurden und sich gewandelt haben: Renaissance, Aufklärung, katholische Tübinger und Wiener Schule, Neuscholastik und Gegenwart. Als Vertreter des Zeitalters der Aufklärung werden auch die beiden Benediktiner Martin Gerbert von St. Blasien und Beda Mayr von Donauwörth gewürdigt. Zur Seite Fundamentaltheologie |
 |
Józef Niewiadomski Die Zweideutigkeit von Gott und Welt in J. Moltmanns Theologien Tyrolia, 1982, 168 Seiten, Broschur, 978-3-7022-1445-6 17,50 EUR |
Innsbrucker
Theologische Studien Band 9 Die Theologie Moltmanns hat seit den 1960er Jahren auf viele sehr anregend gewirkt. Zugleich wurde sie von manchen als verwirrend empfunden. Die vorliegende Arbeit versucht, die innere Struktur dieses theologischen Denkens zu rekonstruieren. Sie stößt dabei zum Ergebnis vor, dass es gar keine einheitliche Struktur gibt, sondern mindestens zwei Grundvorstellungen vorhanden sind, die sich nicht aufeinander reduzieren lassen und die auch mit der traditionellen Theologie nicht vereinbar sind. Die beiden Grundmuster beziehen sich einerseits darauf, dass Moltmann Gott als den eindeutigen Zielpunkt einer widersprüchlichen weltlichen Wirklichkeit aufzeigt, und andererseits wird Gott selber widersprüchlich und Vorstellungen von der Selbstbeschränkung Gottes tauchen auf. Gott ist bei Moltmann ein zerrissener, widersprüchlicher und somit auch ein tragischer Gott. Dies in umfassender Weise aufzuzeigen, wie es bisher noch nicht geschehen ist, leistet die vorliegende Arbeit. |
| Innsbrucker Theologische Studien, Tyrolia | ||||||
| Autor | Titel | EUR | Jahr | |||
| 1 | 978-3-7022-1299-5 | Lothar Lies | Wort und Eucharistie bei Origenes. Zur Spiritualisierungstendenz des Eucharistieverständnisses | 35,00 |
|
|
| 2 | Lambert | Franz von Baaders Philosophie des Gebetes | 27,40 |
|
||
| 3 | Schwalbach | Firmung und religiöse Sozialisation | 16,90 |
|
||
| 4 | Neufeld | Adolf von Harnacks Konflikt mit der Kirche | 19,-- |
|
||
| 7 | Funk | Status und Rollen in den Paulusbriefen | 19,-- |
|
||
| 10 | Siegfried | Vernunft und Offenbarung bei dem Spätaufklärer Jakob Salat | 29,50 |
|
||
| 11 | Schneider | Unterscheidung der Geister | vergriffen | 1983 | ||
| 18 | Schermann | Die Sprache im Gottesdienst | 20,50 |
|
||
| 19 | Origeniana Quarta | 43,50 |
|
|||
| 20 | Klausnitzer | Das Papsttum im Disput zwischen Lutheranern und Katholiken | 56,--- |
|
||
| 21 | Römelt | Personales Gottesverständnis in heutiger Moraltheologie | 29,50 |
|
||
| 22 | Prammer | Die philosophische Hermeneutik Paul Ricoeurs in ihrer Bedeutung für eine theologische Sprachtheorie | 25,50 |
|
||
| 23 | Willers | Friedrich Nietzsches antichristliche Christologie | 41,--- |
|
||
| 24 | Budzik | Doctor pacis | 29,50 |
|
||
| 25 | Meßner | Die Meßreform Martin Luthers und die Eucharistie der Alten Kirche | 26,--- |
|
||
| 26 | Schaupp | Der Pfarrgemeinderat | 22,40 |
|
||
| 27 | Hasitschka | Befreiung von Sünde nach dem Johannesevangelium | 31,--- |
|
||
| 29 | 3-7022-1746-0 | Raymund Schwager | Jesus im Heilsdrama. Entwurf einer biblischen Erlösungslehre | vergriffen | ||
| 30 | 3-7022-1747-9 | Hoping | Freiheit im Widerspruch | 36,--- |
|
|
| 31 | Kirchberg | Thelogie in der Anrede als Weg zur Verständigung zwischen Juden und Christen | 24,--- |
|
||
| 32 | Freitag | Sacramentum ordinis auf dem Konzil von Trient | 42,--- |
|
||
| 34 | Mali | Das Opus imperfectum im Matthaeum | 28,70 |
|
||
| 35 | 3-7022-1806-8 | Hell | Die Dialektik des Wortes bei Martin Luther | 21,--- |
|
|
| 36 | Leher | Begründung ethischer Normen bei Viktor Cathreins | 16,90 |
|
||