| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Das Böse | ||
 |
Jonas Goehl Gottes Vermögen zum Bösen Pustet Verlag, 2024, 264 Seiten, kartoniert, 15,7 x 23,3 cm 978-3-7917-3499-6 44,00 EUR |
ratio fidei
Band 86 Eine historische Untersuchung in systematischer Absicht Reden über die moralische Vollkommenheit und die Liebe Gottes gehören zum Kernbestand christlicher Theologie. Was aber sind die freiheitstheoretischen Bedingungen solcher Aussagen? In exemplarischen Studien zu Wilhelm von Ockham, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Hermann Krings zeigt diese Arbeit, dass aufgrund der Nachwirkung neuplatonischer Denkfiguren ein freiheitliches Vermögen Gottes zum moralisch Guten zwar behauptet, jedoch nicht gedacht wird. Denkbar wird dies erst dann, wenn man Gott auch ein Vermögen zum Bösen unterstellt. Soll der Begriff göttlicher Freiheit nicht äquivok zum Begriff menschlicher Freiheit bestimmt werden, ist diese Einsicht theologisch umzusetzen. |
 |
Paul Metzger Zum Teufel! – Die Frage nach dem Bösen Narr Francke, 2020, 106 Seiten, Softcover, 978-3-89308-461-6 14,99 EUR |
Der Teufel hat die Hölle verlassen
und ist ausgewandert in die Deutung der Welt. Das Buch gibt Antworten und stellt Fragen. Damit am Ende nicht alles „zum Teufel“ geht.Zum Teufel und zur Hölle damit. Der Teufel hat keine Lust mehr. Er ist weg und die Hölle ist leer. Doch: Wo ist der Teufel heute? Er ist ausgewandert in die Deutung der Welt. . Er ist eine Antwort auf die Frage: Warum leiden wir? Doch es gibt noch andere Fragen: Sind wir daran selbst schuld? Sind wir verantwortlich für das Böse? Oder hat Gott damit etwas zu tun? Warum gibt es das Böse überhaupt? Und was ist eigentlich „böse? Das Buch gibt Antworten und stellt Fragen. Damit am Ende nicht alles „zum Teufel“ geht. |
 |
Heinrich Christian Rust Und wenn die Welt voll Teufel wär ... Christen in der Auseinandersetzung mit dunklen Mächten Neufeld Verlag, 2019, 254 Seiten, Softcover, 978-3-937896-55-7 20,00 EUR |
In den letzten Jahren erwachte ein neues Bewusstsein für die Existenz des Bösen. In diesem Buch zeichnet Heinrich Christian Rust ein Bild dieses realen Kampfes zwischen Gut und Böse. Indem er die Aussagen der Bibel zur unsichtbaren Wirklichkeit wahr- und ernst nimmt, gelingt ihm eine nüchterne Bestandsaufnahme. Zwischen fundamentalistischer Schwarz-Weiß-Malerei, rationalistischer Leugnung und charismatischer Erfahrungs-Theologie findet Rust zu einer biblisch begründeten Position. Dabei bleibt das Buch nicht theoretisch: Am Ende gibt der Autor auch handfeste Ratschläge für den Umgang mit dämonischen Belastungen in der Praxis. Inhaltsverzeichnis |
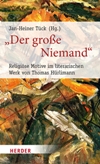 |
Jan Heiner Tück Der große Niemand Religiöse Motive im literarischen Werk von Thomas Hürlimann Herder Verlag, 2018, 288 Seiten, Gebunden, Schutzumschlag, 12,5 x 20,5 cm 978-3-451-38183-6 24,00 EUR |
Poetikdozentur Literatur und Religion
Band 2 Thomas Hürlimann gehört zu den profiliertesten Stimmen der Gegenwartsliteratur. Die Beiträge aus Literaturwissenschaft, Philosophie und Theologie gehen den religiösen Motiven im Werk des Schweizer Schriftstellers nach. Der Titel »Der große Niemand« spielt auf die durchgehende Präsenz der Themen ‚Tod‘ und ‚Theodizee‘ in Hürlimanns literarischen Werk an. Woher kommt das Böse, wenn Gott doch gut ist? Leseprobe |
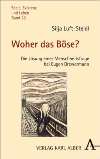 |
Silja Luft-Steidl Woher das Böse? Die Lösung einer Menschheitsfrage bei Eugen Drewermann Verlag Karl Alber, 2016, 184 Seiten, kartoniert, 13,5 x 21,5 cm 978-3-495-48885-0 29,00 EUR |
Seele, Existenz und Leben Band 28 Diese theologische Magisterarbeit ist ein Beitrag für Wissenschaftler und allgemein Interessierte, die in der Frage nach dem Bösen Orientierung suchen. Seit Jahrtausenden verwirken Menschen ihr eigenes und gemeinsames Glück durch Einstellungen und Verhaltensweisen, die die kirchliche Tradition mit dem Begriff der »Sünde« erklärt. Ob man Sünde heute als verstaubten Begriff abtut oder am moralistischen Traditionsstrang der Selbstdisziplinierung festhält – die Erklärungsnot für Ursachen und Umgang mit dem Bösen bleibt bestehen. Seit den 1980er-Jahren hat der von der Katholischen Kirche verfemte Theologe und Psychoanalytiker Eugen Drewermann Zusammenhänge zwischen den tiefenpsychologischen Motivationen, biblisch-mythologischen Überlieferungen und wiederkehrenden Verhaltensmustern der Menschen ans Licht gebracht, die das Bild vom sich selbst bezwingenden Menschen umkehrt und einbettet in eine Matrix existenzieller Bedürftigkeit: Kein Mensch könne »gut« sein, der sich nicht bedingungslos angenommen fühle. Drewermann appelliert damit an ein angstnehmendes Christentum sowohl im Individuellen als auch in den sozialen Verkettungen von Sünde und Schuld. Silja Luft-Steidls Arbeit rekonstruiert Drewermanns Ansatz in den drei Horizonten seines Oeuvres: der Theologie, der Psychologie und der Philosophie. Hermeneutisch wird Drewermanns Denken der Tauglichkeitsprüfung am konkret erfahrbaren Leid unterzogen und auch aus Vergleichsperspektiven erschlossen wie der Theologie Paul Tillichs. Leseprobe |
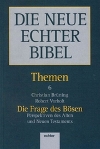 |
Christian Brüning / Robert Vorholt Die Frage des Bösen Perspektiven des Alten und Neuen Testaments Echter Verlag, 2018, 144 Seiten, Broschur, 978-3-429-02172-6 14,40 EUR |
Die Neue Echter
Bibel Themen Band 6 zur Seite "Das Böse" Inhaltsverzeichnis und Leseprobe |
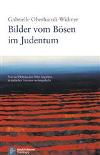 |
Gabrielle Oberhänsli-Widmer Bilder vom Bösen im Judentum Neukirchener Verlag, 2013, 224 Seiten, Paperback, 14,5 x 22,5 cm 978-3-7887-2671-3 40,00 EUR |
Von der Hebräischen Bibel
inspiriert, in
jüdischer Literatur weitergedacht "Wie kann man den einen guten Gott mit dem Bösen zusammendenken? Und ist das Böse eine angeborene Veranlagung des Menschen oder der Preis seiner Mündigkeit und Willensfreiheit? Ausgehend von biblischen Bildern und Gestalten lädt das vorliegende Buch zu einem wirkungsgeschichtlichen Gang durch die jüdische Literatur ein, der von den spätantiken Rabbinen bis zur zeitgenössischen israelischen Lyrik reicht und damit eine Fülle von Antworten zutage fördert, die weit über die Hebräische Bibel hinausgehen. Eine Studie zur Theologie, Kultur- und Mentalitätsgeschichte des Judentums. Die Analyse ist dabei als Zusammenspiel zwischen alttestamentlicher Vorlage und jüdischer Rezeption gestaltet, ein exegetisches Spiel, bei dem nicht nur die Heilige Schrift das nachbiblische Schrifttum inspiriert, sondern umgekehrt auch das spätere jüdische Literaturschaffen die biblischen Texte in ein neues und nicht selten ungewohntes Licht setzt. Oft folgt die Rezeption den übergeordneten geistesgeschichtlichen Entwicklungen, wie beispielsweise dem signifikanten Schritt von der antiken und mittelalterlichen Gotterfülltheit der Welt hin zur neuzeitlichen und (post)modernen Gottesleere. Mithin geht die theologische Fragestellung Hand in Hand mit der anthropologischen: das Böse als angeborene Veranlagung des Menschen oder als Preis seiner Mündigkeit und Willensfreiheit? Die Folgetexte können den biblischen Basistext oft bis zur Unkenntlichkeit umgestalten und ihm grundlegend veränderte, überraschende und selbst diametral entgegengesetzte Aussageintentionen aufsetzen. Eine Studie zur Theologie, Kultur- und Mentalitätsgeschichte des Judentums. |
 |
Ebner/Fischer/Frey/Janowski/Fuchs/Hamm Das Böse Jahrbuch für biblische Theologie 2011, Neukirchener Verlag, 2012, 320 Seiten, Paperback, 14,5 x 22 cm 978-3-7887-2538-9 65,00 EUR |
Jahrbuch für biblische Theologie 2011 Das Jahrbuch für Biblische Theologie bietet Beiträge zu einem kohärenten Thema aus allen theologischen Disziplinen sowie der Judaistik, der Literatur und der Kultur. Der vorliegende Band beschreibt Erfahrungen und Wahrnehmungen des Schreckens oder auch der Faszination des Bösen. Er reflektiert die Ambivalenzen des menschlichen Lebens und der menschlichen Lebensführung und bringt Ansätze zur Bewältigung dieser Erfahrungen aus der biblischen Tradition zur Geltung. Die alttestamentlichen Beiträge zu Themen der Urgeschichte, der Prophetie, der Psalmen und der Apokalyptik sind von Andreas Schüle, Alexandra Grund, Andreas Wagner und Veronika Bachmann verfasst. Die neutestamentlichen Beiträge zu Lucifer, zur Judasgestalt, zu den Exorzismen Jesu und zur Frage nach der Funktion von Bildern des Bösen stammen von Samuel Vollenweider, Christfried Böttrich, Christian Strecker und Jutta Leonhardt-Balzer. Volker Leppin reflektiert das Thema "Luther und der Teufel", Helmut Hoping das Problem der Erbsünde und Dorothea Sattler die Praxis von Exorzismen in der Kirche. Friedrich Schweitzer fragt religionspädagogisch, ob Kinder auch einen "bösen Gott" brauchen. Gabrielle Oberänsli-Widmer beschreibt Leviathan und Behemot als Sinnbilder des Bösen im Judentum, der Schriftsteller Johannes Aderegg reflektiert über das Hiob-Problem in Theologie und Literatur, Michael Leicht thematisiert das Gesicht des Bösen in der politischen Propaganda. Der Band bietet so einen vielfältigen und fundierten Beitrag zur Reflexion über die Wirklichkeit des Bösen in der Welt im Licht der biblischen Botschaft. Inhaltsverzeichnis |
 |
Ingolf U. Dalferth Das Böse Drei Annäherungen Herder Verlag, 2011, 120 Seiten, gebunden, Schutzumschlag, 12,5 x 20,5 cm 978-3-451-34057-4 18,00 EUR |
Die Frage nach dem Ursprung des Bösen spielt nicht nur für die
Theodizee (»Warum lässt Gott das zu?«), sondern auch für das
Selbstverständnis des Menschen und die Beweggründe zu (un-)moralischem
Handeln eine entscheidende Rolle. Was aber ist genau unter dem Bösen zu
verstehen? Wo liegt sein Ursprung? Mit seinen drei Beiträgen, des
Theologen und Religionsphilosophen Ingolf U. Dalferth, des früheren
Dogmatik-Professors und jetzigen Bischofs Karl Kardinal Lehmann und des
Orientalisten und Schriftstellers Navid Kermani, bietet dieser Band
Antworten aus der Sicht verschiedener Konfessionen und Religionen. Dabei
geht es u.a. um die Unterscheidung zwischen vermeidbaren und
unvermeidbaren Übeln, um die Freiheit des Menschen und seine
Verantwortung für das Böse und um die Tradition der Gottesklage im
Islam. Ingolf U. Dalferth, geb. 1948, Studium der Theologie, Philosophie und Linguistik in Tübingen, Edinburgh, Wien und Cambridge, Promotion und Habilitation in Theologie an der Universität Tübingen, seit 1995 Professor für Systematische Theologie, Symbolik und Religionsphilosophie an der Universität Zürich, seit 2007 Professor für „Philosophy of Religion“ an der Claremont Graduate University in Kalifornien. Navid Kermani, Orientalist und freier Schriftsteller, Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Karl Lehmann, geb. 1936, Dr. phil., Dr. theol., während des Vaticanum II als Mitarbeiter des Karl Rahners tätig, anschließend dessen wissenschaftlicher Assistent, 1968-1971 Professor für Dogmatik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, 1971-1983 Professor für Dogmatik und Ökumenische Theologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, seit 1983 Bischof von Mainz, 1987-2008 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, 2001 Kardinal. |
 |
Jörn Kiefer Gut und Böse Herder Verlag, 2018, 496 Seiten, gebunden, Schutzumschlag, 15,1 x 23,7 cm 978-3-451-37793-8 85,00 EUR |
Herders
Biblische Studien
Band 90 Die Anfangslektionen der Hebräischen Bibel Die Frage nach Gut und Böse im Buch Genesis Nicht zufällig beginnt das theologische Nachdenken über Gut und Böse bis heute immer wieder mit den ersten Kapiteln der Genesis. Sie sind bewusst als Anfang der Tora konzipiert und wollen selbst vom Anfang erzählen – vom Anfang der Menschheit und darin auch vom Anfang des Guten und Bösen. Texte, die so im Fokus stehen, werden bekanntlich oft theologisch überfrachtet mit Interessen und Vorurteilen. Diese Untersuchung möchte die biblischen Texte von dogmatischem Ballast befreien und deren ureigenen Beitrag zu der immer noch brisanten Frage nach Gut und Böse zur Sprache bringen. Leseprobe |
 |
Thomas von Aquin Quaestiones disputatae: Vom Übel I Meiner Verlag, 2009, 505 Seiten, Halbleinen, Halbleinen 978-3-7873-1911-4 118,00 EUR |
Thomas von
Aquin: Quaestiones disputate Band 11 De malo I, q. 1-7 In den 16 Quaestionen zur Erörterung der Frage nach dem Ursprung und dem Wesen des Schlechten und Bösen in der Welt und im Handeln der Menschen, also des Übels, versucht Thomas zu zeigen, daß das Übel (ipsum malum) nicht als die andere Seite oder der Antipode des Guten aufzufassen ist, sondern als eine akzidentiell bewirkte Verfehlung des Guten, nach dem alles strebt: Das Übel wirkt nicht aus eigener Kraft, der wir ausgeliefert sind und der wir begegnen müssen, sondern es ist die Folge falschen Handelns - ein vermeidbarer Defekt. Von den 7 Quaestionen, die in diesem ersten Teilband der Neuübersetzung von De malo enthalten sind, ist die 6. Quaestio von herausragender Bedeutung, in der Thomas ausdrücklich die Freiheit des Willens als aktive Potenz des Menschen herausstellt: Der Wille trifft seine Wahl nicht aus Notwendigkeit, sondern in Freiheit. |
 |
Thomas von Aquin Quaestiones disputatae: Vom Übel II Meiner Verlag, 2010, 405 Seiten, Halbleinen, Halbleinen 978-3-7873-1912-1 98,00 EUR |
Thomas von
Aquin: Quaestiones disputate Band 12 De malo II, q. 8-16 In den 16 Quaestionen zur Erörterung der Frage nach dem Ursprung und dem Wesen des Schlechten und Bösen in der Welt und im Handeln der Menschen, also des Übels, versucht Thomas zu zeigen, daß das Übel (ipsum malum) nicht als die andere Seite oder der Antipode des Guten aufzufassen ist, sondern als eine akzidentiell bewirkte Verfehlung des Guten, nach dem alles strebt: Das Übel wirkt nicht aus eigener Kraft, der wir ausgeliefert sind und der wir begegnen müssen, sondern es ist die Folge falschen Handelns - ein vermeidbarer Defekt. Im Anschluß an die Quaestionen 6 und 7 des ersten Teilbandes von De malo, in denen es um die Willensfreiheit und die sogenannten "läßlichen " Sünden ging, setzt im zweiten Teilband mit Quaestio 8 eine Reihe von 8 Quaestionen ein, die dem Umfang nach das Gros der Schrift darstellen und die sieben Hauptlaster bzw. Todsünden zum Gegenstand haben, deren Liste Thomas aus den Moralschriften Gregors des Großen übernahm. Hauptlaster, vitia capitalia, sind für Thomas selbstverschuldete, das heißt mit Zustimmung des Verstandes willentlich eingeübte falsche Grundhaltungen, von denen her andere Laster oder schlimme moralische Verfehlungen ihren Anfang nehmen." |
 |
Shalom Rosenberg Von der Macht des Bösen Eine Reise zu den Abgründen Gottes JVB / Jüdische Verlagsanstalt Berlin, 144 Seiten, Paperback, 978-3-934658-15-8 19,90 EUR |
Wenn es einen Schöpfergott gibt, und dieser gut ist, woher kommen dann die Übel: Krankheit, Krieg und Kummer? Shalom Rosenberg stellt die Frage nach dem Problem des Bösen in der Welt. Rosenberg erzählt auf spannende Weise die gegensätzlichen Antworten, die Bibel, rabbinische Literatur, mittelalterliche Religionsphilosophie, Kabbala, Chassidismus und das heutige Denken nach der Schoah geben. Eine leicht lesbare erzählerische Einführung in dieses existenzielle Problem des jüdischen Denkens. |
 |
Johannes Brachtendorf De libero arbitrio - Der freie Wille Zweisprachige Ausgabe Schöningh, 2006, 330 Seiten, Festeinband, 978-3-506-71764-1 72,00 EUR |
Augustinus Opera, Gesamtausgabe
Band 9 eingeleitet, übersetzt und herausgegeben von Johannes Brachtendorf Was ist die Ursache des Bösen in der Welt? Warum hat Gott dem Menschen den freien Willen gegeben? Ist die Realität des Bösen vereinbar mit der Vorstellung eines allmächtigen, weisen und guten Schöpfergottes? Mit De libero arbitrio hat Augustinus den abendländischen Diskurs zur Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen grundgelegt und das Thema der Theodizee eröffnet. Die neue Ausgabe tritt an die Stelle der älteren Übersetzung von W. Thimme (1962). In einer ausführlichen Einleitung analysiert sie Augustins frühes Hauptwerk auf seinen systematischen Gehalt hin und setzt es in Beziehung zu den späten Schriften über Gnade und Freiheit. Vor dem Hintergrund des antiken Denkens wird Augustins Durchbruch zum Begriff der Willensfreiheit dargestellt und in seinen Konsequenzen bis in die moderne Philosophie hinein verfolgt. Inhaltsverzeichnis |
 |
Xiaogang Yang Der Begriff des malum in der philosophischen Psychologie Augustins Schöningh, 2016, 311 Seiten, kartoniert, 978-3-506-78535-0 44,90 EUR |
Augustinus - Werk und Wirkung
Band 6 Was ist das Böse und woher kommt es? Augustin, einer der größten Gelehrten des Christentums, liefert eine psychologische Untersuchung des Bösen in der menschlichen Seele, die sich auch an diejenigen richtet, die Selbstreflexion und Psychotherapie aus eigener Kraft erreichen wollen. Das Problem des Bösen gehört zu den klassischen Themen der Philosophie und der Theologie. Augustins Lehre vom Bösen ist geprägt von dem Grundsatz: Das Böse ist ein Mangel an Gutem. Er definiert das Gute als die Einheit, die Form und die Ordnung des Seins. Wer sich um das Böse in der Seele sorgt, fragt sich, was die Einheit, die Form und die Ordnung der Seele ausmacht und wie sie verloren werden. Mithilfe des Selbstbewusstseins, der Tugend und der Willensfreiheit kann man die Einheit, die Form bzw. die Ordnung der Seele verstehen. Entsprechend kennzeichnen die Phänomene der Selbstspaltung, der Unwissenheit und der Willensschwäche ihren Verlust. Daraus ergibt sich die Frage, ob der Mensch selbst der Urheber des Bösen in der Seele ist oder ob das Böse notwendigerweise in der menschlichen Seele existiert. Damit gibt Augustin uns ein großes Rätsel auf, das alle betrifft, die sich um Selbsterkenntnis bemühen. Inhaltsverzeichnis Leseprobe |
 |
Ingolf U. Dalferth Das Böse Essay über die Denkform des Unbegreiflichen Mohr Siebeck, 2010, 240 Seiten, fadengeheftete Broschur, 978-3-16-150489-1 24,00 EUR |
Ingolf U. Dalferth rekonstruiert die Sinngeschichte des Bösen am Leitfaden einer zweifachen Unterscheidung: der zwischen gut und böse , und der zwischen böse und Gott . Beide Unterscheidungen fallen nicht zusammen, solange die Differenz zwischen gut und Gott offen gehalten und nicht durch die Trennung beider Momente oder ihre wechselseitige Gleichsetzung aufgelöst wird. |
 |
Bernd J. Claret Geheimnis des Bösen Zur Diskussion um den Teufel Tyrolia, 440 Seiten, Broschur, 978-3-7022-2074-7 40,00 EUR |
Innsbrucker Theologische Studien Band 49 Ein fundierter Beitrag zur aktuellen theologischen Diskussion über die Existenz des Bösen in der Welt. Gibt es nichts Wichtigeres zu diskutieren? Die vorliegende Arbeit beantwortet diese Frage eindeutig. In Auseinandersetzung mit H. Haags Plädoyer “Abschied vom Teufel” und im Gespräch mit W. Kasper und K. Lehmann wird die mit der Frage nach dem Ursprung des Bösen verbundene theologische Problematik erhellt. Woher kommt ursprünglich das Böse? Das ist, zusammen mit der Frage nach dem Wesen des Bösen, die zentrale Frage der Untersuchung. Sie wird angesichts des vom Menschen verübten eminent Bösen zu einer quälenden Frage – vor allem dann, wenn gewichtige Gründe dafür sprechen, daß der Mensch als letzter Quellort und gleichsam Erfinder des Bösen – das nicht nur zum Himmel, sondern auch nach der Hölle schreit – eher nicht in Frage kommt. Bezogen auf konkrete Erfahrungen der Begegnung mit dem Bösen zeigt die Studie im Rückgriff auf Ricœurs Phänomenologie der Verfehlung, daß die mit dem Teufel verbundene Problematik die Frage nach der Vertretbarkeit einer “ethischen Weltanschauung” berührt, die den Grund des Bösen in der menschlichen Freiheit sucht. Im Anschluß an Ricoeur wird dargelegt, inwiefern das wirklichkeitsgesättigte Symbol des Teufels – wie kein anderes Symbol des Bösen – die Vernunft herausfordert und die philosophisch-theologische Reflekion in Gang bringt, kurzum: das Geheimnis der Bosheit “zu denken gibt”. Der Verfasser zeigt auf, was wirklich Lehre der Kirche ist. Er stellt vollständig die heutige deutschsprachige Literatur zum Thema vor. Bestürzend die von ihm z.B. anhand von Dostojewskis “Brüder Karamasoff” entwickelte Dramatik des “Geheimnisses des Bösen”. PD Dr. Bernd J. Claret, geb. 1963, 1991-2001 Wiss.Assistent am Lehrstuhl für Dogmatik und Theologische Propädeutik der Universität Bonn;2002-2005 Dozent für Dogmatik (Trier), 2008 Habilitation für das Fach Dogmatik. Seit 2009 Lehrtätigkeit als Privatdozent. |
 |
Anselm Grün Der Umgang mit dem Bösen Münsterschwarzacher Kleinschriften Band 6 112 Seiten 978-3-87868-123-6 9,95 EUR |
Der Kampf mit den Dämonen. Das Böse in der Welt läßt sich nicht besiegen und nicht beseitigen. Es gehört zum Menschsein dazu. Aber man kann sich mit dem Bösen auseinandersetzen und für sich selbst einen Weg finden, ihm nicht zu folgen. Anselm Grün beschreibt Möglichkeiten, mit dem Dunklen und Bösen, das jeder Mensch in sich spürt, umzugehen. An den Lehren der alten Mönchsväter zeigt er, wodurch ungesunde Fehlhaltungen entstehen und wie wir uns diesen widersetzen können, damit sie uns nicht an unserer Selbstfindung und an der Offenheit gegenüber Gott hindern. In der Vorstellung der alten Mönche nahm das Böse, also die Sünden und Leidenschaften, die lebendige Form von Dämonen an, die einen Menschen überfielen. Sie unterschieden acht Arten: den Dämon der Völlerei, der Unzucht, der Habsucht, der Traurigkeit, des Zornes, der Ruhmsucht, des Stolzes und der „acedia“, der Antriebslosigkeit. Und sie entwickelten Wege und Übungen, jeden einzelnen Dämon zu besiegen. |
 |
Johannes Brachtendorf De libero arbitrio - Der freie Wille Zweisprachige Ausgabe Schöningh, 2006, 330 Seiten, Festeinband, 978-3-506-71764-1 56,00 EUR |
Augustinus Opera, Gesamtausgabe
Band 9 eingeleitet, übersetzt und herausgegeben von Johannes Brachtendorf Was ist die Ursache des Bösen in der Welt? Warum hat Gott dem Menschen den freien Willen gegeben? Ist die Realität des Bösen vereinbar mit der Vorstellung eines allmächtigen, weisen und guten Schöpfergottes? Mit De libero arbitrio hat Augustinus den abendländischen Diskurs zur Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen grundgelegt und das Thema der Theodizee eröffnet. Die neue Ausgabe tritt an die Stelle der älteren Übersetzung von W. Thimme (1962). In einer ausführlichen Einleitung analysiert sie Augustins frühes Hauptwerk auf seinen systematischen Gehalt hin und setzt es in Beziehung zu den späten Schriften über Gnade und Freiheit. Vor dem Hintergrund des antiken Denkens wird Augustins Durchbruch zum Begriff der Willensfreiheit dargestellt und in seinen Konsequenzen bis in die moderne Philosophie hinein verfolgt. Inhaltsverzeichnis |
 |
Paul Ricoeur Das Böse Eine Herausforderung für Philosophie und Theologie Theologischer Verlag Zürich, 2006, 64 Seiten, Softcover, 978-3-290-17401-9 18,00 EUR |
Woher kommt das Böse? Wie kommt es, dass wir Böses tun? Diese Fragen haben Paul Ricœur (1913–2005) – den Philosophen und Theologen, der sich selbst nie als solchen bezeichnet hat – seit seinen frühesten Arbeiten begleitet. Der vorliegende Essay, entstanden aus einem Referat, das Ricœur 1985 an der Theologischen Fakultät Lausanne gehalten hat, kann stellvertretend für seine Beschäftigung mit diesen Fragen stehen. Angesichts dessen, was das 20. Jahrhundert an Bösem hervorgebracht hat, beleuchtet Ricœur hier in einer exemplarischen Tiefe die verschiedenen religiösen, mythologischen und philosophischen Diskurse über das Böse. Er zeigt, wie die traditionelle Theodizee, aber auch wie Kant, Hegel oder Barth versucht haben, das Problem, das die Existenz des Bösen bedeutet, zu lösen. Ricœur selbst plädiert für eine Weisheit, die auf die (An-)Klage verzichtet. |
 |
Heinz-Günther Nesselrath Gut und Böse in Mensch und Welt Philosophische und religiöse Konzeptionen vom Alten Orient bis zum frühen Islam Mohr Siebeck, 2013, 237 Seiten, Leinen, 978-3-16-152574-2 104,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 10 Die Frage nach Herkunft und Wirklichkeit des Guten und des Bösen sowie nach ihrem Verhältnis zueinander hat in der Philosophie- und Religionsgeschichte von Anfang an eine zentrale Rolle gespielt. Ihre Beantwortung hatte entscheidenden Einfluss darauf, wie man Welt und Kultur, Mensch und Ethik in der Beziehung zu Gott bzw. den Göttern wahrnahm. Die Beiträge des Konferenzbandes stellen dar, welche Auffassungen hierzu in Altertum und Antike entwickelt wurden. Dabei reicht der Bogen von den frühen Literaturen aus Ägypten und Mesopotamien, Iran und Griechenland über biblische, qumranische und antik-christliche Texte bis zu dem Werk Manis und dem Koran. So vermittelt der Band einen repräsentativen Eindruck von den Antworten der alten Welt auf eine Lebensfrage der Menschheit. Inhaltsübersicht Heinz-Günther Nesselrath / Florian Wilk : Einleitung – Bernd Schipper : 'Gut und Böse' im Alten Ägypten – Catherine Mittermayer : Gut und Böse – Anforderungen an menschliches Handeln im Beziehungsgefüge zwischen Göttern und Menschen in den mesopotamischen Mythen – Philip Kreyenbroek : Good and Evil in Zoroastrianism – Wilhelm Blümer : Gutes und Böses aus Götterhand? Zum Verhältnis von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung des Menschen in der frühgriechischen Dichtung – Konrad Schmid : Genealogien der Moral – Prozesse fortschreitender ethischer Qualifizierung von Mensch und Welt im Alten Testament – Devorah Dimant : The Demonic Realm in Qumran Sectarian Literature – Jan Dochhorn : Das Böse und Gott im Römerbrief – eine Skizze – Ulrich Volp : Der Schöpfergott und die Ambivalenzen seiner Welt – Das Bild vom Schöpfergott als ethisches Leitbild im frühen Christentum in seiner Auseinandersetzung mit der philosophischen Kritik – Markus Stein : Der Dualismus bei den Manichäern und der freie Wille – Therese Fuhrer : Kann der Mensch ohne Fehler sein? Augustin über die 'Sünde' – Angelika Neuwirth : Die Entdeckung des Bösen im Koran – Überlegungen zu den koranischen Versionen des Dekalogs – Martin Tamcke : 'Das reine Leben des Glaubens will ich nach deinem Vorbild erwerben' – Der Kampf um das Gute und wider das Böse nach einer ostsyrischen Heiligenlegende |
 |
Monika Elisabeth
Götte Von den Wächtern zu Adam Frühjüdische Mythen über die Ursprünge des Bösen und ihre frühchristliche Rezeption Mohr Siebeck, 2016, 400 Seiten, fadengeheftete Broschur, 978-3-16-154847-5 89,00 EUR |
Wissenschaftliche
Untersuchungen zum Neuen Testament (2. Reihe) WUNT 2, Broschur, Band
426 Die Frage nach den Ursprüngen des Bösen wird in der jüdisch-christlichen Überlieferung in verschiedenen mythologischen Konzepten beantwortet. Dabei sind der aus dem henochischen Schrifttum bekannte Wächtermythos und die Adam-Tradition von herausragender Bedeutung. Monika Elisabeth Götte liefert hier eine religions- und traditionsgeschichtliche Untersuchung von Wächter- und Adamrezeption im frühen Judentum und dem daraus hervorgehenden Christentum. Sie zeigt in der hermeneutisch vergleichenden Auswertung eine tendenzielle Verschiebung der Erklärung des Bösen in der Welt `von den Wächtern zu Adam` und dann weiter zur Erklärung durch einen vorzeitlichen Satansfall. Die grundlegende Pluralität der Erklärungen des Bösen in der biblischen Tradition führt zur hermeneutischen Frage nach der theologischen Bedeutung dieser Pluralität. |
 |
Christoph Bizer / Roland
Degen Die Gewalt und das Böse Neukirchener Verlag, 2003, 250 Seiten, 350 g, Paperback, 978-3-7887-2011-7 35,00 EUR |
Jahrbuch der Religionspädagogik
19 Wie können Theologie und Pädagogik zum Verständnis von Gewalt beitragen, was können religiöse Erziehung und Bildung gegen die Gewalt tun? Und: Gewinnt die Kategorie des Bösen in Verbindung mit der offensichtlichen Rätselhaftigkeit und Unausrottbarkeit der Gewalt vielleicht neue Bedeutung? |
 |
Bettina Kruhöffer Reflexionen über das Böse LIT Verlag, 2002, 304 Seiten, Softcover, 978-3-8258-5936-3 25,90 EUR |
Studien zur
Theologie und Ethik Band 31 Sprachliche Differenzierungen in Auseinandersetzung mit der Theologie Wolfhart Pannenbergs Aus biblisch-theologischer Perspektive lässt sich die Zielrichtung "des Bösen" als Zerstörung von Leben interpretieren. Im Gegenüber zu einem auf die menschlichen Naturbedingungen zurückweisenden Sündenbegriff (Pannenberg) bringt theologische Reflexion über "das Böse" auch die "Macht" zur Sprache, in welche sich Menschen strukturell verstricken lassen, und kennzeichnet somit die gebundene Freiheit des Menschen. Diese Interpretation "des Bösen" als Kennzeichen eschatologischer Differenz fordert dazu heraus, die Ansprüche soteriologischer, geschichtstheologischer sowie moralischer Vorstellungen einer "Überwindung des Bösen", kritisch zu befragen. |
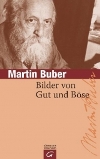 |
Martin Buber Bilder von Gut und Böse Gütersloher Verlagshaus, 1999, 83 Seiten, kartoniert, 978-3-579-02563-6 19,95 EUR |
Buber beschäftigt
sich hier mit dem alten menschlichen Problem von
Gut und
Böse. Ausgehend von urbiblischen Wahrheiten und Mythen tragen seine inhaltlich tiefgehenden und sprachlich meisterhaften Betrachtungen zur Klärung dieser Frage bei. |
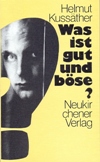 |
Helmut Kussäther Was ist gut und böse? Zur Grundlegung der Ethik. Mit einer kritischen Würdigung Martin Heideggers Neukirchener Verlag, 1979, 112 Seiten, Kartoniert, 3-7887-0587-6 9,90 EUR |
Seinesgleichen im Guten und Im Bösen zu
übertreffen ist menschlich. Doch man sollte wissen, wer am Zuge Ist.
Dergleichen lehrt die Ethik. Widerstand gegen das Böse und Hilfe beim
Guten ist ihre Sorge. Beldes verschränkt sich. Der Mensch muß von Jugend
auf lernen, zwischen dem Bösen und dem Guten zu unterscheiden. Der
Verfasser wagt sich zu diesem Zweck mitten hinein in den Lebensvollzug.
Was ist am menschlichen Lebensvollzug typisch? Daß sich alle oder doch die meisten der gleichen Instanz unterwerfen: dem Urteil des Gewissens, obwohl dieses Urteil Revisionen zuläßt, übrigens ein entscheidender Einwand gegen die Todesstrafe. Wer auf die Stimme des Gewissens hört, der zieht sich selber zur Rechenschaft für alles, was er gewollt oder getan hat. Seine Kritik am eigenen und auch am fremden Lebensvollzug öffnet den Blick für jene Welt der Möglichkeit, die der Verfasser als jenes Reich Identifiziert, das nach Jesu Wort nicht von dieser Welt ist, aber doch zu dieser Welt gehört, wie das Bessere zum Unvollkommenen gehört. Das Unvollkommene dient nicht ohne weiteres dem Besseren, wie man schon In der Schule weiß. Aber das Unvollkommene dient zur Erkenntnis des Besseren. Wer mehr will, der wird weniger erlangen. Ernst Fuchs |