| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Ingolf U. Dalferth | ||
|
Ingolf U. Dalferth, Dr. theol., Dres. h.c., Jahrgang 1948,
war von 1995 bis 2013 Ordinarius für Systematische
Theologie, Symbolik und Religionsphilosophie an der
Universität Zürich und von 1998 bis 2012 Direktor des
Instituts für Hermeneutik und Religionsphilosophie der
Universität Zürich. Seit 2007 lehrt er als Danforth
Professor of Philosophy of Religion an der Claremont
Graduate University in Kalifornien. Dalferth war mehrfach
Präsident der Europäischen Gesellschaft für
Religionsphilosophie, von 1999 bis 2008 Gründungspräsident
der Deutschen Gesellschaft für Religionsphilosophie und 2016/2017 Präsident der Society for the Philosophy of Religion in den USA. Er war Lecturer in Cambridge und Manchester, Fellow am Collegium Helveticum in Zürich sowie am Wissenschaftskolleg zu Berlin und von 2017 bis 2018 Leibniz-Professor in Leipzig. 2005 und 2006 erhielt er die Ehrendoktor würden der Theologischen Fakultäten von Uppsala und Kopenhagen. Dalferth ist Autor und Herausgeber vieler wichtiger Schriften. Er ist u. a. Hauptherausgeber der »Theologischen Literaturzeitung« (Leipzig) und der Publikationsreihe »Religion in Philosophy and Theology« (Tübingen). |
||
 |
Ingolf U. Dalferth Die Krise der öffentlichen Vernunft Über Demokratie, Urteilskraft und Gott Evangelisches Verlagshaus, 2022, 352 Seiten, Hardcover, 978-3-374-07056-5 25,00 EUR |
Das neue Buch des Theologen und Religionsphilosophen Ingolf
U. Dalferth thematisiert die Gefährdung der Demokratie in
den westlichen Gesellschaften. Beispielhaft dafür ist die
Krise der »öffentlichen Vernunft«. Sie zeigt, dass die
deliberative Demokratie in Habermas' Sinn wohl immer schon
eine soziale Fiktion war. Internet und Soziale Medien
zersetzen die politische Öffentlichkeit. Gesinnung und
Emotionen verdrängen Argumente, Gleichheit und Gerechtigkeit
werden zu populistischen Leerformeln und kritische
Urteilskraft schwindet oder wird diffamiert. Umfassende
zivilgesellschaftliche Beratschlagung (Deliberation) wird –
nicht zuletzt durch das Erstarken rechter wie linker
Identitätspolitik – schwieriger. Religion verkümmert zur
Moralressource und Gott wird aus der Öffentlichkeit
verbannt. Dalferths differenzierte Diskussion dieser Themen steht in einer radikal-demokratischen Klammer: der kritischen Zurückhaltung gegenüber dem Prinzipiellen und Dogmatischen. Demokratie lebt vom Widerspruch und dem Recht, im Rahmen des geltenden Rechts anders zu leben, verpflichtet aber auch jeden zum Respekt gegenüber den anderen. Wer festlegen möchte, wie zu reden und zu leben ist oder welche Argumente öffentlich Gehör finden dürfen, versteht nicht, dass es ohne Freiheit weder Gleichheit noch Gerechtigkeit gibt. Und der Rekurs auf Gott ist kein Überbleibsel einer vordemokratischen Vergangenheit, sondern die permanente Erinnerung daran, was Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit möglich macht. |
 |
Ingolf U. Dalferth Sünde Die Entdeckung der Menschlichkeit Evangelisches Verlagshaus, 2020, 432 Seiten, Paperback, 978-3-374-06351-2 32,00 EUR |
Der Topos der Sünde gehört nicht
nur zum Kernbestand theologischer Themen, er bietet auch
einen theologischen Schlüssel zum Verständnis für die
Herkunftsgeschichte der kulturellen Situation unserer
Gegenwart. Der international bekannte Theologe und
Religionsphilosoph Ingolf U.
Dalferth zeigt das am Leitfaden der Frage nach der
Menschlichkeit des Menschen an exemplarischen Punkten und
widerspricht damit der weit verbreiteten
»Sündenvergessenheit« deutscher evangelischer Theologie. Das Resultat ist keine klassische theologische Abhandlung zum Sündenthema, sondern eine Problemgeschichte der Sünde, in der theologische Überlegungen zur Diagnose exemplarischer Entwicklungen in der europäischen Denkgeschichte herangezogen werden. Dalferths Buch kritisiert den Zweig der Aufklärungstradition, die meint, die vom Sündentopos bestimmte Interpretation der conditio humana hinter sich lassen zu können, und plädiert für eine realistische Sicht auf den Menschen. Wer an den »sündlosen« Menschen glaubt und meint, auf der Erde das Himmelreich schaffen zu können, baut an der Hölle. Inhaltsverzeichnis Leseprobe |
 |
Ingolf U. Dalferth Wirkendes Wort Bibel, Schrift und Evangelium im Leben der Kirche und im Denken der Theologie Evangelisches Verlagshaus, 2018, 488 Seiten, Hardcover, Schutzumschlag, 14 x 21 cm 978-3-374-05648-4 38,00 EUR |
Wieder einmal gibt es in der evangelischen Theologie und
Kirche in Deutschland einen
Streit um das Alte Testament und die Bedeutung von
Schrift und Schriftauslegung. Das ist gut so. Ohne diesen
Streit würde das, was sich in Kirche und Theologie
eingebürgert hat, nur noch so verstanden, wie es gerade
weithin verstanden wird: nämlich missverstanden. Missverstehen ist leicht. Das gilt gerade für die Schrift. Im Gegensatz zur geläufigen Annahme ist die eigentliche Herausforderung nicht, wie die Schrift zu verstehen ist, sondern, was man eigentlich verstehen will. Es geht nicht primär um die Methoden, sondern um den Gegenstand der Auslegung: die Schrift, die zur Kommunikation des Evangeliums gebraucht wird, durch das sich Gottes Wort im Leben der Menschen wirksam zur Geltung bringt. Seit Längerem neigt die Systematische Theologie dazu, den Umgang mit biblischen Texten aus der systematischen Reflexion des Glaubens auszublenden. Eine Neubesinnung auf die Aufgaben einer theologischen Lehre von der Schrift ist überfällig. Ingolf U. Dalferth bietet diese Neubesinnung in einem großen Wurf, der ein Jahrhundert nach Karl Barths Römerbrief die Theologie am Beginn des neuen Jahrtausends überall dort aufschrecken wird, wo ein theologisches Ethos überlebt hat, das sich Glauben und Kirche zugehörig weiß. Dalferth verbindet seine Ausführungen auch mit praktischen Reformüberlegungen. Das »Leben der Kirche« und das »Denken der Theologie« werden so neu aufeinander bezogen. Leseprobe |
 |
Ingolf U. Dalferth God first Evangelisches Verlagshaus, 2018, 256 Seiten, Paperback, 14 x 21 cm 978-3-374-05652-1 28,00 EUR |
Die reformatorische Revolution der christlichen Denkungsart Die Reformationn war nicht nur ein historisches Ereignis mit weltweiter Wirkung, sondern eine spirituelle Revolution. Ihre Triebkraft war die befreiende Entdeckung, dass Gott in seiner Schöpfung bedingungslos als Kraft der Veränderung zum Guten gegenwärtig ist. Gott allein ist der Erste, alles andere das Zweite. Das führte existenziell zu einer Neuausrichtung des ganzen Lebens an Gottes Gegenwart und theologisch zu einer grundlegenden Umgestaltung der traditionellen religiösen Denksysteme. Indem die Reformatoren alles Leben und Denken, Erfahren und Leiden, Vorstellen und Tun kompromisslos auf die schöpferische Gegenwart Gottes hin ausrichteten, revolutionierten sie die christliche Lebens- und Denkungsart. ?Das Buch des international bekannten Systematikers und Religionsphilosophen Ingolf U. Dalferth kegt dar, was es heißt, Gott vom Kreuzesgeschehen her theologisch zu denken. Und es entfaltet den christlichen Monotheismus nicht als System der Vergewaltigung Andersdenkender, sondern als Lebensform radikaler Freiheit und Liebe, die sich als Resonanz der Gnade Gottes versteht. Leseprobe |
 |
Ingolf U. Dalferth Reformation und Säkularisierung Zur Kontroverse um die Genese der Moderne aus dem Geist der Reformation Mohr Siebeck, 2017, 259 Seiten, Paperback, 978-3-16-154890-1 14,00 EUR  |
Die Reformation war eine im Kern religiöse Erneuerungsbewegung des
Christentums in Europa. Gerade als solche hat sie Entscheidendes zur
Ausbildung einer säkularen Moderne beigetragen. Worin genau bestand
dieser Beitrag, und wie ist er zu bewerten? Haben die
Reformationsbewegungen die überkommene Einheit von Kirche und Staat,
Gesellschaft und Kultur zerstört und damit die Marginalisierung des
Christentums in Europa eingeleitet? Oder haben sie zentrale Impulse
des Christentums zur Geltung gebracht, ohne die sich die westliche
Moderne nicht hätte entwickeln können und die auch eine sich säkular
verstehende Gesellschaft in einer pluralen Spätmoderne prägen? Der
vorliegende Band versucht, diese kontroversen Fragen zu erhellen.
Dabei kommt auch die Kritik zu Wort, die vom Standpunkt einer
säkularen Moderne an den reformatorischen Traditionen geübt wird,
sowie jene, die sich vom Standpunkt reformatorischen Denkens aus an
die europäische Moderne und Spätmoderne richten lässt. Mit Beiträgen von: Albrecht Beutel, Ingolf U. Dalferth, Volker Gerhardt, Brad S. Gregory, Eilert Herms, Detlef Pollack, Risto Saarinen, Dorothea Wendebourg Inhaltsverzeichnis |
 |
Ingolf Dalferth Der auferweckte Gekreuzigte Zur Grammatik der Christologie Mohr, 1994, 346 Seiten, 978-3-16-146296-2 39,00 EUR |
Ingolf U. Dalferths Grammatik der
Christologie ist ein in seiner
begrifflichen Konsistenz beeindruckender Versuch, das Grundproblem der
neuzeitlichen Christologie, die drohende Desintegration der Person Jesu
Christi in den "historischen Iesus", den "Christus des Glaubens" und
den "Sohn Gottes des christologischen Dogmas" zu überwinden und die
Einheit der Person des auferweckten Gekreuzigten durch den Bezug auf das
Heil schaffende Handeln Gottes theologisch darzustellen." Christoph Schwöbel in Evangelische Kommentare 4 (1996), S. 241 |
 |
Ingolf U. Dalferth Das Böse Drei Annäherungen Herder Verlag, 2011, 120 Seiten, gebunden, Schutzumschlag, 12,5 x 20,5 cm 978-3-451-34057-4 18,00 EUR |
Die Frage nach dem Ursprung des Bösen spielt nicht nur für die
Theodizee (»Warum lässt Gott das zu?«), sondern auch für das
Selbstverständnis des Menschen und die Beweggründe zu (un-)moralischem
Handeln eine entscheidende Rolle. Was aber ist genau unter dem Bösen zu
verstehen? Wo liegt sein Ursprung? Mit seinen drei Beiträgen, des
Theologen und Religionsphilosophen Ingolf U. Dalferth, des früheren
Dogmatik-Professors und jetzigen Bischofs Karl Kardinal Lehmann und des
Orientalisten und Schriftstellers Navid Kermani, bietet dieser Band
Antworten aus der Sicht verschiedener Konfessionen und Religionen. Dabei
geht es u.a. um die Unterscheidung zwischen vermeidbaren und
unvermeidbaren Übeln, um die Freiheit des Menschen und seine
Verantwortung für das Böse und um die Tradition der Gottesklage im
Islam. Ingolf U. Dalferth, geb. 1948, Studium der Theologie, Philosophie und Linguistik in Tübingen, Edinburgh, Wien und Cambridge, Promotion und Habilitation in Theologie an der Universität Tübingen, seit 1995 Professor für Systematische Theologie, Symbolik und Religionsphilosophie an der Universität Zürich, seit 2007 Professor für „Philosophy of Religion“ an der Claremont Graduate University in Kalifornien. Navid Kermani, Orientalist und freier Schriftsteller, Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Karl Lehmann, geb. 1936, Dr. phil., Dr. theol., während des Vaticanum II als Mitarbeiter des Karl Rahners tätig, anschließend dessen wissenschaftlicher Assistent, 1968-1971 Professor für Dogmatik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, 1971-1983 Professor für Dogmatik und Ökumenische Theologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, seit 1983 Bischof von Mainz, 1987-2008 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, 2001 Kardinal. |
 |
Ingolf U. Dalferth Religion und Konflikt Grundlagen und Fallanalysen Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, 304 Seiten, Gebunden, 978-3-525-60440-3 110,00 EUR |
Research in Contemporary Religion, RCR
Band 8: Theorien und Fallstudien zur Bewältigung von Konflikten in und mit der Religion.Die Beiträge des vorliegenden Bandes gehen größtenteils auf eine Tagung der Deutschen Gesellschaft für Religionsphilosophie zurück. Die erste Hälfte ('Grundlagen: Zur Theorie religiöser Konflikte') behandelt das Thema in sechs Beiträgen aus philosophischer und fundamentaltheologischer Perspektive, und zwar primär mit Blick auf die ontologischen bzw. semantischen, handlungstheoretischen, ethischen, geschichtsphilosophischen, erkenntnistheoretischen und anthropologischen Implikationen religiöser Konflikte. Der zweite Teil (»Fallanalysen: Zur Wahrnehmung und Bewältigung von Konflikten in und mit der Religion«) bietet fünf religionsphilosophische und hermeneutisch-theologische Analysen exemplarischer religiöser Konfliktfelder unter der Leitfrage der Konfliktwahrnehmung und -bewältigung. Diskutiert wird das Problem heiliger Schriften in Judentum, Christentum und Islam; der Konflikt zwischen Theologie und Naturalismus; der Absolutheitsanspruch des christlichen Monotheismus; das religiöse Konfliktpotential politischer Umbrüche am Beispiel Südafrika; die dialogorientierte Interaktion als Konfliktbewältigungsstrategie im Religionsunterricht. |
 |
Ingolf U. Dalferth Umsonst Eine Erinnerung an die kreative Passivität des Menschen Mohr Siebeck, 2011, 245 Seiten 978-3-16-150940-7 24,00 EUR |
Während die theologische Tradition
den Menschen im Bezug auf Gott und in Unterscheidung von seinen
Mitgeschöpfen als Vernunftwesen verstand, das zur
Gottebenbildlichkeit bestimmt ist, werden die derzeitigen Debatten
um die Bestimmung des Menschen durch naturalistische Ansätze
beherrscht, die den Menschen als Tier unter Tieren zu verstehen
suchen. Und während die theologische Tradition den Menschen aufgrund
seiner Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit als ausgezeichnetes
Geschöpf unter den Geschöpfen verstand, haben philosophische Ansätze
sich schon lange angewöhnt, Menschen als Mängelwesen zu betrachten,
die im Kampf ums Dasein keine Chance hätten, wenn sie die Schwächen
ihrer biologischen Natur nicht durch Technik, Moral, Medien,
Religion und Kultur zu kompensieren wüssten. Ingolf U. Dalferth vertritt demgegenüber die These, dass der Mensch nicht als Mängelwesen, sondern als Möglichkeitswesen zu verstehen sei; dass die Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit nicht primär in seiner Vernunft und seiner Fähigkeit zu vernunftgeleitetem Handeln zu sehen sei, sondern vor allem in der kreativen Passivität, die ihn in seinen Lebensvollzügen für die überraschenden Möglichkeiten offen hält, die Gott ins menschliche Leben spielt; und dass die theologisch entscheidende Differenz nicht die ist zwischen Mensch und Tier, sondern die zwischen menschlichem und unmenschlichem Leben von Menschen. Nicht die Evolutions- und Neurobiologie ist dementsprechend die entscheidende Herausforderung der Theologie, sondern die ethische, politische und theologische Frage nach der Bestimmung der Menschlichkeit des Menschen. |
 |
Ingolf U. Dalferth Beten als verleiblichtes Verstehen Neue Zugänge zu einer Hermeneutik des Gebets Herder Verlag, 2016, 336 Seiten, kartoniert, 13,5 x 21,5 cm 978-3-451-02275-3 34,99 EUR |
Questiones Disputatae Band
275 Die Sinnlichkeit des Verstehens, das sich im Vollzug des Betens erschließt, hat bisher wenig Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Band beschreitet diesbezüglich neue Wege. Aus unterschiedlichen konfessionellen Perspektiven skizzieren die Beiträge Zugänge zum Gebet als einem Ort, an dem sich religiöses Verstehen vollzieht und auf sein anderes hin transzendiert. Dabei rückt nicht nur die Multimedialität des Betens in den Blick, sondern auch die Spannung von Intimität und Öffentlichkeit, von eigenleiblichem und zwischenleiblichem Verstehen. Mit Beiträgen von Jean-Louis Chretien, Jean Greisch, Joachim Negel, Ingolf U. Dalferth, Simon Peng-Keller, Christina Gschwander, Eva-Maria Faber, Christiane Tietz, Ralph Kuntz und Peter Zimmerling. |
 |
Ingolf U. Dalferth Radikale Theologie Glauben im 21. Jahrhundert Evangelisches Verlagshaus, 2010, 288 Seiten, Paperback, 14 x 21 cm 978-3-374-02786-6 18,80 EUR |
Forum Theologische
Literaturzeitung Band 23 In Auseinandersetzung mit den Grundgedanken Heideggers und Bultmanns entwickelt Ingolf U. Dalferth das Prinzip einer »Radikalen Theologie«, die die Orientierungskraft des Glaubens für das menschliche Leben vom Ereignis der Gegenwart Gottes her entfaltet. In knapper und klarer Weise stellt Ingolf U. Dalferth die theologischen und philosophischen Denkansätze der Hermeneutik des letzten Jahrhunderts vor. Er tut dies aber nicht im Sinne bloßer Denkmalspflege, sondern will die Theologie des 21. Jahrhunderts voranbringen, indem er Martin Heidegger und Rudolf Bultmann weiterführt, ohne Karl Barth zu vergessen. Das Ergebnis seiner begrifflich höchst präzisen Denkanstrengung ist eine »Radikale Theologie«, die weder auf antimoderne Verklärung der Vormoderne noch auf mystische Vertiefung des Säkularen abhebt, sondern auf den radikalen Wechsel in eine theologische Perspektive. Während die Wissenschaften und die Philosophie dem Wirklichen verpflichtet sind, geht es der Theologie um das Mögliche. Theologie entfaltet »Grenzbegriffe«, die den Anspruch von Wissenschaft und Philosophie kritisch einschränken, und entwickelt »Orientierungsbegriffe«, mit deren Hilfe kritisch durchdacht wird, wie sich menschliches Leben im Glauben völlig neu auslegt: »Die Welt ist mehr als das, was der Fall ist, das Leben mehr als das, was wir aus ihm machen, beides mehr, als in Wissenschaften und Philosophie zur Sprache kommt.« Von hier aus entfaltet Dalferth die Wirklichkeit der Offenbarung und tritt im christlichen Sinne für eine unbedingte Hoffnung ein, die alles profan Vorfindliche grundsätzlich übersteigt und die Welt am anderen Horizont ihrer selbst ausrichtet – dem Horizont ihres sie liebenden Schöpfers. Als Zugabe zu solchem Aufschwung des Glaubensdenkens stellt Dalferth mit seinem Buch allen Studierenden der Theologie und Philosophie ein übersichtliches und handliches Hilfsmittel bereit, mit dem jede einschlägige Prüfung zu meistern ist. So verbindet er mustergültig Forschung und Lehre. Leseprobe Ingolf U. Dalferth, Dr. theol., Dr. h.c., Dr. h.c., Jahrgang 1948, ist seit 1995 Ordinarius für Systematische Theologie, Symbolik und Religionsphilosophie an der Universität Zürich und seit 1998 auch Direktor des Instituts für Hermeneutik und Religionsphilosophie in Zürich. Seit 2008 lehrt er zudem als Danforth Professor of Philosophy of Religion an der Claremont Graduate University in Kalifornien. Dalferth ist u. a. Hauptherausgeber der »Theologischen Literaturzeitung« (Leipzig) und der Publikationsreihe »Religion in Philosophy and Theology« (Tübingen) sowie Mitherausgeber der »Hermeneutischen Untersuchungen zur Theologie« (Tübingen). 2005 und 2006 erhielt er die Ehrendoktorwürden der Theologischen Fakultäten von Uppsala und Kopenhagen. |
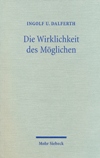 |
Ingolf U. Dalferth Die Wirklichkeit des Möglichen Mohr, 2003, 600 Seiten, Broschur, 978-3-16-148100-0 49,00 EUR |
Hermeneutische Religionsphilosophie Religion ist ein zentrales Phänomen menschlichen Lebens, im Positiven wie im Negativen. Höchste kulturelle Leistungen verdanken sich den Religionen ebenso wie grausamste Unmenschlichkeiten. Das wirft im Blick auf Religion und Religionen immer wieder Fragen auf, die sich weder durch weitere theologische Reflexion einer Glaubenspraxis noch durch weitere religionswissenschaftliche Forschung ausreichend beantworten lassen. Man stellt verwundert oder bestürzt fest, daß andere glauben, was man selbst für unglaublich hält, oder nicht glauben, was sich doch von selbst zu verstehen scheint. Aus solchen Verwirrungen entsteht philosophisches Fragen. Philosophieren ist ein Versuch, sich methodisch im Denken neu zu orientieren, und Religionsphilosophie ein Versuch, sich im Denken über religiöse Orientierungen im Leben neu zu orientieren. |