| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Theologische Literaturzeitung, Evangelische Verlagsanstalt | ||
 | Theologische Literaturzeitung Evangelische Verlagsanstalt jährlich 12 Hefte, DIN A4 Jahresabopreis: Privatkunden: 162,00 EUR | Die "Theologische Literaturzeitung" ist die älteste und umfangreichste deutsche Rezensionszeitschrift. Dass inzwischen ihr 128. Jahrgang erscheint, besagt gerade angesichts der oft so schwierigen politischen Verhältnisse unseres Jahrhunderts viel über den Stellenwert in der theologischen Wissenschaft. Nahezu alle wichtigen theologischen Publikationen des deutschsprachigen Raumes, aber auch fremdsprachliche Werke, besonders aus dem amerikanischen und skandinavischen Bereich, werden von Theologen vorgestellt, die ihre Kompetenz für den speziellen Fachbereich ausgewiesen haben. Jedes Heft enthält mindestens einen Leitaufsatz (häufig Literaturberichte) sowie eine fortlaufende Zeitschriftenschau. In Abständen werden Nachrichten aus den Theologischen Fakultäten des deutschsprachigen Raumes veröffentlicht. |
| Forum Theologische Literaturzeitung, Evangelische Verlagsanstalt | ||||||
| ISBN | Autor | Titel | EUR | Jahr | ||
| 39 | 978-3-374-07360-3 | Ingolf U. Dalferth | Auferweckung. Plädoyer für ein anderes Paradigma der
Christologie. zur Beschreibung |
28,00 |
|
2023 |
| 38 | 978-3-374-06799-2 | Christoph Markschies | Kirchenhistoriker als Herausgeber der »Theologischen
Literaturzeitung«. Überlegungen zu Geschichte, Gegenwart und Zukunft
einer Rezensionszeitschrift zur Beschreibung |
25,00 |
|
2021 |
| 37 | 978-3-374-06503-5 | Focken / van Oorschot | Schriftbindung evangelischer Theologie. Theorieelemente aus
interdisziplinären Gesprächen zur Beschreibung |
38,00 |
|
2020 |
| 36 | 978-3-374-05800-6 | Ralph Kunz | Pilgern. Glauben auf dem Weg zur Beschreibung |
20,00 |
|
2019 |
| 35 | 978-3-374-05706-1 | Christian Grethlein | Christsein als Lebensform. Eine Studie zur Grundlegung der
Praktischen Theologie zur Beschreibung |
28,00 |
|
2018 |
| 34 | 978-3-374-05565-4 | Hans-Dieter Mutschler | Bewusstsein. Was ist das? zur Beschreibung |
2018 | ||
| 33 | 978-3-374-05229-5 | Friederike Nüssel | Lutherische Theologie in außereuropäischen Kontexten. Eine
Zusammenschau aus Anlass des 500. Reformationsjubiläums zur Beschreibung |
24,00 |
|
2017 |
| 32 | 978-3-374-04536-5 | Friedemann Stengel | Sola scriptura im Kontext. Behauptung und Bestreitung des
reformatorischen Schriftprinzips zur Beschreibung |
2016 | ||
| 31 | 978-3-374-03786-5 | Andreas Feldtkeller | Umstrittene Religionswissenschaft. Für eine Neuvermessung ihrer
Beziehung zur Säkularisierungstheorie zur Beschreibung |
24,00 |
|
2014 |
| 30 | 978-3-374-03753-7 | Ulrich H. J. Körtner | Gottesglaube und Religionskritik zur Beschreibung |
2014 | ||
| 29 | 978-3-374-03172-6 | Hans-Martin Rieger | Gesundheit. Erkundungen zu einem menschenangemessenen Konzept
zur Beschreibung |
19,80 |
|
2013 |
| 28 | 978-3-374-03150-4 | Hartmut von Saas | Wahrhaft Neues. Zu einer Grundfigur christlichen Glaubens zur Beschreibung |
19,80 |
|
2013 |
| 27 | 978-3-374-03145-0 | Christian Grethlein | Was gilt in der Kirche?
Perikopenrevision als Beitrag zur Kirchenreform zur Beschreibung |
2013 | ||
| 26 | 978-3-374-03060-6 | Friedhelm Hartenstein | Hermeneutik des Bilderverbots. Exegetische und
systematisch-theologische Annäherungen zur Beschreibung |
19,80 |
|
2016 |
| 25 | 978-3-374-03058-3 | Christoph Markschies | Hellenisierung des Christentums. Sinn und Unsinn einer
historischen Deutungskategorie zur Beschreibung |
2012 | ||
| 24 | 978-3-374-02987-7 | Jürgen Dierken | Fortschritte in der Geschichte der Religion? Aneignung einer
Denkfigur der Aufklärung zur Beschreibung |
19,80 |
|
2012 |
| 23 | 978-3-374-02786-6 | Ingolf U. Dalferth | Radikale Theologie zur Beschreibung |
18,80 |
|
2010 |
| 22 | 978-3-374-02651-7 | Hans-Martin Rieger | Altern anerkennen und gestalten.
Ein Beitrag zur gerontologischen Ethik zur Beschreibung |
2008 | ||
| 21 | 978-3-374-02599-2 | Jörg Lauster | Zwischen Entzauberung und
Remythisierung. Zum Verhältnis von Bibel und Dogma zur Beschreibung |
2008 | ||
| 20 | 978-3-374-02481-0 | Werner Thiede | Esoterik und Theologie | 2007 | ||
| 18/19 | 3-374-02416-5 | Bernhard Dressler | Unterscheidungen. Religion und Bildung | 2006 | ||
| 17 | 3-374-02353-3 | Ingolf U. Dalferth | Eine Wissenschaft oder viele? Die Einheit evangelischer Theologie in der Sicht ihrer Disziplinen | 2006 | ||
| 16 | 978-3-374-02318-9 | Martin Greschat | Versuch einer Orientierung. | |||
| 15 | 3-374-02279-0 | Ulrich Kühn | Zum evangelisch-katholischen Dialog. Grundfragen einer ökumenischen Verständigung | 2005 | ||
| 14 | 3-374-02254-5 | Helmut Goerlich | Verfassung ohne Gottesbezug? Zu einer aktuellen europäischen Kontroverse | 2004 | ||
| 13 | 3-374-02187-5 | Christoph Markschies | Warum hat das Christentum die Antike überlebt? Ein Beitrag zum Gespräch zwischen Kirchengeschichte und Systematischer Theologie | 2004 | ||
| 11/ 12 | 3-374-02120-4 | Ingolf U. Dalferth | Evangelische Theologie als Interpretationspraxis. Eine systematische Orientierung | 2004 | ||
| 10 | 3-374-02086-0 | Christian Grethlein | Kommunikation des Evangeliums in der Mediengesellschaft | 2003 | ||
| 9 | 3-374-02067-4 | Otto Kaiser | Anweisungen zum gelingenden, gesegneten und ewigen Leben. Eine Einführung in die spätbiblischen Weisheitsbücher. | 2003 | ||
| 8 | 3-374-02066-6 | Eckart Reinmuth | Neutestamentliche Historik | 2003 | ||
| 7 | 3-374-01952-8 | Ulrich H.J. Körtner | Vielfalt und Verbindlichkeit | 2002 | ||
| 6 | 3-374-01953-6 | Andreas Feldtkeller | Theologie und Religion. Eine Wissenschaft in ihrem Sinnzusammenhang | 2002 | ||
| 5 | 3-374-01857-2 | Klaus Fitschen | Was ist Freiheit? | 2001 | ||
| 4 | 3-374-01823-8 | Gerhard Sauter | Evangelische Theologie an der Jahrtausendschwelle | 2002 | ||
| 3 | 3-374-01793-2 | Hans-Jürgen Hermisson | Alttestamentliche Theologie und Religionsgeschichte Israels | 2000 | ||
| 2 | 3-374-01745-2 | Kurt Nowak | Vernünftiges Christentum? | 1999 | ||
| 1 | 3-374-01714-2 | Audretsch / Weder | Kosmologie und Kreativität | 1999 | ||
 |
Ingolf U.
Dalferth Auferweckung. Plädoyer für ein anderes Paradigma der Christologie Evangelisches Verlagshaus, 2023, 184 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-07360-3 28,00 EUR | Forum Theologische
Literaturzeitung Band 39 Die dominierende christologische Denkform des Christentums ist die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes. Doch das Christentum begann nicht an Weihnachten, sondern an Ostern, nicht mit der Geburt Jesu, sondern mit der Auferweckung des Gekreuzigten. Dalferth plädiert in dieser Studie dafür, nicht die Inkarnation, sondern die Auferweckung ins Zentrum der Christologie und damit der christlichen Theologie zu stellen. Nicht die Erniedrigung Gottes ins Menschsein, sondern die Erhöhung der Menschen in das Leben Gottes ist die befreiende Botschaft des Evangeliums. Wir werden verändert, nicht Gott. Gott wird nicht einer von uns, sondern er macht uns zu den Seinen. Er kommt uns nahe, weil er uns in seine Nähe holt, aber er bleibt der Schöpfer und wir seine Geschöpfe. Blick ins Buch |
 |
Christoph Markschies Kirchenhistoriker als Herausgeber der »Theologischen Literaturzeitung« Evangelisches Verlagshaus, 2021, 180 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-06799-2 25,00 EUR | Forum Theologische
Literaturzeitung Band 38 Überlegungen zu Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer Rezensionszeitschrift Anlässlich der Übernahme der Herausgeberschaft der »Theologischen Literaturzeitung« zeigt der als Kirchenhistoriker tätige Autor, wie seine im selben Fach wirkenden Vorgänger Adolf Harnack, Emanuel Hirsch, Hans-Georg Opitz, Hans Lietzmann und Kurt Aland ihre Herausgeberschaft verstanden haben. Anhand bisher unveröffentlichter und teilweise bislang auch unbekannter Quellen wird sichtbar, welche inhaltlichen Akzente gesetzt wurden und wie die alltägliche Praxis funktionierte. Auf diese Weise werden inhaltliche Neuakzentuierungen im politisch wie theologisch äußerst bewegten 20. Jahrhundert ebenso deutlich wie die organisatorischen Veränderungen. Weil daraus auch Grundsätzliches im Blick auf eine Rezensionszeitschrift deutlich wird, lag es nahe, abschließend auch Überlegungen zur Zukunft der »ThLZ« im digitalen Zeitalter anzufügen. Die wichtigsten Quellentexte sind in einer Edition beigefügt. |
 |
Friedrich-Emanuel Focken /
Friederike van Oorschot Schriftbindung evangelischer Theologie Theorieelemente aus interdisziplinären Gesprächen Evangelisches Verlagshaus, 2020, 456 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-06503-5 38,00 EUR | Forum Theologische
Literaturzeitung Band 37 Allein die Schrift – diese Forderung Luthers beschreibt bis heute einen Selbstanspruch evangelischer Theologie. Das Schriftprinzip ist in den letzten Jahrzehnten jedoch erodiert, obwohl es als ein identity marker der protestantischen Theologie für ihr Selbstverständnis und den Zusammenhalt ihrer Teildisziplinen entscheidend ist. Vor dem Hintergrund dieser Krise des Schriftprinzips entwickeln Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen aus den Fächern Altes und Neues Testament sowie Dogmatik und Ethik Elemente einer interdisziplinären Theorie über die „Schriftbindung evangelischer Theologie“. Unter diesem Programmbegriff entfalten sie ein relationales Modell, das die Schrift in ihren Beziehungen zu Hörenden, Lesenden und deren Gemeinschaften mit je unterschiedlichen Traditionen beschreibt. Dabei stehen die Pluralität, Einheit, Normativität und Autorität der Schrift im Fokus. |
 |
Ralph Kunz Pilgern Glauben auf dem Weg Evangelisches Verlagshaus, 2019, 272 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-05800-6 20,00 EUR |
Forum Theologische
Literaturzeitung Band 36 Das sehr ansprechend geschriebene Buch des bekannten Zürcher Theologen Ralph Kunz beschreibt Pilgern als eine alte spirituelle Praktik, die in den letzten Jahren wieder neu entdeckt wurde. Das ist mehr als nur ein spiritueller Hype! Denn das Ziel des Pilgerwegs ist Gott. Was eine wachsende Schar von Menschen bewegt und begeistert, wird in seiner biblischen, geschichtlichen und kulturellen Bedeutung für die Gegenwart entfaltet und als Leitmetapher für die christliche Lebensform gedeutet. Leseprobe Ralph Kunz, Dr. theol., Jahrgang 1964, studierte Evangelische Theologie in Basel, Los Angeles und Zürich. Er ist Professor für Praktische Theologie mit den Schwerpunkten Seelsorge, Predigt und Gottesdienst an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, Leiter des Center for the Academic Study of Christian Spirituality der Universität Zürich, Mitglied der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie (WGTh), der International Academy of Practical Theology und der Internationalen Gesellschaft für Gesundheit und Spiritualität. |
 |
Christian Grethlein Christsein als Lebensform Eine Studie zur Grundlegung der Praktischen Theologie Evangelisches Verlagshaus, 2018, 256 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-05706-1 28,00 EUR |
Forum Theologische
Literaturzeitung Band 35 Die Kommunikation des Evangeliums konkretisiert sich im Christsein als einer attraktiven Lebensform. Den Grundimpuls geben dafür das Auftreten, Wirken und Geschick Jesu. Dieser Impuls wurde – wie ein Blick in die Christentumsgeschichte zeigt – immer wieder von Neuem kontextualisiert. Auch heute bezieht sich Christsein als Lebensform sowohl konstruktiv als auch kritisch auf Gesellschaft und Kultur. Dies wird am Beispiel der basalen christlichen Kommunikationsformen – Segnen, Beten und Erzählen – sowie der in der Mimesis Jesu stehenden Kommunikationsformen – Taufen, Mahlfeiern, Predigen – gezeigt. Den Abschluss bildet ein Blick auf das Theologiestudium und die Veränderungen, die dringend notwendig sind, um das Christsein als Lebensform zu fördern. Das Buch des bekannten und anerkannten Praktischen Theologen Christian Grethlein ist ein unverzichtbarer Baustein in der anstehenden Debatte und gehört darum in die Hände möglichst vieler Hochschullehrer, Studenten und Pfarrer. Leseprobe |
 |
Hans-Dieter Mutschler Bewusstsein Was ist das? Evangelisches Verlagshaus, 2018, 256 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-05565-4 bicht mehr lieferbar | Forum Theologische
Literaturzeitung Band 34 Es gibt heute mindestens vier philosophische Schulen, die das Thema »Bewusstsein« behandeln: die nach wie vor lebendige Bewusstseinsphilosophie, die Phänomenologie, den Naturalismus und die Sprachphilosophie. Der Naturalismus dominiert in den Neuro- und Kognitionswissenschaften, ferner im materialistischen Flügel der Analytischen Philosophie. Der sprachphilosophische Ansatz geht vom späten Wittgenstein aus und wird von Ernst Tugendhat oder Peter Hacker fortgeführt. Die Bewusstseinsphilosophie vertreten z. B. Wolfgang Cramer, Dieter Henrich und Manfred Frank. Diese vier Schulen stehen mehr oder weniger gegeneinander und nehmen sich kaum zur Kenntnis. Wünschenswert aber wäre ein Gesamtüberblick und eine jeweilige Ortsbestimmung, denn es scheint, dass alle Schulen ihr relatives Recht haben, aber unter verschiedener Rücksicht, die genau zu bestimmen ist. |
 |
Friederike Nüssel Lutherische Theologie in außereuropäischen Kontexten Eine Zusammenschau aus Anlass des 500. Reformationsjubiläums Evangelisches Verlagshaus, 2017, 248 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-05229-5 24,00 EUR |
Forum Theologische
Literaturzeitung Band 33 Dieses Buch nimmt das 500. Reformationsjubiläum zum Anlass, den Blick global zu weiten. Es thematisiert die zentralen Fragen und Herausforderungen für lutherische Theologie und Kirche in außereuropäischen Kontexten zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Autoren aus Afrika, Asien, Südamerika und Nordamerika erörtern die elementaren Themen der Entwicklung lutherischer Theologie in ihrem jeweiligen Kontext. Darüber hinaus werden in zwei Beiträgen die ökumenische Formierung lutherischer Kirchen und die Bedeutung interreligiöser Beziehungen auf Weltebene reflektiert. In der Einleitung führen die Herausgeber – beide lutherische Systematiker – in die Fragestellungen ein und erörtern in der Zusammenfassung übergreifende Entwicklungen und Perspektiven für die Fortentwicklung lutherischer Theologie. Mit Beiträgen von Kenneth Appold, Daniel Beros, Miles Hopgood, Faustin Leonhard Mahali, Kenneth Mtata, Raj Barath Patta, Cheryl M. Peterson, Simone Sinn und Wilfred John Sundaray. Leseprobe |
 |
Friedemann Stengel Sola scriptura im Kontext Behauptung und Bestreitung des reformatorischen Schriftprinzips Evangelisches Verlagshaus, 2016, 136 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-04536-5 |
Forum Theologische
Literaturzeitung Band 32 Am Schriftprinzip scheiden sich die Geister. Manche sehen in der Bibel eine Inkarnation des Wortes Gottes, einige bemühen sich um die Umdeutung des Schriftprinzips als Wegbereiter einer fortschrittlichen Geistesgeschichte, anderen gilt es vor allem als abgrenzendes Wesensmerkmal des Protestantismus gegenüber anderen Christentümern. Bei vielen hat sich die Rede von der Krise des Schriftprinzips als Selbstverständlichkeit eingebürgert; manche fordern ganz seine Abschaffung. Der vorliegende Beitrag geht von diesen disparaten Debatten zurück in das frühe 16. Jahrhundert, um den konkreten Positionen und historisch bedingten Grenzen auf die Spur zu kommen, zwischen denen das Argumentieren mit der Heiligen Schrift als alleinigem göttlichen Wort entwickelt worden ist. Der Blick in diese Entstehungszusammenhänge kann in den aktuellen Diskussionen zur Aufklärung beitragen. zur Seite Sola scriptura |
 |
Andreas Feldtkeller Umstrittene Religionswissenschaft Für eine Neuvermessung ihrer Beziehung zur Säkularisierungstheorie Evangelisches Verlagshaus, 2014, 184 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-03786-5 24,00 EUR |
Forum Theologische
Literaturzeitung Band 31 Religionswissenschaft ist seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert der Entwurf einer säkularen Wissenschaft von der Religion gewesen. Ihre auf dem Kongress der »International Association for the History of Religion« 1960 in Marburg verabredete Festlegung auf eine kulturwissenschaftliche Methodik wurde vielfach so gefüllt, dass die Religionswissenschaft zur Agentin der damaligen Version der Säkularisierungstheorie würde – der Annahme nämlich, dass Modernisierung weltweit zur aufgeklärten Umformung und letztlich zum Verschwinden von Religion führen würde. Die Einführung der Diskursanalyse nach Michel Foucault als Leitmethode in der Kulturwissenschaft hat die Religionswissenschaft gezwungen, sich intensiv mit der Frage der eurozentrischen Prägung ihres Religionsbegriffs zu beschäftigen. Eine kritische diskursanalytische Aufarbeitung ihrer eigenen Bindung an die nicht minder eurozentrische klassische Säkularisierungstheorie steht jedoch weithin noch aus. Andreas Feldtkeller leistet hier Abhilfe, er sieht die Religionswissenschaft der Zukunft als eine säkulare, aber nicht säkularistische Wissenschaft. Andreas Feldtkeller, Dr. theol., Jahrgang 1961, studierte Evangelische Theologie in München, Heidelberg, Tübingen und Jerusalem, war von 1992 bis 1996 im Rahmen von Gemeindearbeit und Forschungstätigkeit in Amman (Jordanien) und ist seit 1999 Professor für Religions- und Missionswissenschaft sowie Ökumenik an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. 2008 wurde er mit dem Hans-Sigrist-Preis, dem internationalen Forschungspreis der Universität Bern, ausgezeichnet. Leseprobe |
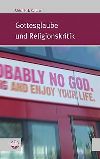 |
Ulrich H. J. Körtner Gottesglaube und Religionskritik Evangelisches Verlagshaus, 2014, 160 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-03753-7 |
Forum Theologische
Literaturzeitung Band 30 Parallel zum Wiedererstarken von Religion im öffentlichen Raum formiert sich auch ein neuer Atheismus. Beide Entwicklungen führen zu einer Renaissance der Religionskritik. In Auseinandersetzung mit heutigen Formen des Atheismus soll das komplexe Verhältnis von christlichem Glauben und Religionskritik untersucht werden. Komplex ist dieses Verhältnis zum einen, weil der Begriff der Religionskritik eine mehrfache Bedeutung hat, zum anderen, weil der biblische Gottesglaube selbst ein religionskritisches Potential hat. Gottesglaube und Religionskritik stehen sich also nicht einfach als zwei verschiedene Größen gegenüber – hier der Glaube, dort die Kritik –, sondern sie durchdringen sich auf unterschiedliche Weise. Darum kann auch die Auseinandersetzung mit heutigen Formen von Religionskritik oder den neuen Spielarten von Atheismus nicht nach einem einfachen Schema von Frage und Antwort geführt werden, sondern nur in einem Wechselspiel von unterschiedlichen Formen der Kritik von Religion. Ulrich H. J. Körtner, Dr. theol., Dr. h.c. mult., Jahrgang 1957, ist seit 1992 Ordinarius für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien und seit 2001 auch Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin der Universität Wien. In der Jahren 2010 und 2013 erhielt er die Ehrendoktorwürden der Faculté libre de Théologie Protestante de Paris und der Reformierten Theologischen Universität Debrecen. |
 |
Hans-Martin Rieger Gesundheit Erkundungen zu einem menschenangemessenen Konzept Evangelisches Verlagshaus, 2013, 248 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-03172-6 19,80 EUR |
»Hauptsache gesund!« Dieses Motiv verbindet Menschen
unterschiedlicher Herkunft, es ist darüber hinaus zu einem Zukunftsthema
der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts geworden. Die
»Gesundheitsgesellschaft« ist dadurch gekennzeichnet, dass sie
Gesundheit erstens als höchsten Wert ansieht, dass sie Gesundheit
zweitens als zunehmend machbar betrachtet und dass sie in der starken
Nachfrage nach dem Gut »Gesundheit« drittens einen Wachstumsmotor gerade
auch in alternden Gesellschaften erblickt. Doch was ist »Gesundheit«? Eine normale körperliche und psychische Funktionsfähigkeit, ein vollständiges Wohlbefinden oder ein dynamischer Zustand des Gleichgewichts? Höchst kompetent tritt Hans-Martin Rieger in die Diskussion gesellschaftlicher, medizinischer, gesundheitspsychologischer und philosophischer Vorstellungen ein. Dazu werden anthropologische Leitvorstellungen ethisch reflektiert und Grundmerkmale eines menschenangemessenen Gesundheitsverständnisses erkundet. Ein transdisziplinärer Modellvorschlag und eine theologische Betrachtung bieten konstruktive Gesprächsanstöße. Hans-Martin Rieger, Dr. theol., Jahrgang 1966, ist seit 2006 Privatdozent für Systematische Theologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er studierte Evangelische Theologie in Heidelberg, Jerusalem und Tübingen. Leseprobe Band 29 in der Reihe Forum Theologische Literaturzeitung |
 |
Hartmut von Saas Wahrhaft Neues Zu einer Grundfigur christlichen Glaubens Evangelisches Verlagshaus, 2013, 224 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-03150-4 19,80 EUR |
Zwar soll es nichts Neues mehr unter der Sonne geben, wie der
Prediger Salomo beklagte, doch die Bibel spricht an prominenten Stellen
sehr wohl vom Unverhofften, Überraschenden, noch nie Dagewesenen. Ein
»neues Jerusalem«, gar eine »neue Schöpfung«, ein »neuer Bund« oder
schlicht »das Neue« sind ganz traditionelle Figuren der Schrift – und
der Theologie. Doch Neues wird alt. Daher ist vom »wahrhaft Neuen«, vom Neuen, das nicht und nie vergeht, gesprochen worden. Wie aber ist diese Figur zu denken, um nicht selbstwidersprüchlich zu wirken? Wie verhalten sich dann Alt und Neu zueinander? Welches Zeitverständnis ist hier vorausgesetzt? Wie steht Neues zur religiösen Praxis, die auf Reproduktion angelegt ist? Ist die Rede vom »wahrhaft Neuen« nicht doch eine Illusion? Darauf geben Hartmut von Sass, Konrad Schmid, Hans Weder, Andrea Anker, Christian Danz, Günter Thomas und Ralph Kunz fundierte und hochinteressante Antworten. Leseprobe Band 28 in der Reihe Forum Theologische Literaturzeitung |
 |
Christian
Grethlein Was gilt in der Kirche? Perikopenrevision als Beitrag zur Kirchenreform Evangelisches Verlagshaus, 2013, 200 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-03145-0 vergriffen |
Evangelische Christen erhoffen
sich von den gottesdienstlichen Schriftlesungen Orientierung und
Perspektiven für die Lebensgestaltung. Deshalb kommt ihrer Auswahl und
Gestaltung große Bedeutung zu. Der renommierte Münsteraner Theologe Christian Grethlein legt eine praktisch-theologische Theorie der Schriftlesungen vor, die einen zusammenfassenden Rückblick auf die bisherige Entwicklung und die Analyse gegenwärtiger Veränderungen im Hören biblischer Texte voraussetzt. Die daraus folgenden hermeneutischen Einsichten und bibeldidaktischen Erkenntnisse erweisen eine zentrale Perikopenrevision als problematisch. Denn sie verfehlt den situativen Grundcharakter der Kommunikation des Evangeliums. Demgegenüber empfiehlt Grethlein, die Auswahl der Schriftlesungen als pastorale Aufgabe zu profilieren. Ihre Gestaltung wird durch den personalen Charakter des Vorlesens bestimmt. Leseprobe Band 27 in der Reihe Forum Theologische Literaturzeitung zur Seite Perikopenbuch |
 |
Friedhelm Hartenstein Hermeneutik des Bilderverbots Exegetische und systematisch-theologische Annäherungen Evangelisches Verlagshaus, 2015, 200 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-03060-6 24,90EUR |
Das biblische Bilderverbot hat in der Geschichte der jüdischen und
der christlichen Religion eine wichtige Rolle für die Abgrenzung der
eigenen Identität gegenüber den Bilderkulten gespielt und den
byzantinischen Bilderstreit ebenso befeuert wie den Bildersturm der
Reformationszeit. Was waren die leitenden Intentionen bei der Ablehnung
bildlicher Vergegenwärtigungen Gottes? Und wie verträgt sich diese
Ablehnung mit der durch den Gedanken der Inkarnation ermöglichten
Tradition des Christusbildes als Repräsentation des unsichtbaren Gottes?
Welche Abgrenzungen vollziehen die alttestamentlichen Formulierungen des
Bilderverbotes? Welche Bedeutung hat es in Religionsphilosophie,
Ästhetik und Systematischer Theologie und wie stellt sich die Theologie
heute zur Nicht-Bildlichkeit Gottes? Die Annäherungen aus der Sicht eines Exegeten und eines Systematikers sind von der gemeinsamen Überzeugung getragen, dass eine sachgemäße Hermeneutik des Bilderverbotes angesichts des iconic turn in Kulturwissenschaft und Theologie ebenso lohnend wie nötig ist. Leseprobe Friedhelm Hartenstein, Jahrgang 1960, war von 2002 bis 2010 Professor für Altes Testament und Altorientalische Religionsgeschichte am Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Hamburg und ist seit 2010 Professor für Altes Testament an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der LMU München. Michael Moxter, Jahrgang 1956, ist seit 1999 Professor für Systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Dogmatik am Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Hamburg, seit 2006 ist er auch für »Religionsphilosophie« zuständig. zur Seite Kunst und Bibel Band 26 in der Reihe Forum Theologische Literaturzeitung |
 |
Christoph Markschies Hellenisierung des Christentums Sinn und Unsinn einer historischen Deutungskategorie Evangelisches Verlagshaus, 2012, 144 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-03058-3 |
»Hellenisierung des Christentums« ist nicht erst bei dem berühmten
Berliner Kirchenhistoriker und Wissenschaftsorganisator Adolf von
Harnack (1851–1930) eine der schlechterdings zentralen Kategorien, die
Formation des antiken Christentums zu beschreiben. Wie beispielsweise
die heftig umstrittene Regensburger Rede Papst Benedikt XVI. aus dem
Jahre 2006 zeigt, spielt diese Kategorie bis heute eine zentrale Rolle
in theologischen wie althistorischen Konzeptionen von Christentum. Meist
wird mit dem Begriff eine Transformation des Christentums durch die
hellenistisch-römische Kultur im »globalisierten« Imperium Romanum
bezeichnet. Christoph Markschies analysiert die Geschichte des Begriffs und der damit verbundenen, höchst unterschiedlichen Definitionen wie Vorstellungen, informiert über die teilweise vollkommen vergessenen Vorgeschichten (beispielsweise im französischen Renaissancehumanismus) und macht am Ende einen Vorschlag, wie der Begriff heute trotz einer nicht unproblematischen Vorgeschichte noch sinnvoll verwendet werden kann. Leseprobe Band 25 in der Reihe Forum Theologische Literaturzeitung |
 |
Jürgen Dierken Fortschritte in der Geschichte der Religion? Aneignung einer Denkfigur der Aufklärung Evangelisches Verlagshaus, 2012, 248 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-02987-7 19,80 EUR |
»Fortschritt« ist ein ambivalenter Schlüsselbegriff des
Geschichtsdenkens von Aufklärung und Moderne. Er ist untrennbar von
allem zielorientierten Handeln. Gleichwohl steht der Fortschritt heute
im Schatten seiner krisenhaften Folgen in Ökologie, Technik und Politik.
Auch in Kultur und Religion ist er umstritten. Erzählungen der Religionsgeschichte von den »primitiven« Anfängen hin zu einer gestuften Skala von Hoch- und Kulturreligionen mit dem Christentum als Gipfel müssen sich fragen lassen, ob sie nicht nur eurozentristische Behauptungen sind. Doch auch relativistische Konzepte der Gleichgültigkeit aller Religionsformen entkommen der Fortschrittskategorie nicht. Schon die Abweisung unerwünschter Phänomene zeigt, dass kein Verständnis der Pluralität von Religionen perspektivischen Werturteilen zwischen »besser« und »schlechter« entkommen kann. Durch Aneignung einer Denkfigur aus der Aufklärung plädiert das Buch für einen reflektierten Gebrauch der Fortschrittskategorie, der zugleich die Verschiedenheit der gegenwärtigen globalen Religionskulturen anerkennt. Jörg Dierken, Dr. theol., Jahrgang 1959, studierte von 1977 bis 1984 Evangelische Theologie und Philosophie in Göttingen, Heidelberg und Frankfurt am Main. Nach Promotion und Habilitation wurde er 1995 Professor für Systematische Theologie mit den Schwerpunkten Religionsphilosophie und Ethik in Hamburg, seit 2010 hat er eine Professur für Systematische Theologie (mit Schwerpunkt Ethik) in Halle (Saale) inne. Leseprobe Band 24 in der Reihe Forum Theologische Literaturzeitung |
 |
Ingolf U. Dalferth Radikale Theologie Glauben im 21. Jahrhundert Evangelisches Verlagshaus, 2010, 288 Seiten, Paperback, 14 x 21 cm 978-3-374-02786-6 18,80 EUR |
Forum Theologische
Literaturzeitung Band 23 In Auseinandersetzung mit den Grundgedanken Heideggers und Bultmanns entwickelt Ingolf U. Dalferth das Prinzip einer »Radikalen Theologie«, die die Orientierungskraft des Glaubens für das menschliche Leben vom Ereignis der Gegenwart Gottes her entfaltet. In knapper und klarer Weise stellt Ingolf U. Dalferth die theologischen und philosophischen Denkansätze der Hermeneutik des letzten Jahrhunderts vor. Er tut dies aber nicht im Sinne bloßer Denkmalspflege, sondern will die Theologie des 21. Jahrhunderts voranbringen, indem er Martin Heidegger und Rudolf Bultmann weiterführt, ohne Karl Barth zu vergessen. Das Ergebnis seiner begrifflich höchst präzisen Denkanstrengung ist eine »Radikale Theologie«, die weder auf antimoderne Verklärung der Vormoderne noch auf mystische Vertiefung des Säkularen abhebt, sondern auf den radikalen Wechsel in eine theologische Perspektive. Während die Wissenschaften und die Philosophie dem Wirklichen verpflichtet sind, geht es der Theologie um das Mögliche. Theologie entfaltet »Grenzbegriffe«, die den Anspruch von Wissenschaft und Philosophie kritisch einschränken, und entwickelt »Orientierungsbegriffe«, mit deren Hilfe kritisch durchdacht wird, wie sich menschliches Leben im Glauben völlig neu auslegt: »Die Welt ist mehr als das, was der Fall ist, das Leben mehr als das, was wir aus ihm machen, beides mehr, als in Wissenschaften und Philosophie zur Sprache kommt.« Von hier aus entfaltet Dalferth die Wirklichkeit der Offenbarung und tritt im christlichen Sinne für eine unbedingte Hoffnung ein, die alles profan Vorfindliche grundsätzlich übersteigt und die Welt am anderen Horizont ihrer selbst ausrichtet – dem Horizont ihres sie liebenden Schöpfers. Als Zugabe zu solchem Aufschwung des Glaubensdenkens stellt Dalferth mit seinem Buch allen Studierenden der Theologie und Philosophie ein übersichtliches und handliches Hilfsmittel bereit, mit dem jede einschlägige Prüfung zu meistern ist. So verbindet er mustergültig Forschung und Lehre. Leseprobe Ingolf U. Dalferth, Dr. theol., Dr. h.c., Dr. h.c., Jahrgang 1948, ist seit 1995 Ordinarius für Systematische Theologie, Symbolik und Religionsphilosophie an der Universität Zürich und seit 1998 auch Direktor des Instituts für Hermeneutik und Religionsphilosophie in Zürich. Seit 2008 lehrt er zudem als Danforth Professor of Philosophy of Religion an der Claremont Graduate University in Kalifornien. Dalferth ist u. a. Hauptherausgeber der »Theologischen Literaturzeitung« (Leipzig) und der Publikationsreihe »Religion in Philosophy and Theology« (Tübingen) sowie Mitherausgeber der »Hermeneutischen Untersuchungen zur Theologie« (Tübingen). 2005 und 2006 erhielt er die Ehrendoktorwürden der Theologischen Fakultäten von Uppsala und Kopenhagen. |
Hans-Martin Rieger Altern anerkennen und gestalten Ein Beitrag zur gerontologischen Ethik Evangelisches Verlagshaus, 2008, 100 Seiten, Paperback, 14 x 21 cm 978-3-374-02651-7 vergriffen, nicht mehr lieferbar |
Das Alter und die alternde Gesellschaft sind als Zukunfts thema präsent. Das Spektrum reicht von der Inszenierung eines aktiven und vitalen Seniorendaseins bis zum Schreckensbild einer Vergreisung der Gesellschaft und des Krieges der Generationen. Die gerontologischen Disziplinen übernehmen dabei nicht selten die Rolle eines Advokaten. Sie beschreiben das Altern nicht nur, sie wollen es optimieren und gestalten. Ethische Leitvorstellungen sind dabei immer schon im Spiel. Obwohl größere interdisziplinäre Netzwerke zur Altersforschung entstanden sind, haben sich im deutschen Sprachraum Ethik und Theologie - mit Ausnahme der Praktischen Theologie - dieses Zukunfts themas noch nicht angenommen. Rieger begibt sich ins interdisziplinäre Gespräch mit den gerontologischen Disziplinen und mit philosophischer Ethik, um theologisch verantwortbare Kategorien des Umgangs mit dem Altern zu erheben. Anknüpfen lässt sich dabei an Umgangsweisen, welche der Leiblichkeit, Begrenztheit und Endlichkeit des Menschen ebenso Rechnung tragen wie dessen Willen zum Leben und zur Gesundheit.Das Altern zu gestalten setzt Anerkennung und Aneignung des Alterns voraus. Der Blick wird sich dabei öffnen müssen für die Angewiesenheitsstruktur, die das ganze menschliche Dasein auszeichnet - und die sich im Alter lediglich konkretisiert und radikalisiert. Rechtfertigungstheologisch lässt sich das Alter so auch als Testfall christlicher Existenz entschlüsseln. | |
Jörg Lauster Zwischen Entzauberung und Remythisierung Zum Verhältnis von Bibel und Dogma Evangelisches Verlagshaus, 2008, 100 Seiten, Paperback, 14 x 21 cm 978-3-374-02599-2 vergriffen, nicht mehr lieferbar |
Nach dem reformatorischen Verständnis fungiert die Bibel für die theologische Urteilsbildung als letztes normatives Prinzip. In der praktischen Umsetzung theologischer Arbeit stößt diese prinzipielle Geltung auf massive Schwierigkeiten, die mit der Behauptung, die Bibel sei Wort Gottes und Heilige Schrift, nicht einfach aufgelöst werden können. Demgegenüber wird die Bibel als Ausdrucksuniversum von Gotteserfahrungen in den Blick genommen, das primär nicht auf normative Lehre, sondern auf Wiederanknüpfung und Weitergabe dieser Erfahrungen ausgerichtet ist. In diesem Sinne stellt die Bibel ein notwendiges Korrektiv für die reflexive Bearbeitung christlicher Inhalte in der Dogmatik bereit, indem sie auf den Erfahrungsgrund der Lehrbestände zurückführt. Dabei wächst der Exegese als Erhellung dieses Erfahrungsgrundes eine fruchtbare Aufgabe für die Entfaltung der Systematischen Theologie zu. |