| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
|
Research in Contemporary Religion, RCR, Vandenhoeck & Ruprecht |
||
 |
Kaia Rønsdal Calling Bodies in Lived Space Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, 202 Seiten, Gebunden, 15,5 x 23,2 cm 978-3-525-57091-3 75,00 EUR |
Research in Contemporary Religion, RCR Band 27: Kaia Rønsdal combines the perspective of production of space, ethical theory and fieldwork, focusing on the contradictions in lived space, by observing encounters and interactions between different groups of people in everyday public space. It is an interdisciplinary contribution to the science of diaconia. The interest lies with the lives that diaconia traditionally have been concerned with and the spaces where these lives are lived, exploring the concept of calling through narratives of these lives and spaces. The book challenges and contributes to traditional and contemporary notions of calling as it is understood in the Scandinavian tradition. These notions, stemming from interpretations of Luther, place the calling among humans, as opposed to it being something exclusively divine and ecclesiastical. The discussion on the calling is enriched with concepts stemming from French sociology and human geography, primarily from H. Lefebvre and M. Foucault, as well as phenomenological contributions. These are concerned with the significance of body, space, urbanity, and spatial interpretation as space is a relational, formative phenomenon constituted in practice and interaction. Through methodologies developed from phenomenology and spatial theory, where the researcher subject is an evident embodied participant, detailed accounts from the field form the material, describing everyday life in an Oslo cityscape. From this material, the concept of calling is explored, developing the discussion from the perspective of the spaces of others. The assumption being that it is in the spaces where people meet and bodies respond to other bodies, whether marginalised or not, that calling may manifest itself. Through spatial analysis of the minute details of bodies and socialities in everyday life, new material for ethical considerations is explored. The analysis and discussion may enrich and further deepen the understanding of what takes place in public spaces, recognising them as a source of knowledge in a range of disciplines. These everyday encounters may also be described and analysed as contributions to the development of theory and praxis of diaconia. Leseprobe |
 |
Tatjana K. Schnütgen Tanz zwischen Ästhetik und Spiritualität Theoretische und empirische Annäherungen Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, 504 Seiten, Gebunden, 15,5 x 23,2 cm 978-3-525-57081-4 110,00 EUR |
Research in Contemporary Religion, RCR
Band 26: Tatjana Schnütgen untersucht die Bezüge zwischen Tanz, Ästhetik und Spiritualität. Während Tanz ein kultur- und religionsübergreifendes Phänomen darstellt, ist „Kirchentanz“ ein Phänomen, das in Deutschland erst in den vergangenen Jahrzehnten in unterschiedlichen Spielarten und Stilen entwickelt wurde. Welche Bedeutung können „kirchliche Tanzszenen“ für die an ihnen Teilnehmenden haben? Wie ist die damit verbundene ästhetische Erfahrung zu beschreiben? Welche Wirkungen für Glaube und Spiritualität und welche Implikationen für die Praktische Theologie bringt der Tanz mit sich? Kann die Kategorie der „ästhetischen Erfahrung“ eine Vermittlungsfigur zwischen Tanz und Spiritualität bilden? Schnütgen legt eine umfangreiche qualitativ-empirische Untersuchung zur Bearbeitung dieser Fragen vor und bietet interdisziplinäre Reflexionen. Dabei geraten Tanzwissenschaft, Philosophie, Empirie und Praktische Theologie in ein gemeinsames Feld, in dem die Autorin tatsächliche und mögliche Wechselwirkungen auf vielfältige Weise sichtbar macht. Kirchentanz wird in seinen unterschiedlichen Aspekten nicht nur auf der Basis vorliegender Abhandlungen „über“ Tanz dargestellt, sondern seine Gestalt und Bedeutung aus den Äußerungen derer, die im Kirchentanz aktiv sind, generiert. Ihre Erkenntnisse gewinnt Schnütgen durch die theoretischen Herangehensweisen und Methoden der empirischen Sozialforschung, die sie schließlich unter den kulturwissenschaftlichen Reflexionsperspektiven der „Semiotik“ und „Performativität“ einordnet und würdigt. |
 |
Heinz Streib Was bedeutet Spiritualität? Befunde, Analysen und Fallstudien aus Deutschland Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, 282 Seiten, Gebunden, 15,5 x 23,2 cm 978-3-525-60453-3 100,00 EUR |
Research in Contemporary Religion, RCR
Band 20: „Ich bin mehr spirituell als religiös“ sagen immer mehr Menschen in den U.S.A., aber auch in Deutschland. Was heißt hier „Spiritualität“? Welche psychologischen und biographischen Veränderungen sind damit verbunden? Heinz Streib und Barbara Keller geben Antworten, gestützt auf die qualitativen und quantitativen Ergebnisse der an der Universität Bielefeld durchgeführten Studie zur Semantik und Psychologie von „Spiritualität“. Eine lohnenswerte Lektüre über Veränderungen im religiösen Feld für alle, die sich an Universität und Schule, in Seelsorge und Beratung, in Kirchen und Medien mit dem Phänomen „Spiritualität“ beschäftigen. Dr. theol. Heinz Streib ist Professor für Praktische Theologie, Religionspädagogik, Religionspsychologie und Biographische Religionsforschung an der Universität Bielefeld. Dr. Barbara Keller ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Disziplin Religionspsychologie / Biographische Religionsforschung mit Forschungsschwerpunkten „Dekonversion“ und „Spiritualität“ an der Universität Bielefeld. |
| Research in Contemporary Religion, RCR Band 19: | ||
 |
Stine Holte Meaning and Melancholy in the Thought of Emmanuel Levinas Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, 192 Seiten, Gebunden, 15,5 x 23,2 cm 978-3-525-60452-6 85,00 EUR |
Research in Contemporary Religion, RCR
Band 18: Although considered as one of the 20th century most central ethical thinkers, Emmanuel Levinas claimed that his task was not to construct an ethics, but to seek the meaning of the ethical. This claim is the point of departure of the present study, which asks how ethics could be regarded as meaningful at all in light of the crisis of meaning that according to Levinas is inherent to being. Ethical meaning is for Levinas sought “otherwise than being or beyond essence” in terms of a radical responsibility for the Other. At the same time, it is questionable whether the ethical may be said to represent an overcoming of the crisis of meaning. This is visible in Levinas’ rather harsh descriptions of the ethical situation, involving not only the meaningless, but also feelings like melancholy, trauma, and shame. As the study shows, such feelings can for Levinas not be seen apart from their religious significance, although Levinas does not rely on conventional theology, but rather understands transcendence in a deeply sensible manner. This is shown in the radical passivity and self-emptying – to the point of messianism – of the responsible subject, which is the only way the meaning of the ethical may be rescued. The study also discusses how the utopian aspect of such a position is problematic in practical life, and why Levinas therefore admits the need for the ethical to be betrayed in ontology, which also implies an involvement with aesthetics as “ontological par excellence. |
 |
Jan Peter Grevel Mit Gott im Grünen Eine Praktische Theologie der Naturerfahrung Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, 357 Seiten, Gebunden, 15,5 x 23,2 cm 978-3-525-60451-9 150,00 EUR |
Research in Contemporary Religion, RCR
Band 17: Gegenwärtige Naturerfahrungen spielen für das Leben in der modernen Welt eine paradoxe Rolle. Einerseits werden sie aus dem Alltag einer technisierten, rationalen Weltsicht zunehmend verdrängt. Andererseits zeigt sich gerade in einer verschärften ökologischen Krise eine zunehmende Sehnsucht nach Natur. Dabei ist zu beobachten, dass Naturerfahrungen oft mit religiös aufgeladenen Sprach- und Erfahrungswelten verbunden sind und zwar inmitten, aber vor allem auch außerhalb kirchlicher Angebotsformen. Theologiegeschichtlich ist dabei das Verhältnis zwischen Naturerfahrung und Glaube durch die Debatten um eine natürliche Theologie unbestritten noch immer belastet. So erstaunt es nicht, dass eine theologisch reflektierte Auseinandersetzung mit dem Thema Natur auch in der Praktischen Theologie der letzten Jahrzehnte faktisch ausgespart wurde. Eine Praktische Theologie der Naturerfahrung hat daher die Aufgabe, darauf mit einer Analyse zu reagieren, die das ganze Feld dieser gegenwärtigen Erfahrungen untersucht. Die vorliegende Arbeit wählt dabei einen Zugang, der bei der empirischen Erkundung von Phänomenen gelebter Religion einsetzt. Die einzelnen Analysegänge untersuchen methodisch ausdifferenziert den massenmedialen Naturdiskurs anlässlich der Elbeflut in Ostdeutschland 2002, die qualitative Bildanalyse von Urlaubsfotos am Meer, eine dichte Beschreibung einer Kleingartensiedlung in Hannover und schließlich eine Gipfelwanderung zu einem Berg der Alpen. Diese empirischen Erkundungen verhelfen in der Folge zu einer Klärung zentraler Reflexionsperspektiven der Theologie und wollen zugleich ein Debattenbeitrag zu den aktuellen Diskursen über Lebenswelt, Religion, Leiblichkeit und Räumlichkeit in der Moderne sein. Dr. theol. Jan Peter Grevel ist Privatdozent für Praktische Theologie an der Goethe Universität Frankfurt, war bis 2014 Pfarrer in Altheim/Alb und ist nun im Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart tätig. |
 |
Stefanie Knauss More than a Provocation Sexuality, Media and Theology Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, 230 Seiten, Gebunden, 15,5 x 23,2 cm 978-3-525-60450-2 89,00 EUR |
Research in Contemporary Religion, RCR
Band 16: Sex, Medien und Theologie – eine provokante Mischung, auf die man mit Ablehnung oder Offenheit reagieren kann. Der vorliegende Band versucht das letztere: Auf dem Hintergrund der gesellschaftlichen Veränderungen im Leben und Erleben von Sexualität und der theologischen Entwicklungen in der Reflektion von Sexualität werden beispielhaft drei Medien – Internet, Werbung und Film – in Bezug auf ihre Darstellung von Sexualität und ihren Beitrag zu einer theologischen Reflektion von Sexualität analysiert. Dabei zeigt sich: Sex in den Medien ist mehr als eine Provokation: es ist Anregung und Beitrag zum theologischen Nachdenken über die Menschen, ihre Beziehungen und letztlich auch über ihre Beziehung zu Gott. Sex, Media and theology – a provocative mix. Reactions can vary from rejection to openness and curiosity. This volume follows the latter path: on the background of changes in contemporary sexual culture and theological developments in the reflection on sexuality, three media – internet, advertising and film – are analysed with respect of their representation of sexuality and their contribution to theological reflections on sex. This shows: sex in media is more than a provocation; it provides an inspiration for theological thinking about human beings, their relationships with others, and also with God. |
 |
Rosemarie van den Breemer Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, 328 Seiten, Gebunden, 15,5 x 23,2 cm 978-3-525-60449-6 150,00 EUR |
Research in Contemporary Religion, RCR
Band 15: Shaped by five hundred years of Lutheran impact and with a strong influence of big majority churches, Scandinavian secularity is a very interesting and fruitful material for the historical and contemporary theoretical debate on the secular. It can be discussed, for example, whether the strong position of Human Rights and of the Scandinavian welfare state might be interpreted in continuity with the historical influence of Protestant traditions. Is there something like a hidden sacrality implicit in the Scandinavian secular? |
 |
Monika Glavac, Anna-Katharina Höpflinger,
Daria Pezzoli-Olgiati Second Skin Körper, Kleidung, Religion Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, 303 Seiten, Gebunden, 15,5 x 23,2 cm 978-3-525-60448-9 95,00 EUR |
RResearch in Contemporary Religion, RCR
Band 14: Aktuelle öffentliche, mediale und politische Debatten fokussieren auf Körper und Kleidung im Zusammenhang mit Religion. »Second Skin« bietet anhand der Kategorien Identität, Repräsentation, Produktion und Rezeption sowie Regulierung einen kulturwissenschaftlichen Zugang zu Kleidung, Körper und Religion. Ausgehend von einem Konzept des Körpers als prozessuale, identitätsstiftende Grundlage der Person über die Analyse von Praktiken und Repräsentationen von Körper und Kleidung bis hin zur Analyse öffentlicher Machtdiskurse und Selbstregulierungen tragen in diesem Band Forschende aus unterschiedlichen Disziplinen zu einer religionstheoretischen Erfassung von Kleidung bei. Monika Glavac Dr. des., ist Forschungsassistentin am Zentrum für Religion Wirtschaft und Politik (ZRWP) an der Universität Zürich. Sie promovierte 2011 über Karikaturen und Religion mit dem Titel Der Fremde in der europäischen Karikatur. Eine religionswissenschaftliche Studie über das Spannungsfeld zwischen Belustigung, Beleidigung und Kritik. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen europäische Karikatur- und Religionsgeschichte, Medien und Religion sowie Religion und Identitätsprozesse. Dr. Anna-Katharina Höpflinger ist Assistentin am Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik (ZRWP). Sie studierte Religionswissenschaft an der Universität Zürich und promovierte 2008 zum Thema Drachenkampf im Alten Orient und der griechisch-römischen Antike. 2009 - 2011 war sie Mitglied des Projektes Commun(icat)ing Bodies der Universität Graz. Ihre aktuellen Forschungsschwerpunkte umfassen Medien und Religion, Kleidung und Religion, Gender und Religion, europäische und antike Religionsgeschichte, Drachenkampfmythen und Black Metal. Sie ist Mitglied der Forschungsgruppe Medien und Religion. Prof. Dr. Daria Pezzoli-Olgiati, 1966, leitet seit 2010 das Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik (ZRWP) der Universitäten Basel, Lausanne, Luzern und Zürich. Nach dem Studium der Theologie an den Universitäten Freiburg/Schweiz und Zürich promovierte sie 1996 mit der Arbeit äuschung und Klarheit. Zur Wechselwirkung zwischen Vision und Geschichte in der Johannesoffenbarung 2002 folgte die Habilitation mit der Arbeit mmagini urbane. emInterpretazioni religiose della città anticand die venia legendi in Religionswissenschaft. Von 2004 bis 2009 war sie Förderungsprofessorin des SNF für Religionswissenschaft an der Universität Zürich. Forschungsaufenthalte brachten sie nach Rom, Oxford und Trento. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Gebieten Medien und Religion, Religion und Visualität, Film und Religion, Raum- und Gendertheorien, Religionsgeschichte der Antike und Europas. |
 |
Mike Gray Transfiguring Transcendence in Harry Potter, His Dark Materials and Left Behind Fantasy Rhetorics and Contemporary Visions of Religious Identity Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, 320 Seiten, Gebunden, 15,5 x 23,2 cm 978-3-525-60447-2 150,00 EUR |
Research in Contemporary Religion, RCR Band 13: Constructive, critical and profoundly paradoxical. Three recent and commercially successful series of novels employ and adapt the resources of popular fantasy fiction to create visions of religious identity: J.K. Rowling’s Harry Potter books, Phillip Pullman’s Dark Materials and Tim LaHaye and Jerry Jenkins’ Left Behind series. The act of creating fantasy counter-worlds naturally involves all three stories in the creation of what Mike Gray terms “transfigurations of transcendence”: hopeful albeit paradoxical encodings of the ambiguous, non-observable reality whose primary locus in modern society is the societally extra-systemic human individual. Popular fantasy fiction turns out to involve acts of world-creation that are inherently religious and inherently paradoxical.A substantive examination shows that all three are involved in more or less intentional re-narrations of traditional Christian beliefs and narratives. The »atheist« His Dark Materials series does not deny but re-imagines the Christian visions of selfhood; the »traditionalist« Left Behind series does not simply replicate but modifies its own declared values; the apparent secularity of the Harry Potter series is shaped by its creative reception of Christian patterns and narratives. While the stories’ visions of selfhood clearly clash, the basic paradoxes involved in their struggle to articulate transcendence expose significant parallels and a productive conversation with the Christian tradition.It is not simply that popular fantasy fiction is theologically relevant – the Christian Heilsgeschichte, too, proves to be highly relevant in popular culture. However, while far from obsolescent, models of religious identity in contemporary society require criticism and creativity – and, as evinced most powerfully in the Harry Potter stories, a flair for constructive engagement with paradox. |
 |
Kirk VanGilder Making Sadza With Deaf Zimbabwean Women A Missiological Reorientation of Practical Theological Method Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, 184 Seiten, Gebunden 978-3-525-60446-5 100,00 EUR |
Research in Contemporary Religion, RCR Band 12: Missiological calls for self-theologizing among faith communities present the field of practical theology with a challenge to develop methodological approaches that address the complexities of cross-cultural, practical theological research. Although a variety of approaches can be considered critical correlative practical theology, existing methods are often built on assumptions that limit their use in subaltern contexts. Kirk VanGilder addresses these concerns by analyzing existing theological methodologies with sustained attention to a community of Deaf Zimbabwean women struggling to develop their own agency in relation to child rearing practices. He explores a variety of theological approaches from practical theology, mission oriented theologians, theology among Deaf communities, and African women’s theology in relationship to the challenges presented by subaltern communities such as Deaf Zimbabwean women. Rather than frame a comprehensive methodology, VanGilder proposes attitudes and guideposts to reorient practical theological researchers who wish to engender self-theologizing agency in subaltern communities. Zusammenfassung Eine Gemeinschaft von tauben Simbabwischen Frauen steht im Fokus dieser methodologischen Analyse. Kirk VanGilder untersucht dieses religionspraktische Beispiel unter religionstheoretischen Gesichtspunkten. |
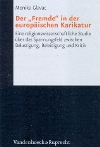 |
Monika Glavac Der Fremde in der europäischen Karikatur Eine religionswissenschaftliche Studie über das Spannungsfeld zwischen Belustigung, Beleidigung und Kritik Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, 200 Seiten, Gebunden, 978-3-525-60445-8 89,00 EUR |
Research in Contemporary Religion, RCR Band 11: Die Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen im September 2005 in der dänischen Tageszeitung Jyllands-Posten löste einen weltweiten Konflikt aus, der sich auf politischer und wirtschaftlicher, aber auch medialer, kultureller und sozialer Ebene ausdrückte. Der sogenannte Karikaturenstreit spielte sich vor allem in den ersten Monaten des Jahres 2006 ab und entfachte in europäischen Medien eine heftige Diskussion über Bilderverbot, Zensur, Verletzung religiöser Gefühle und Meinungsfreiheit. Monica Glavac nähert sich dieser Thematik, indem sie die Darstellungsform der Karikatur ins Zentrum rückt und der Frage nachgeht, wie Muslime und Elemente der islamischen Tradition in europäischen Karikaturen als »das Fremde« dargestellt werden. Glavac macht dabei einerseits eine Reise zurück in die Geschichte der Karikatur, zeigt auf, was Karikaturen charakterisiert, in welchem Umfeld sie entstanden und wie sie sich entwickelten. Andererseits untersucht sie, welche Merkmale die Darstellung von Muslimen und Elementen der islamischen Tradition in ausgewählten historischen Fallbeispielen kennzeichnen. Mit dieser Rückblende bettet sie die Mohammed-Karikaturen und den Karikaturenstreit in ein breites kulturelles und historisches Umfeld ein. Das Verhältnis zwischen Eigenem und Fremdem, das als roter Faden durch das Buch leitet, wird auf einer theoretischen Ebene als eine bewegliche Größe betrachtet: Fremdes kann vertraut, Eigenes fremd werden. Weitere theoretische Überlegungen erfolgen zum konfliktgeladenen Verhältnis zwischen Karikatur und Religion. Zur Untersuchung der historischen Fallbeispiele und der Mohammed-Karikaturen dienen bildwissenschaftliche und hermeneutische Zugänge zu Bildern als wichtige Grundlage. Glavac zeigt damit, wie man aus religionswissenschaftlicher Perspektive mit einem Phänomen wie dem Karikaturenstreit umgehen kann. |
 |
Ingolf U. Dalferth Religion und Konflikt Grundlagen und Fallanalysen Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, 304 Seiten, Gebunden, 978-3-525-60440-3 110,00 EUR |
Research in Contemporary Religion, RCR
Band 8: Theorien und Fallstudien zur Bewältigung von Konflikten in und mit der Religion.Die Beiträge des vorliegenden Bandes gehen größtenteils auf eine Tagung der Deutschen Gesellschaft für Religionsphilosophie zurück. Die erste Hälfte ('Grundlagen: Zur Theorie religiöser Konflikte') behandelt das Thema in sechs Beiträgen aus philosophischer und fundamentaltheologischer Perspektive, und zwar primär mit Blick auf die ontologischen bzw. semantischen, handlungstheoretischen, ethischen, geschichtsphilosophischen, erkenntnistheoretischen und anthropologischen Implikationen religiöser Konflikte. Der zweite Teil (»Fallanalysen: Zur Wahrnehmung und Bewältigung von Konflikten in und mit der Religion«) bietet fünf religionsphilosophische und hermeneutisch-theologische Analysen exemplarischer religiöser Konfliktfelder unter der Leitfrage der Konfliktwahrnehmung und -bewältigung. Diskutiert wird das Problem heiliger Schriften in Judentum, Christentum und Islam; der Konflikt zwischen Theologie und Naturalismus; der Absolutheitsanspruch des christlichen Monotheismus; das religiöse Konfliktpotential politischer Umbrüche am Beispiel Südafrika; die dialogorientierte Interaktion als Konfliktbewältigungsstrategie im Religionsunterricht. |
| ISBN | Autor | Titel | EUR | Jahr | ||
| 10 | 978-3-525-60442-7 | Daria Pezzoli-Olgiati | Approaches to the Visual in Religion | 95,00 |
|
2011 |
| 9 | 978-3-525-60444-1 | Werner Ustorf | Robinson Crusoe goes again. Missiology and European Construction of Self and Other in a Global World 1789-2010 | 95,00 |
|
2010 |
| 8 | 978-3-525-60440-3 | Ingolf U. Dalferth | Religion und Konflikt. Grundlagen und Fallanalysen | 110,00 |
|
2011 |
| 7 | 978-3-525-60443-4 | Sigurd Bergmann | Raum und Geist. Zur Erdung und Beheimatung der Religion - eine theologische Ästhetik des Raumes | 89,00 |
|
2010 |
| 6 | 978-3-525-60441-0 | Espen Dahl | The Holy. Theoretical Perspectives | 79,00 |
|
2010 |
| 5 | 978-3-525-60439-7 | Heinz Streib | Deconversion. Qualitative and Quantitative Results from Cross-Cultural Research in Germany and the United States of America | 89,00 |
|
2009 |
| 4 | 978-3-525-60438-0 | Trygve Wyller | Heterotopic Polis. New research on religious work for the disadvantaged | 85,00 |
|
2008 |
| 3 | 978-3-525-60435-9 | Christopher P. Scholtz | Alltag mit künstlichen Wesen. Theologische Implikationen eines Lebens mit subjektsimulierenden Maschinen am Beispiel des Unterhaltungsroboters Alibo | 100,00 |
|
2008 |
| 2 | 978-3-525-60436-6 | Wyller / Nayar | The Given Child. The Religions' Contributions to Children's Citizenship | 59,00 |
|
2007 |
| 1 | 978-3-525-60434-2 | Scholtz / Heimbrock | Religion: Immediate Experience and the Mediacy of Research | 85,00 |
|
2007 |