| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Goldregen, Verlag Ernst Franz, Metzingen | ||
|
Erzählungen und Lebensbilder alle Hefte sind ungebrauchte Neubücher - ca 50 Jahre Lagerung hinterlassen allerdings Spuren an den Heftklammwn und leichte Bräunungen |
||
 |
Johannes Weissinger D' Bas' Schmiede Einiges aus ihrem Leben Franz, 1973, 20 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 5 Vorwort Der Verfasser wollte ursprünglich diese Erzählung anonym erscheinen lassen. Von Freunden gedrängt, hat er nun doch auf dem Titel seinen Namen genannt. Der Leser wäre vermutlich selbst darauf gekommen, daß der mehrfach erwähnte Enkel der Bas' Schmiede der Verfasser selber ist. Den Text selbst wollte er nicht mehr ändern. Ihm lag nur daran, ein wahrhaftiger Berichterstatter wertvoller Erlebnisse zu sein, von denen er hofft, daß ihre Lektüre auch manchem Leser einen Segen vermittle. Leseprobe: Wer im Frühsommer des Iahres 1893 dem riesigen Leichenzug begegnet wäre. der sich durch das schwäbische Landstädtchen Weilheim/Teck bewegte, hätte sicher gedacht, da werde der Herr Stadtpfarrer oder der Herr Stadtschultheiß zu Grabe getragen. Auf eine neugierige Frage nach dem Namen des Verstorbenen hätte er aber die Antwort bekommen: ..D' Bas' Schmiede". Von dieser so geehrten und geliebten Frau will ich einige Züge ihres Wesens und einige Begebenheiten aus ihrem Leben weitergeben. D' Bas' Schmiede hieß sie, weil ihr Mann Schmied war. Er besaß auch eine kleine Landwirtschaft. Diese betrieb in der Hauptsache seine Frau. Daß sie Base genannt wurde, war nichts Ungewöhnliches. Wir nannten damals als Kinder jede Frau Bas' und jeden Mann Vetter. Damals gab es eben noch echtes Gemeinschaftsgefühl; denn damals waren die Leute noch arm. Seit sie reich geworden sind und aus der Stadt Genüsse, die nur für Geld zu kaufen sind, aufs Land hinausgewandert sind, ist diese Art von Gemeinschaftsgefühl leider mehr und mehr verloren gegangen... |
 |
Gottlob Mayer 's Ameile Blicke in die Chronik einer schwäbischen Familie, dem kleine^n Lob nacherzählt, 6. Auflage 1968 Franz, 1968, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 6 Leseprobe In dem Dorf Rohrbronn hier oben, an dem wir soeben vorübergeschritten sind, lebte vor ungefähr 80 Jahren mein Großvater, ein Mann, der in dem \"Veinberg, auf dessen Mauer wir hier sitzen, sich's bei Frost und Hitze hat sauer werden lassen wie nur einer. Doch kannte er ein .,Vörtele" (einen kleinen Vorteil), mit dem er sich seine saure Arbeit zu süßen verstand, von dem freilich nicht viele Leute mehr Wissen: das war der stille Umgang mit Gott. Davon konnte er nie genug kriegen. Seine Kinder kannten das Erdloch noch wohl, das er sich gegraben hatte, um darin während der Arbeitspausen ungestört auf den Knien seinem Gott zu nahen. In dieser Grube hatte er Vergebung seiner Sünden erlangt und ebendort, am Ende seines Lebens, auch Gewißheit über seinen baldigen Heirngang erhalten. Als ein Mann, der die Achtung der ganzen Gemeinde genoß, war er schon in seinen jüngeren Iahren zum Schulmeister des Orts gewählt worden. Neben seinen Weingärtnersgeschäften versah er dieses Amt mit viel Geschick und unter sichtlichem Segen. Sein Haus war das „Stundenhaus" und als solches Treffpunkt und Herberge der Gottesfürchtigen -in der ganzen Gegend. Von seinen fünf älteren Söhnen, Johannes, Henoch, Elias, Thomas und Christian, wurde er im ..Wengert" (im l/Veinberg), im Stall und im Feld treulich unterstützt, und der zuletzt genannte Sohn Christian wurde nachmals auch sein Nachfolger im Schulamt. Der jüngste aber, „Lobel", mein lieber Vater, von dem ich meinen Namen erhalten habe, mußte bald in die Fremde ziehen. Viele Jahre brachte er als Schmiedegeselle namentlich in Bayern und in der Schweiz zu, Wo er in den Kriegsjahren merkwürdige Errettungen aus augenscheinlícher Lebensgefahr erfahren hat. Reich an Erfahrung, doch etwas verwelscht, kehrte der Lobel endlich in die Heimat zurück. Mittlerweile War die Zeit ... |
 |
Gottlob Mayer 's Ameile Blicke in die Chronik einer schwäbischen Familie, dem kleinen Lob nacherzählt, 5. Auflage 1962 Franz, 1962, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
|
 |
Julie Koch Das Stuttgarter Silberglöcklein Eine Geschichte für Mädchen Franz, 1970, 28 Seiten, 50 g, geheftet, 2,60 EUR |
Goldregen Heft 12 Leseprobe Das Nesthäkchen bei Dr. Hillers, die kleine Ruth, war jetzt sechs Wochen alt. Da war der Zeitpunkt gekommen, an dem nach der Vereinbarung, die man mit der Säuglingsschwester getroffen hatte, die Pflegezeit von Mutter und Kind abgelaufen war. Doch die schwache, zarte Frau hatte sich diesmal nur sehr langsam erholt, auch war noch eine Venenentzündung dazugekommen, so daß sie ihr Mann, der Arzt war, für nicht absehbare Zeit ins Bett sprach. Bekümmert sah sie zu ihm auf. Er aber meinte tröstend: »Wir wollen hoffen, daß Fräulein Mina noch länger bei uns bleiben und dich gesund pflegen kann.<< Sie seufzte: ››Ach, dann bleibt in unserem Haushalt alles liegen! Der Flickkorb wird jede Woche voller. Du weißt nicht, was drei Buben alles zerreißen. Dazu wird es Zeit, für Gretel die Winterkleider zu richten; sie wächst aus allem hinaus. Und ich soll untätig hier liegeni« In diesem Augenblick klingelte das Telefon und rief den Doktor ab. Als er den Hörer wieder aufgelegt hatte, kam Fräulein Mina, die Säuglingsschwester, aus der Küche heraus und wünschte ihn allein zu sprechen. Sie eröffnete ihm, daß sie in drei, spätestens vier Wodien eine neue Wochenpflege antreten müsse und riet zugleidi, zur besseren Versorgung der kranken Mutter und ihres Säuglings sofort eine Aushilfe zu nehmen, damit diese womöglich noch von ihr eingelernt werden könne. - So geschah es dann auch. Vierzehn Tage später, am 1. November, fuhr das neue Mädchen schon der Hauptstadt zu, um ihre neue Stelle bei Dr. Hillers anzutreten. Wenn sie daran dachte, wie lange sie schon diesem Ziel zugestrebt hatte, das sie heute erreichen sollte, dann freute sie sich von Herzen. Seit dem sechzehnten Jahr hatte Marie den stillen Wunsch gehegt, in Stuttgart ... |
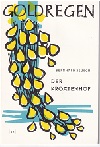 |
Bernhard Reusch Der Kroatenhof Eine Erzählung aus dem Dreißigjährigen Krieg Franz, 1967, 30 Seiten, 50 g, kartoniert, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 15 Leseprobe In Nürtingen steht ein eigentümliches, mittelalterlich anmutendes Gebäude. Ein kleiner Hof vor dem Hause wird durch ein rundbogiges, zinnengekröntes Eingangstor gegen die vorbeiführende Straße abgeschlossen. Das Haus ist schon gut dreieinhalb Jahrhunderte alt; auf der Giebelseite trägt es die Jahreszahl 1606. In der Stadt heißt dieses Haus ››der Kroatenhof<<, denn hier hat sich Während des Dreißigjährigen Krieges ein Kroat aus Ungarn namens Hans Rooschüz niedergelassen, der ein achtbarer Bürger in Nürtingen geworden war. Wie es dazu gekommen ist, will die nachstehende Geschichte erzählen. Sie geht zurück auf Vorarbeiten des früheren Nürtinger Spitalpflegers Fuchslocher sowie auf eine Darstellung aus der Feder der schwäbischen Sdiriftstellerin Ottilie Wildermuth, die selbst eine geborene Rooschüz war und uns die Geschichte schon vor über hundert Iahren in ihrem »Kroatenähne« geschenkt hat. Magdalenas Entführung Es war im September 1634. Ein heißer Spätsommertag war heraufgezogen; brütende Hitze lag über dem Neckartal. Auf den Mauern und Wällen der Stadt Nürtingen standen die wehrfähigen Bürger im Kampfeslärm, denn seit einigen Tagen war sie von einem Haufen wilder Kroaten belagert und aufs schwerste bedrängt. Das Land Württemberg hatte an der Last des entsetzlichen Krieges schon schwer genug getragen; was aber jetzt, nach der unglücklichen Schlacht bei Nördlingen, über das arme Land hereinbrach, war mit den ... |
 |
Elisabeth Oehler-Heimerdinger Die Annemrei von Weil Ein Lebensbild, 4. Auflage 1969 Franz, 1969, 24 Seiten, 50 g, geheftet, 0 2,60 EUR |
Goldregen Heft 21 Leseprobe: Zwischen den frischgrünen Buchenwäldern und den weiten Flächen der Kornfelder und Krautäcker des Schönbuchs ist Anna Maria Bälz in dem kleinen Örtchen Neuweiler aufgewachsen, das damals schon nach Weil eingepfarrt war. Die Bauernfrauen, die kein eigenes Backhäuslein bei ihrem Hof besaßen, brachten ihrem Vater, dem „Bälzenbäck"", ihre Brotlaibe und ihre Kirbekuchen und an Weihnachten ihre Lebkuchen und Springerle zum Backen. Werktags besorgte er daneben seine Landwirtschaft, und auf den Sonntag buk er Brezeln, denn da Wollten die Leute nach altem Herkommen ihre frischen braunen Laugenbrezeln haben. So lebten die Bäckersleute von ihrer Backstube und dem Ertrag ihrer Äcker. Äcker und Kornfelder gaben her, was das Wild übrigließ, das damals im ganzen Schönbuch überhand nahm und das kein Bauer schießen durfte, weil es für die Iagden des Herzogs Karl Eugen gehegt wurde. Wenn der Herzog mit seinem ganzen Hof zur Iagd kam, mit Iägern, Treibern und Hunden, dann zertraten sie den Leuten dazu noch die Wintersaat. So blieben die Bauern arm und waren froh, wenn es in den Wäldern Arbeit für sie gab: Gräben ziehen, Bäumchen auspflanzen, Holz fällen und dergleichen Geschäfte mehr. Mit dem geringsten Lohn waren sie zufrieden. Um einen Kreuzer huben sie einen ganzen Meter Graben aus; ja, es kam vor, daß sich einer anbot, es noch unter einem Kreuzer zu machen. wenn er nur Arbeit bekam: „I will den eine Kreuzer au no wegdo, bloß daß i d' Arbet krieg."" Im Bäckerhaus wuchsen zwei Töchter auf. Die andern Kinder, ein paar Buben, waren alle klein gestorben, wie es in den Bauernhäus-ern zu jener Zeit oft der Fall war. Kinderkrankheiten ... |
 |
Elisabeth Oehler-Heimerdinger Die Annemrei von Weil Ein Lebensbild, 3. Auflage 1962 Franz, 1962, 24 Seiten, 50 g, geheftet, 2,60 EUR |
|
 |
Paul Otto Der Eberle von Zell Ein schwäbischer Glaubensmann Franz, 1968, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen
Heft 22 Äm Leben dieses seltenen Mannes zeigt sich mit überzeugender Deutlichkeit. welch ein Wandel in der inneren Haltung der Menschen während der letzten 100 oder 150 Iahre vor .sich gegangen ist. Die Jahre seiner Jugend mit ihrer nicht abreißenden Kette von immer schwerer werdenden Kriegen und politischen Erschütterungen von gewaltigen Ausinaßen erinnern sehr stark an unsere Zeit. Vor allem ist es aber sein Einzelschicksal als Verschleppter, das auffallende Parallelen zur Gegenwart aufweist. Er teilte sein bitteres Los allerdings nicht mit Millionen, wie dies seine Leidensgefährten von heute tun. Es bleibe hier unausgemacht. was schwerer ist: einem scheinbar blíndwütenden Schicksal als einzelner preisgegeben zu sein oder aber in Gemeinschaft vieler Tausender. denen es auch so oder noch schlimmer geht. Nichts ist ihm erspart geblieben an irdischer Not. an Kümmerriissen und Verlegenheiten. Es geriet ihm aber alles zum Heil. Warum? - Er verstand sein Schicksal als Reden Gottes. ganz speziell «an ihn gerichtet. und ließ sich diese gewaltige Sprache zu Herzen gehen und fand dabei sein Glück. Ganz anders der moderne Mensch. Seit über einem Menschenalter handelt der Allmächtige mit ihm auf bisher noch nie erlebte Weise, spricht, nein - man kann es schon kein Sprechen mehr nennen - ruft, ja brüllt, daß es durch Mark und Bein gehen und die härtesten Herzen erschüttern müßte. Nicht einer der heute Lebenden kann behaupten, sein Ohr habe dieses Brüllen nicht erreicht. Im fahlen Schein von Ereignissen apokalyptischen Ausmaßes ist jedem die ganze Leere, \fVertlosigkeit und Nichtigkeit aller irdischen Glücksgüter ... |
 |
Elisabeth Oehler-Heimerdinger Wohin der Weg auch führt Das Lebensschicksal einer jüdischen Frau Franz, 1963, 32 Seiten, 50, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 26 Wohin der Weg auch führt, sollst du mich leiten! Es wechseln Volk und Zeiten -- Dein Reich bleibt unberührt. Die Heilquelle An einem hellen, heißen Sommertag des Iahres 1936 traf ich sie im Speisesaal des Schwefelbads Sebastiansweiler. Draußen vor den Fenstern blühten rote Geranien und weiße Verbenen in fröhlichem Wechsel, über den Sandwegen brütete die Augustsonne. Im großen Speisesaal hatten sich die Gäste zwanglos an die Tische gesetzt, und muntere Landmädchen in Weißen Schürzen trugen mächtige Kaffeekannen herein, um einzuschenken. Wir waren soeben angekommen und stellten uns den Tischnachbarn vor; man unterhielt sich nach rechts und links, bis eine Stimme neben mir sagte: ››Ich bin auch von Cannstatt.<< Jetzt erst sah ich die Sprecherin an: eine Frau mittleren Alters von ansprechendern Wesen. Dunkles Haar und dunkle Augen hatte sie, und diese Augen waren ernst und gütig. Das blaue Kleid stand ihr, alles an ihr hatte eine Art; man sah, daß sie aus gutem Hause kam. Sie hatte den Namen genannt, den sie als verheiratete Frau führte. Sie erzählte, daß sie als Kind in unserer Stadt gewohnt habe, dann aber fortgezogen sei. Damals, als kleines Mädchen, habe sie in der Königstraße gewohnt. In dieser Straße, durch die mich jahrelang mein Schulweg führte, kannte ich jedes Haus. Ich fragte deshalb, in welchem Haus sie gewohnt habe, und als sie irgend eine Nummer nannte, sagte ich, ich sei in der Königstraße in die Strickschule gegangen, ins >›Stricketle<<, wie man diese Kinderschule damals nannte. Da horchte sie auf. »Das ist ja gerade das Haus, in dem wir gewohnt haben<<, rief sie, lebhaft geworden, >› eine Treppe hochl« O ich erinnerte mich, nur zu deutlich erinnerte ich mich an die Familie im ersten Stock dieses schönen Hauses mit dem großen Balkon. An sonnigen Tagen hatte ich oft eine stattliche jüdische Frau ... |
 |
Erwin Bosler Zu beidem bereit Aus dem Heldenleben des Waldenser Führers Henri Arnaud Franz, 1967, 28 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 27 Leseprobe Erst die einbrechende Dunkelheit hatte dem Kampfeslärm ein Ende gemacht. Nun breitete sich die Stille der Nacht über das Schlachtfeld um das kleine Städtlein La Tour. Eine Schar heldenmütiger Waldenser hatte versucht, in verwegenem Sturm die Stadtmauern des von Franzosen verteidigten Orts zu nehmen und hatten sich in dem mörderischen Kugelregen der wohlverschanzten Übermacht verblutet. Da und dort hörte man nodi ein Todesröcheln, bis auch diese letzten Zeichen von Leben verstummten. Was bewegt sidi da so lautlos wie ein Raubtier durch die Haufen der Gefallenen? -- Ein junger Mensch so ungefähr mit vierzehn Jahren ist's. Langsam kriecht er von einem der Gefallenen zum andern, wie wenn er etwas suchen wollte. Endlich, nach langer Zeit, scheint er sein Ziel erreicht zu haben. Trotz des Dunkels der Nacht haben seine geschärften Sinne die im Tod gebrochenen Züge seines Vaters erkannt. Schon ist in der Seele des jungen Menschen der Entschlulß gereift: Der ihm so teure Leichnam darf nicht der Grausamkeit des rachsüchtigen Feindes preis gegeben bleiben. Mit übermenschlicher Anstrengung schleppte der Halbwüchsige den schweren Körper seines Vaters auf die Seite. Dort im feuchten Sand des voriiberraiischenden Bergbachs brachte er es fertig, in kurzer Zeit eine kleine Grube auszuheben. Dort wird der Leichnam vor der Grausamkeit einer entmenschten Soldateska sicher sein. Als der Morgen dämmerte, ist das sdiwere Werk vollbracht. Der Junge, der im Morgengrauen davoneilt, um seiner Mutter die furchtbare Nachricht zu ... |
 |
Hannah Müller Die Sache mit der Wurst Franz, 1961, 20 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 29 Beispielseite |
 |
Erwin Bosler Menschenfreund Gregory Ein Jüngerleben im 20. Jahrhundert Franz, 1964, 26 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 34 Díe Vorfahren In Gregorys Adern floß altes Hugenottenblut. Seine Urahnen zählten zu jenen unbeugsamen Kämpfern, die in blutigem Ringen das Banner des Evangeliums in Frankreich hochhielten. In diesen Familien galt es als ungeschriebenes Gesetz, alles für den Glauben zu opfern. Auch als die äußere Macht ihrer Partei gebrochen war, gliihte das Feuer des Glaubenslebens unter der Decke verborgen weiter mit der Bereitschaft, wenn nötig, auch im fremden Land für den Glauben zu kämpfen. Darum besann sich der junge Offizier René Gregoire nicht lange, als der feurige Lafayette Freiwillige für den Unabhängigkeitskampf der Nordamerikaner anwarb. Diese Aufgabe mußte ihm edler erscheinen als der Dienst für die verkommene Bourbonendynastie. So fuhr er mit anderen jungen Franzosen über den Ozean und focht mit Auszeichnung unter den Fahnen Washingtons bis zur Erringung des Siegs. Während aber seine Kameraden nach dem Waffenstillstand wieder in die Heimat zurückkehrten, gefiel es dem Hugenotten -so gut in der neuen Welt, daß er sich ein großes Gut auf der Insel San Domingo erwarb. Er fand ein treues Weib, und als ihm ein Knäblein geboren wurde, fühlte er sich auf dem Gipfel des Glücks. Aber jäh brach die Katastrophe herein. Auf der üppig fruchtbaren Insel flammte ein Sklavenaufstand auf. Die Aufrührer stürmten das Haus und mordeten den Besitzer. Ein Wunder war es, daß die schwache Frau sich und ihr Kind vor der mordgierigen Bande retten konnte. Sie gab den vaterlosen Knaben in die Hände eines Schiffskapitäns, um ihn aus dem unruhigen Land fortzubringen. Das Leben als Schiffsjunge war fiir den kleinen Burschen eine harte Schule, aber er bestand die Probe. Das Meer wurde ihm so vertraut, daß er ihm treu blieb bis zum Lebensende. lm Lauf der Jahre gelang es ihm, sich vom armen Schiffsjungen bis zum selbständigen Kapitän emporzuarbeiten ... |
 |
Julius Roessle Philipp Matthäus Hahn Gottesgelehrter und Erfinder Franz, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 35 Die Welt, die ihn angestaunt hatte, vergaß ihn. Später haben die Uhrmacher sich daran erinnert, daß seine Erfindungen dazu beigetragen haben. Deutschland von der englischen und französischen Überlegenheit, die nach den dreißig Kriegsjahren eingetreten, zu befreien. Sie begannen ihn zu ehren. Die »Stillen im Lande« aber bewahrten in einer Ecke der Stube den »Fingerzeig zum Verstand des Königreiches Gottes und Christi.<< Theodor Heuß Viele kennen heute Philipp Matthäus Hahn, der zu den Schwabenvätern gezählt wird, nicht mehr. Sie haben Wohl schon von Michael Hahn, dem Begründer der Hahnschen Gemeinschaften gehört, auch der Name des Professors und Märtyrers Traugott Hahn ist ihnen bekannt; aber sie sind überrascht, wenn man ihnen von Pfarrer Hahn erzählt, der ein ehemals vielgelesenes Predigtbuch geschrieben und eine astronomische ››Weltmaschin-e<< konstruiert hat, die im Germanischen Museum in Nürnberg steht. Sie sind vollends erstaunt, wenn man ihnen sagt, daß die heute auf der Schwäbischen Alb, hauptsächlich in Onstmettingen und Ehingen verbreitete Feinmechanik mannigfachen Anregungen Hahns ihre Entstehung verdankt. Ein Junge sucht seinen Weg Philipp Matthäus Hahn entstammt -einem schwäbischen Pfarrhaus. Am 25. November 1739 kam er in Scharnhausen auf den Fildern zur Welt. Als vierjähriges Kind wurde er von seinem Großvater bereits in die Anfangsgründe der lateinischen Sprache eingeführt. Bald kam auch das Studium der griechischen und hebräischen Sprache hinzu. Wir können uns heute kaum noch vorstellen, daß man ein Kind so früh mit drei schweren Fremdsprachen bekannt machte. Die Eltern taten wenig für die Pflege des Innenlebens ihres Kindes. Hahn klagt später einmal, daß in seinem Elternhaus »nicht einmal -ein gewöhnliches Morgen- und Abendgebet und keine elterliche Unterweisung zur Gottesfurcht« üblich gewesen sei. Um so dankharer erinnerte er sich seiner Tante, die mit ihm betete und ihn in den Reichtum... |
 |
Anna Katterfeld Der Kreuzwirt Aus dem Leben von Martin Boos, dem katholischen Priester und Zeugen des Evangeliums Franz, 1964, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 36 Bei der Klausnerin Auf den Winterwegen des schwäbischen Allgäus wanderte ein junger Kaplan. Es war schwer, sich durch den tiefen Schnee hindurchzuarbeiten. Trotz der Kälte kam er bei dem steilen Anstieg in Schweiß. An einem Kreuzwege blieb er stehen. Er holte tief Atem und wischte die Stirn. Dabei warf er einen Blick auf ein Häuschen, das wohl eine Viertelstunde weiter oben in einer Bergspalte lag. »Die Klausnerin solltest wohl auch besuchen«, sagte er zu sich; ››'s ist nimmer lang, daß sie es noch macht, hat der Doktor neulich gesagt, und 's ist eine von denen, die immer offen sind für geistlichen Zuspruch. Doch es ist bereits spät<<, fügte er in seinem Selbstgespräch hinzu und blickte nach dem Himmel; »fast eine Stund' nimmt der Weg mit dem Besuch immerhin, und der Alpbauer wartet. Solltest Dich nimmer aufhalten.<< Br schickte sich an, weiterzugehen; aber recht wohl war's ihm nicht dabei. Ein Ausdruck der Unruhe trat in sein feines Gesicht. ››Wenn's mit der Klausn-erin nun doch schlechter stehen sollte? Ist's recht, daß du vorüber gehst?<< murmelte er. Ein paar Schritte war er noch durch den Schnee gestapft, da sah er, wie die Tür des Häuschens oben geöffnet wurde und ein junges Mädchen über die Schwelle trat. Kaum hatte sie den Kaplan erkannt, als sie den Pfad hinuntersprang, der durch den Schnee führte. Leichtfüßig setzte sie über die Schneewehen und stand in wenigen Minuten vor dem Kaplan, der ihr ein Stück entgegengekommen war. »Euch schickt Gott, geistlicher Herr<<, sagte das Mädchen und küßte ihm mit einem Knix die Hand; ››der Mutter hat's grad' heut' so sehr um geistlichen Trost gebangt.<< |
 |
Anna Katterfeld Der Reiseengel Erlebtes von Anna Katterfeld Franz, 1968, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 37 Wir können nicht anders, als dafiir dankbar sein, daß Gottes Wort uns den Blick hinter den Vorhang in die Unsichtbarkeit schenkt und uns gewiß macht: wir sind umgeben von den Boten Gottes, den ››dienstbaren Geistern, die ausgesandt sind zum Dienst um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit«. Wie fest unser Herr und die Apostel mit der Tatsädilichkeit der Engelwelt rechneten, diirfen wir auch schon daraus ersehen, daß im Neuen Testament die Engel etwa hundertundzwanzigmal erwähnt sind, und auch im Alten Testament tritt uns ihr Dienst und ihr Auftrag immer wieder entgegen. Wie mannigfaltig ist dieser Auftrag! Vom Engel des Gerichts an, der mit bloßem Schwert vor der Pforte des Paradieses steht, aus dem die in Sünde gefallenen Menschen vertrieben wurden, bis zu dem Engel und seinen Scharen, die zu Weihnachten die große Freude verkünden, daß der Heiland geboren ist, der das Paradies wieder geöffnet hat, wird Gottes Volk wohl in allen Lebenslagen vom Dienst der Engel umgeben. Unter all diesen Diensten will es mir scheinen, daß das Geleiten und Bewahren auf der Reise ein besonders häufiger Auftrag an die Engelwelt sei. ››Der Herr hat seinen Engeln befohlen über dir, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen<<, heißt es im 91. Psalm. Wie läßt sich dieses »Behüten auf den Wegen« durch die ganze Bibel verfolgen! Auf seiner gefahrvollen Heimreise unter der Bedrohung von Esaus Rache begegnen Iakob ›>die Heere Gottes« bei Mahanaim. Gottes Engel zieht vor Israel auf seiner Wiístenwanderung her. Petrus wird durch einen Engel aus dem Gefängnis geführt; Paulus erhält während des Schiffbruchs auf der Reise nach Rom durch Engelsmund die Zusicherung... |
 |
Friedrich Baun Der Hansmartin von Mägerkingen (Johann Martin Mader) Vom Wirt zum Gemeinschaftsleiter Franz, 1973, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 38 Unser Hansmartin oder, wie sein eigentlicher Name lautet, Johann Martin Mader, wurde am 5. November 1804 als der jüngste Sohn des Hirschwirts Johann Adam Mader in Mägerkingen geboren. Der Vater betrieb in dem auf der südwestlichen Alb in einer württembergischen Exklave mitten in hohenzollerisdiem Gebiet gelegenen Pfarrdorf neben seiner Wirtschaft und Bierbrauerei eine ausgedehnte Landwirtschaft. Zwölf Kinder belebten allmählich das Haus, von denen acht ein höheres Lebensalter erreichten. Als das jüngste war Hansmarte der ausgesprochene Liebling des Vaters. Hansmartin wurde ein frischer, fröhlicher Bursche, der sich seiner Jugend auch freuen wollte. Wenn er auch zuweilen die Versammlung der Pregizerianer im Dorf besuchte, so war er doch weit davon entfernt, seinen Weg als Iüngling unsträflich zu gehen. Das zeigte sich bei einer Schlägerei in dem benachbarten Dorf Hausen, an der auch er beteiligt war. Als ihn der »Fleckenschütz<<, der ihn abgefaßt hatte, dem Schultheißen vorführen wollte, nahm der bärenstarke junge Mann den Hüter des Gesetzes kurzerhand am Schlafittchen, warf ihn auf einen Misthaufen und lief davon. Dem Gefängnis vermochte er sich dadurch freilich nicht zu entziehen. Der Vater starb, als Hansmartin erst sechzehn Iahre alt war. Zuvor hatte er noch seinen zwei jüngsten Söhnen ein stattliches Haus gebaut, das so eingerichtet war, daß Hansmartins Anteil Raum für eine Wirtschaft bot. Als dieser einige Jahre später Haus und Feld in eigene Bewirtschaftung iíbernommen hatte, zeigte sich bald das Bedürfnis nach einer Gehilfin für ihn. An Anträgen fehlte es nicht; sie waren aber alle nicht nach seinem Sinn, weil seine Freunde mehr auf das Vermögen als auf die Person der künftigen Gattin sahen. Wenn er sich dann überreden ließ, auf die ››Schau« zu gehen, dann kam er ... |
 |
Hannah Müller Adelheid - kleines Lebensstück Eine Konfirmandenerzählung Franz, 1968, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 39 >>Nach der Konfirmation möchte ich gleich fort<<, sagte Adelheid und schaute zum Fenster hinaus, wo die Weiden silbrige Blätter im Winde bewegten. ››Was sagst du? Wohin? Warum?<< Die Mutter steckte mit beiden Armen in der riesigen Backschüssel. Mit hochrotem Kopf hantierte sie nahe dem Herd und schlug mit dem Holzlöffel den Hefeteig, bis er Blasen zeigte. Sie hielt schnaufend und schwitzend inne. ››Was redest du für Unsinn? Laß nur erst einmal die Konfirmation vorbei sein!-<< Adelheid, mit dem trotzigen Schwung der Lippen und den träumerischen Augen der Fünfzehnjährigen, sagte es noch einmal: »Gleich nach der Konfirmation möchte ich fort. Es geht ganz leicht.<< »Es geht ganz leichte, wiederholte ratlos die Mutter und setzte hinzu: »Du machst mich krank, Kind. Du siehst, ich habe keine Zeit. In drei Tagen ist deine Konfirmation. Putzen, backen; du mußt noch zum Friseur . . .<< ››Zum Friseur will ich nicht<<, hakte Adelheid ein, ››das heißt, ich will schon, aber ich mag keine Dauerwelle. Jetzt trägt man die Haare glatt, und dort, wo ich hin Will, sind Zöpfe modern« »Wohin willst du denn uin alles in der Welt?<< fragte die Mutter. »Wir sind doch so froh, daß wir dich aus der Schule haben, daß du endlich, endlich so weit bist, uns zu helfen -- und jetzt willst du fort! Sag, Wohin?<< »Irgendwohin, in eine Stelle, auf eine Schule, ganz gleich wohin.<< Die Mutter atmete auf. So hatte das Kind noch keinen bestimmten Plan. Zu all diesen Dingen war sie noch zu jung. ››Ich bin gut ein Jahr älter als die anderen Konfirmanden. Bin doch später in die Schule gekommen wegen des Beinbruchs damals«, sagte Adelheid... |
 |
Julius Roessle Friedrich Christoph Oetinger der Theosoph des Schwabenlandes Franz, 1969, 32 Seiten, geheftet 2,60 EUR |
Goldregen Heft
43 Unter den Theologen seiner Zeit nimmt Friedrich Christop Oetinger eine Sonderstellung ein. Wiewohl er mit Johann Albrecht Bengel jahrelang in Verbindung stand, gehört er doch nicht zu seinem engeren Schülerkreis. Er war ein Mann eigenster Prägung. Seine Theologie war ihm »Erkenntnis der Wahrheit zur Gottseligkeit«. Der Gedanke an Gott und der Bezug des ganzen Lebens auf Gott ist der goldene Faden, der sein Leben durchzieht von den Tagen der Kindheit bis ins Alter. Dem heutigen Menschen ist seine Theologie, in der sich kabbalistische, mystische, theosophische, alchimistische und andere Gedankengänge mit einer großen Schau der Bibel mischen, weithin schwer zugänglich. Auch sein Lebensweg unterscheidet sich merklich von dem des stillen und zurückhaltenden Bengel. |
 |
Käthe Koch Ein Leben auf Gottes Straße Franz, 1974, 32 Seiten, 50, geheftet, 12,5 x 19 cm 3-7722-0109-1 2,60 EUR |
Goldregen Heft 44 So begann mein Leben An einem Februartag kam ich zur Welt. Es war in Effringen, einem kleinen Dorf droben irn Schwarzwald. Meine Eltern waren bescheidene Bauersleute. Der Vater ging auswärts zur Arbeit, am Abend schaffte er in der kleinen Landwirtschaft die schweren Arbeiten, die meine Mutter den Tag über nicht bewältigen konnte. Ein mühsames Leben, das diese Menschen oft hart und manchmal auch bitter machte. Ein Büblein war meinen Eltern schon vor mir geboren worden. So wartete meine Mutter sehnlich auf ein Mädchen, das ihr in etlichen Jahren auch im Haushalt tüchtig zur Hand gehen könnte. Aber der Mensch denkt - und Gott lenkt. Es kam ganz anders. Ich kam hilflos und elend zur Welt, kaum als ein menschliches Wesen zu erkennen, ein zusammengerolltes Etwas. Meine Fersen lagen in den Handhöhlen, Füßchen und Händchen wie leblos, viel zu schwach, um sich zu bewegen oder gar zu strampeln. So erzählte mir meine Mutter später. Doch war rasch ein Arzt zuhand, der mich wenigstens so weit zurecht richtete, daß ich ausgestreckt in das bereitgestellte Körbchen gelegt werden konnte. Ich war also das, was andere verächtlich oder mitleidig eine Mißgeburt nannten. Meine Eltern riefen sofort den Pfarrer und ließen mich taufen. Sie hatten keine Hoffnung, daß ich am Leben bliebe. Und doch geschah es. So sehr dies fiir meine Eltern und Anverwandten Freude und Wunder war, manchmal mögen sie doch niedergeschlagen vor meinem Bettchen gestanden und nach dem Sinn meines Lebens gefragt haben. Mein Vater war ein Mann der Tat. Er sah, daß ich lebte und also auch am Leben bleiben mußte. Ich wurde in die Klinik eines nahen Städtchens gebracht. Aber dort riet man meinen Eltern, mich wieder mitzunehmen und nicht vor zwei Iahren wiederzukommen. Jede frühere Behandlung sei zwecklos. Gute Freunde und getreue Nachbarn sprachen meinen Eltern von diesem und jenem. Quacksalber und Wahrsager wurden empfohlen. Einer tauchte auch einmal auf und gab den trefflichen Rat,'m-an solle meine Armchen und Füßchen jeden Abend rnit Speichel einreiben. Aber am Ende blieb nichts, als eine große Ratlosigkeit aller, die mich sahen. Mein Vater hielt das nicht aus. Er brachte in der Landeshauptstadt eine Klinik in Erfahrung, in der mir anscheinend geholfen werden konnte. Aber die Reise ... |
 |
Gotthilf Trautmann Das Regele von Sommenhardt Wiedergegeben nach eigenen Erzählungen Franz, 1964, 28 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 45 Beispielseite |
 |
Hannah Müller samt allen Kreaturen Tiergeschichten Franz, 1961, 24 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 47 Leseprobe DER BIBELHUND Der kleine und der große Bauernhof lagen am Dorfende. Pebruarwind wehte föhnig über die Dächer. Der geschmolzene Schnee rutschte ab und schlug hart vor den Fenstern herunter. Die Bäuerin schaute flüchtig hinaus. Vor vierzehn Tagen war ihr Mann eingezogen worden; aber er war in die Stadt gekommen, das Wetter tat ihm nichts, weniger als daheim. Da wäre er heute im W'ald beim Holz gewesen. Übrigens würde der Krieg nimmer lange dauern. Sie glaubte fest an dieses Gerücht, es lief so heimlich von Mund zu Mund. Der Bauer war eines Herzfehlers wegen so spät geholt worden. Es riß ihn deshalb auch nicht weiter als bis zum Stacheldraht eines Gefangenenlagers. Dort ging er auf und ab, das Gewehr über der Schulter, mit endloser Zeit, die daheim seinem \/Veibe fehlte. Er dachte an sie und an sein Kind, an seinen Sohn, nach sechsjähriger Ehe ihm vor zehn Wochen geboren, und daß er die beiden zurückgelassen in der Einsamkeit des Dorfrandes. Der Knecht, taub und arbeitsverkrampft, das Flüchtlingsmädchen, scheu und mit seltsamen Lauten sprechend. wohnten mit auf dem Hofe, aber die beiden boten Weder Schutz noch Gesellschaft für die junge Mutter und ihr Kind. So hatte er den Hund gekauft, einen schwarzgelben starken Schäferhund, ein noch junges Tier. Als der Hundezüchter ihn brachte, an einem zerfaserten Strick, und das Lederhalsband ließ er sich Wieder zurückgeben, da knurrte der Hund den Bauern an; aber der Frau stieß er die Schnauze in die hängende bloße Hand, so daß sie erschrak, sich aber sofort niederbeugte und ihre Finger zwischen die Weichen Hundeohren gab und dort liegen ließ. Der Hund hielt still, und der weißbärtige schmutzige Züchter schinunzelte= »Es ist ein Rüde, der geht zur Frau.<< Das war dem Bauern recht. Er wollte einen Hund, der jeden Mann ansprang, sei es Bettler, Bauer oder Soldat.Nachbar, Freund oder Feind. Also Wurden sie handelseinig.... |
 |
Rainer List Unverzagt und ohne Grauen Das Leben Johann Jakob Mosers nach alten Quellen neu erzählt von Rainer List Franz, 1969, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 48 Johann Jakob Moser wurde am 18. Januar 1701 in Stuttgart geboren, wo sein Vater als Expeditionsrat in der Verwaltung tätig war. Schon im heranwachsenden Knaben zeigten sich große geistige Fähigkeiten; schnell und begierig nahm er alles auf, was an ihn herangetragen wurde. Sein Vater hatte wohl den Wunsch, die Begabung seines Sohnes zu fördern, doch fehlte ihm die Zeit, ihn selbst anzuleiten und sein Lernen zu überwachen. So blieb Moser, wie er selbst später berichtete, ››meisterlos«; er lernte zwar vielerlei, aber nicht immer das, was er sollte. Einmal bat er den Vater inständig, er möchte ihm doch die alten Bücher kaufen, die ein Buchhändler zu einem Spottpreis anbot. Es waren zwölfhundert Bände, meist theologischen und philosophischen Inhalts, die der junge Moser nun eifrig durchlas. Mochte der Nutzen solcher Zufallslektüre auch gering sein, der Geist des Iünglings fand doch darin Nahrung, wodurch er vor unnützem oder schlimmerem Zeitvertreib bewahrt blieb. Auch seine Lehrer verstanden es nicht, die geistige Regsamkeit Mosers zu lenken. Im Gegenteil, der übersprudelnde Fleiß ihres Schülers verdroß sie. Der Rektor des Gymnasiums schalt ihn einen überlästigen Burschen, weil er ihm zu viel lateinische Arbeiten zur Durchsicht brachte, und einer seiner Präzeptoren, dem er auf einmal tausend lateinische Verse vorlegte, warf das Heft voller Unwillen zur Seite, wobei er sagte: ››Narr, meinst du, ich habe meine Besoldung allein für dich? Mehr als dem Vater, den er im Jahre 1717 verlor, scheint Moser seiner Mutter verbunden gewesen zu sein. Sie war eine für die damalige Zeit weitgereiste Frau, kenntnisreich, gütig und von großer Bescheidenheit. Eines Morgens erklärte sie ihrem Sohn, sie habe einen bedenklichen Traum gehabt, Wonach er in großer Lebensgefahr stehe; er dürfe deshalb heute nicht ausgehen. Nun wurden an diesem Tag vom obersten Boden des Hauses gefüllte ... |
 |
Hannah Müller Das Konfirmandenkleid Kurzgeschichten Franz, 1962, 28 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 49 1 Das Konfirmandenkleid Christa ging vom Konfirmandenunterricht heim in das elende Häuslein des Hinterhofes. An der Tür klebte ein Zettel: Otruski.Das hatte Mutter geschrieben. Nebenan hing auch ein Papier: Littner. Das waren die Blinden. Sonst wohnte niemand in dieser Notunterkunft ohne elektrisches Licht und ohne Wasseranschluß. In der Hofecke tröpfelte der Brunnen. Christa holte den Schlüssel aus dem Versteck. Mutter arbeitete in einem feinen Blumengeschäft. Ietzt vor den Pesttagen mußte sie Überstunden machen. Sie hatte keinen Mann, das Mädchen keinen Vater. Christa legte ihr Heft vor sich auf den Tisch. Aus den Aufschreibungen des Konfirmandenunterrichts leuchtete rot unterstrichen heraus: Du sollst deinen Nächsten lieben. Ietzt sollten sie sich daheim besinnen, wer diese Nächsten waren. Christa wußte sofort: Die Mutter. Klar, das gehörte sich so, und es stimmte auch. Nur gerade heute. . . Christa seufzte. Heute früh hatte es Streit gegeben. Christa zog ihre Beine unter dem Tisch hervor und betrachtete sie genau, zwei gerade, dünne, lange Mädchenbeine, die in grünen Strürnpfen steckten; an den Füßen prangten die neuen hellbraunen Sportschuhe. Soweit war alles in Ordnung. Aber statt mit dem blauen, vertragenen Kleidchen sollte es mit dem karrierten Wollrock und flottem Pulli weitergehen. Mutter hatte diese Dinge glatt verweigert, abgestrichen, kein Wort mehr davon. Und Christa wußte, Mutter hatte recht; das Kleid zur Konfirmation, schwarze Strümpfe, neue Wäsche, die waren nötiger. Das Mädchen starrte in ihr Heft. Du sollst deinen Nächsten lieben. Wen? Was sollte sie schreiben? Langsam, fast widerwillig, schob sie den Füllhalter über das Papier, schrieb: Die Mutter. Weiter. Wen noch? Sie kannte fast niemand in der Stadt, sie wohnten erst zehn Wochen hier.... |
 |
Friedrich Baun Der Glemsermarte (Martin Fauser) Ein schwäbischer Glaubensmann Franz, 1962, 36 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 50 Das Land auf und vor der mittleren Alb ist die Heimat eines urwüchsigen und kantigen Menschenschlags, in dem Charakterfestigkeit und Originalität besonders gut gedeiht. Hier hat auch der christliche Glaube tiefer als anderswo Wurzel geschlagen und Menschen geformt, die weit über ihren Wirkungskreis hinaus bekannt geworden sind und deren Andenken mit Recht immer noch lebendig ist. Es sei hier nur Hülben genannt, ein Dorf auf der Hochfläche der Alb, hart an der Bergkante gelegen, ein Segensort, von dem aus mehrere Generationen der Lehrersfamilie Krallen eine für das ganze Land und darüber hinaus bedeutsame Wirksamkeit entfaltet haben. Der Glemsermarte, von dem in diesen wenigen Blättern kurz erzählt werden soll, ist auch einer von denen, die sich oft in Hülben Rat und Stärkung holten, und in der Tat ist es dieser prächtige, aufrechte Mann wert, auch heute noch unvergessen zu bleiben. In einem versteckten Seítentälchen der Erms an die steile Bergwand der Hochalb geschmiegt, liegt das freundliche Kirschendörfchen Glems, das den bescheidenen Schauplatz für dieses bei aller Schlichtheit so merkwürdig anziehende Leben abgegeben hat. Hier ist Martin Fauser am 24. Iuli 1767 als Sohn eines Bauern und Wagners auf diese Welt gekommen und im Schoße einer gottesfürchtigen Familie aufgewachsen. Von den rechtschaffenen Eltern wurde er in der Sitte der Zeit streng gehalten. Das tat der gesunden Entfaltung des munteren Buben aber keinen Eintrag. Noch im hohen Alter sprach er nur in größter Ehrerbietung und Dankbarkeit von seinen wackeren Eltern. Eine fromme Kindsmagd und ein gläubiger Schulmeister mit Erfahrung in Glaubensdingen standen ihm am goldenen Morgen seines Lebens zur Seite und taten viel dazu, seine junge Seele auf das Göttliche zu lenken. Mit der Konfirmation kam fiir Martin eine neue Wegscheide heran. Ihm ward die Wahl nicht so schwer; er kehrte sich zum schmalen Weg, schloß sich der Versammlung seines Heimatorts an und besuchte an Sonn- und Feiertagen auch die der Umgegend.... |
 |
Friedrich Baun Der Karle von Beuren (Karl Buck) Ein Stiller im Land Franz, 1973, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 51 Am Fuß des I-Iohenneuffen, der gewaltigen Burgruine vor der Schwäbischen Alb, liegt das Dorf Beuren, eine einstmals noch kleine, heute aber stattliche Ortschaft. Obstbaumwiesen und wohlbestellte Felder umschließen das Dorf, und an den steilen Berghalden ziehen sich sonnige Weinberge hinauf. Zu den begiitertsten Bürgern der Gemeinde gehörte damals der Bauer Karl Buck, der Vater des Mannes, von dem dieses Büchlein erzählen soll. Es war ein rechtschaffener und kirchlich gesinnter Mann, der in seinem Hauswesen streng auf Zucht und Ordnung hielt und am Sonntag Vormittag regelmäßig mit seinen Kindern und seinem Gesinde den Gottesdienst besuchte. Nachmittags nach der Christenlehre wurde zu Hause eine Predigt gelesen, bei der auch keines fehlen durfte. Die Mutter, Marie Katharina geb. Nething, stammte aus einem Gemeinschaftshaus, erwachte aber erst später zu einem eigenen inneren Leben. Ursprünglich zum Geiz neigend, wurde sie je länger, je mehr sehr mitleidig und freigebig gegen alle Armen und Notleidenden. Im Hungerjahr 1817 traf sie, wenn sie vom Feld heimkehrte, fast immer arme Kinder an, die auf ihrer Staffel sitzend Brot von ihr erwarteten, und nie gingen sie leer aus. Eine Schwägerin, die Schwester des Vaters, sagte einmal vorwurfsvoll zu ihr: ››Horch, wie kannst du nur deine Laib' so freudig ausschneiden?« Darauf entgegnete sie: »Ich glaub', wenn ich den Armen einen Laib Brot ausschneide, so lauft ein Scheffel Korn die Bühnenstiege hinauf«. Ihr Mann ließ sie auch gewähren und sagte später nach ihrem Tod, daß er in seiner Landwirtschaft so viel Glück gehabt habe und zu etwas gekommen sei, verdanke er dem Segen seiner ersten Frau. Diesen wackeren- Leuten wurde am 21. September 1813 der erste und einzige Sohn geboren, der nach dem Vater Karl, oder wie man ihn sein Leben lang hieß, ››Karle« genannt wurde. ... |
 |
Dorothea Hollatz Das Antlitz hinter den Stäben 4 Erzählungen Franz, 1963, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 53 Das Antlitz hinter den Stäben Jeden Morgen auf dem Gang zur Arbeit kam Lehnert am Gefängnis vorbei; er dachte sich nichts dabei, denn er war es von jung an so gewohnt. Über der Mauer längs der Straße ragten zwei rote Baeksteingebäude hoch, am verschlossenen Doppelportal war die Tafel mit den Besuchszeiten angeschlagen. Aus dem unsichtbaren Hof drang kein Laut in die Welt der Freien. Als Marianne zum erstenmal mit ihrem Manne diesen Weg ging, hob sie den Blick zu den Fenstern, deren blinde Scheiben zum Teil zur Seite geschoben Waren und einen Ausguck freiließen. ››Wie gräßlich, daß man von dort aus auf die St.aße herunterschauen kann<<, sagte sie. ››Wieso?<< fragte der Mann. »Schaut jemand herab und wo denn?<< Marianne zog ihren Mann zwei Schritte zurück, wo die Ruine einer Hauswand ein Stück Gefängnismauer freigab, darin eingelassen zwei vergitterte Fenster. Und an einem dieser Fenster lehnte ein Kopf, ein Gesicht, ein Menschenantlitz. Marianne zeigte hinauf. ››Hab noch nie darauf geachtet«, lenkte Lehnert ab, »und ich bin ja auch bisher immer mit dem Rad gefahren« ››Und mir zuliebe willst du von nun an zu Fuß gehen?« fragte Marianne. ››Wenn es sich mit der Zeit irgend machen läßt, ja. Später, wenn das Motorrad da ist, kann ich dich mitnehmen, dann fahren wir zusammen« Diese Aussicht erschien sehr verlockend. Vorerst noch gingen sie zu Fuß, Morgen für Morgen, und immer lehnte an den Gitterstäben des linken Fensters das graue Gesicht ... |
 |
Friedrich Baun Schultheiß Klaß von Beuren Ein schwäbischer Gemeinschaftsmann Franz, 1964, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 54 Jugendjahre Die Schwäbische Alb mit ihrem Vorland ist schon seit langem ein Herd des württembergischen Gemeinschaftslebens. Den Mittelpunkt bildete das Schulhaus in Hülben, wo über zwei Jahrhunderte lang die Familie Kullen saß, die eine Reihe geschätzter christlicher Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Auch verschiedene hervorragende Pfarrer aus der Bengelschen Schule haben in der weiteren Umgegend von Hülben gewirkt und den Samen des lebendigen Wortes Gottes mit sichtbarem Segen ausgestreut, so Fricker in Dettingen (1762--66), Brastberger in Nürtingen (1756-64], Eytel in Neckartenzlingen (1785-88), und Hartirmmn in Neuffen (1795-1803]. Deshalb finden wir um den Neuffen her eine Reihe alter und blühender Gemeinschaften, und hier am Fuße der Alb wurde besonders Beuren, ein stattliches Dorf von etwa 1200 Einwohnern, eine Pflegestätte brüderlicher Erbauung und durch seine Monatsstunden ein Samrnelpunkt der Stillen im Lande. Zwei weithin bekannte und geachtete Brüder treten uns hier im vorigen Iahrhundert entgegen, der Weingärtner Karl Buck* und Schultheiß Jakob Klaß, dessen Leben hier erzählt werden soll. Jakob Klaß wurde geboren am 15. März 1822 als der fünfte Sohn unter acht Kindern des Ioharm Martin Klaß, Weber in Beuren, und seiner Ehegattin Veronika geb. Buck (einer nahen Verwandten des vorhin erwähnten Karl Buck). Die Mutter war eine sehr fromme Frau, eine unablässige Beterín, die oftmals auch mit ihrem kleinen Sohn betete. Das machte den tiefsten Eindruck auf ihn und schloß sein Herz frühzeitig für die göttliche Wahrheit auf; denn die Kindesseele ist wie ein weiches Wachs, das mit leichter Hand geformt werden kann, wenn es nur mit der nötigen Weisheit geschieht. Freilich, welcher Erzieher madit nicht auch seine Fehler? So hat die energische Mutter .... * Siehe ››Der Karle von Beuren«, Verlag Ernst Franz, Metzingen [Goldregenheft Nr. 51] |
 |
Rainer List Freiheit in Gottes Hand Paul Schneider 1897 - 1939 Franz, 1964, 30 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 55 Ein junger Theologe, kurz vor seinem ersten Examen, notiert im Frühjahr 1922 in sein Tagebuch: ››Kann mir Gott nicht Kraft geben, so viel er will, so viel ich bedarf, und jedes vernünftige Maß über den Haufen werfen? So bleibt mir also nur, mein Leben ganz auf Gott, den Übervernünftigen und Wunderbaren, Allmächtigen und Grundgütigen zu legen. Von ihm will ich mir sagen lassen, was ich zu tun, wie ich zu leben habe, und auf alle eigenen Maßstäbe verzichten. Herr Gott, zeige du mir mein Ziel, das Ziel meines Lebens und meiner Arbeit!« Ahnungsvoll hat Paul Schneider in diesen Worten die Grundlinie seines eigenen Lebens aufgezeichnet. Als Sohn eines Pfarrers wurde Paul Schneider am 29. August 1897 in Pferdsfeld, Kreis Kreuznach, geboren. Sein Vater war mutterlos herangewachsen und vielleicht daher von herber, ernster Strenge. Die Mutter dagegen, zeitweise als Erzieherin in einem Waisenhaus tätig, war großzügig, fröhlich und herzensfromm. Dabei war ihr selbst kein leichtes Los beschieden: ihre beiden ersten Kinder wurden tot geboren, sie selbst litt an unheilbarer Gicht und war in ihren letzten Lebensjahren fast völlig gelähmt. Trotz dieser Krankheit schenkte sie noch drei Söhnen das Leben. Paul war ihr viertes Kind. 1915, ein Jahr nach dem Tod der Mutter, legte er in Gießen sein Notabitur ab und entschloß sich, Medizin zu studieren. Der Kriegsdienst trat dazwischen, Paul wurde verwundet und später zum Leutnant bei der Artillerie befördert. Nach dem Krieg erkannte er klar, daß er nicht zum Arzt, sondern zum Pfarrer berufen sei. Zunächst wandte er sich mit großer Entschiedenheit dem Studium der Theologie zu; doch beschäftigten ihn gleichzeitig die in der Luft liegenden großen Themen Sozialismus und Bolschewismus. Er wollte Theologie nicht als neutrale Wissenschaft studieren; seine Theologie zielte unmittelbar auf das Leben der Gegenwart. Kein Wunder, daß der Student umgetrieben wurde: er studierte in Gießen, Marburg und Tübingen, er nahm rege ... |
 |
Hildegard Schlunk Die Sybille Franz, 1964, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 56 Rose von Jericho ››Schwesterlein<< hast du mich genannt. Aber das war erst in der letzten Zeit. Vorher hattest du einen .anderen Namen für mich, oder keinen. Ia, ich glaube, daß du dich scheutest, mich mit dem Namen anzureden. Vielleicht hast du dich sogar manchesmal vor mir gefürchtet. Ich - um es gleich zu sagen, hatte Angst vor dir. Nicht eigentlich vor dir, sondern Angst, dir wehe zu tun. Jedes Wort, das ich sagte, konnte dich zeitweise verletzen. Wenn ich mich erinnern soll an die Stunde, da ich dich kennenlernte, so finde ich sie nicht. Vor deinem Gesicht war ein anderes Gesicht - das deiner Schwester. Ihr hattet Kindheit und Iugend zusammen verbracht, und als sie heiratete, zogst du mit in den Haushalt, da sie noch als Lehrerin tätig blieb. Deine Schwester hatte ein Schicksal, und du, wie du glaubtest, keins. Sie hatte Mann und Kind gehabt, und dir war als Mitgift ins Leben nur ein Gebrechen geschenkt worden. Was sage ich da? Dir war die verwachsene Gestalt mit dem verkürzten Fuß wie ein Fluch, und deine Seele hatte aus diesem Umstand die frühe Bitterkeit gesogen, die dich glauben machte, du habest ein anderes Gesetz als sie, die Glückliche. Zwar, als ich deine Schwester zum ersten Mal sah, war auch sie schon vom Leid gezeichnet. Mann und Kind hatte sie in den Tod geben müssen, Heimat war ihr genommen, und ihr Körper war schon ausgeliefert an ein schleichendes Leiden: Glied um Glied würde der Leib seine Kraft eínbüßen und daß ihr Geist klar und die Seele unter solchem Vergehen standhaft bleiben möge, muß ihr einziges Gebet gewesen sein. Ihr Gesicht aber schien unbetroífen von Krankheit und Verfall. In ihm hatten sich die Kräfte eines erfüllten Lebens gesammelt, nun gab es Zeugnis von. d-em Geist, der dieses Leben geformt hatte. Ich stand damals in der Mitte meines Lebens und glaubte viel erlitten und erfahren zu haben. Vor der Klarheit dieses Gesicht es wurde mir bewußt, daß ich mich an solcher Reife noch nicht messen konnte... |
 |
Helmut Ludwig Ärger mit dem neunten Namen Erzählungen Franz, 1965, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 57 Ärgrr mit dem neunten Namen Es beginnt mit einem Skandal in einer kleinen Universitätsstadt. Da ist der junge Bildhauer. Er sagt ganz einfach und unmißverständlich: Und ich werde seinen Namen nicht austilgen! Da ist der Direktor des städtischen Gymnasiums. Er kann die Eigenmäditigkeit des Bildhauers nicht verstehen. Wie könnte er auch? Er kennt die Vorgeschichte nicht. Da ist das Lehrerkollegium des Gymnasiums. Sie stehen alle zur Meinung ihres Direktors. Wir verstehen das ganz gut, bald. Aber der Bildhauer bleibt bei seinem Ausspruch. Da ist der alte Freund jenes Lehrers, der die Hauptperson unserer Handlung darstellt, ohne daß er es je gewußt hat. Und da ist endlich er selbst, der unscheinbare Studienrat, der von seinen Sdtülern verkannt wurde. Sie ließen ihren Übermut an ihm aus. Sie wollten nicht wissen, daß er ein empfindsamer Mensch sei, daß sie ihm weh taten. Sie ahnten nicht, daß er einmal die Stadt retten würde. Eines Tages erscheint der Direktor des städtischen Gymnasiums in der Werkstatt des jungen Bildhauers. Der alte Herr zieht die Brille aus dem Futteral und betrachtet die Büsten, die Gipsabdrücke, die vielen fertigen und halbfertigen Grabsteine und beginnt, sein Anliegen vorzubringen, ein wenig umständlich und weit ausholend, aber wohl wissend, worauf er hinaus will. Er ist noch ganz derselbe geblieben, fährt es dem jungen Künstler durch den Kopf. Noch immer so wie damals, als ich vor ihm auf der Schulbank saß. Und es sind doch schon viele Iahre vorübergegangen. Die Zeit ist heute ganz anders geworden. Der Direktor erklärt dem Bildhauer, wie es zu dem Beschluß kam, erzählt von den Vorbereitungen: »Und so haben wir beschlossen... |
 |
Annemarie Siebenbrodt Stunde der Entscheidung Kurzgeschichten Franz, 1965, 28 Seiten, 50, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 58 Stunde der Entscheidung Die sanfte Stille eines Sommerabends senkte sich über das große Krankenhaus. Die weiten Korridore, die tagsüber von vielen unruhigen Schritten und dem Rollen der Krankenwagen widerhallten, waren menschenleer. Auch in der Privatstation des Professors war der Abend eingekehrt. Die Patientinnen lagen bei weit geöffneten Fenstern in ihren Betten oder saßen noch ein wenig auf dem Balkon, um die milde Dämmerstunde zu genießen. Maria Helmreich nahm ihre Wasserkaraffe und goß die Blumen auf dem Balkon vor ihrem Fenster. ››Als ich kam, wurden sie eingepflanzt, jetzt stehen sie in voller Blüte, und wie bald kommt das Verblühen und Vergehen<<, dachte sie. ››Bin ich wirklich schon zehn Wochen lang hier? Wieviel habe ich erlebt in dieser Zeit an eigenein Leid, und wieviel Einblicke habe ich genommen in die Schicksale Anderer. Und nun soll ich wieder hinaustreten in das Leben, das vor mir liegt wie ein Berg, den ich mit meinen schwachen Kräften nicht ersteigen kann.« Maria Helmreich setzte sich auf einen Korbsessel an die offene Balkontür und blickte verloren auf ihre kraftlosen Hände. Sie hatte eine schwere Operation hinter sich und sollte im Lauf der nächsten Woche aus dem Krankenhaus entlassen werden. Plötzlich stand Schwester Ursula im Reisekostiim hinter ihr. Sie hatte das Klopfen iiberhört. »Ich möchte mich verabschieden<<, sagte die junge Schwester. Unruhig gingen ihre Augen hin und her und vermieden es, Maria anzusehen. »Heute schon? Das hätte ich nicht gedacht. - Sie werden mir sehr fehlen. Wollen Sie sich nicht wenigstens ein paar Minuten zu mir setzen? ... |
 |
Christian Gollmer Ein Soldatenleben in Krieg und Frieden erzählt von Christian Gollmer Franz, 1965, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 59 Wer den ››Eberle von Zell« * gelesen hat, der erinnert sich sicherlich noch der Gollmersbuben von Oberlenningen, die dort erwähnt werden und von denen der älteste, der Christian, als württembergischer Festungsartillerist den Siebzigerkrieg mitgemacht hat. Dieser Christian Gollmer, von Beruf Schneider und ein Glaubensmann wie sein Freund und geistlicher Berater, der Eberle, hat Aufzeichnungen aus seiner Soldatenzeit hinterlassen, die auch heute noch lesenswert sind. Deshalb soll er uns auf den folgenden Seiten ein wenig von seinen Erlebnissen und Erfahrungen berichten, die für manchen jungen Streiter Christi immer noch hilfreich sein können. Er erzählt: Im Frühjahr 1867 wurde ich Soldat. Schon auf der Eisenbahn» fahrt nach Ulm gab's viel Spott, weil ich mich an den Ausgelassenheiten der Miteinberufenen in keiner Weise beteiligte. In der Reiterkaserne in Ulm mußten wir alle antreten und wurden aufgefordert, uns freiwillig zu dieser oder jener Waffengattung zu melden. Die meisten meiner Kameraden taten dies; ich aber blieb stehen. Ich hatte Hemmungen, selber zu wählen, und wollte mich lieber anweisen lassen; dies wollte ich dann als den mir von Gott verordneten Weg annehmen. So wurde ich schließlich zur Festungsartillerie bestimmt. Nach einem kurzen Marsch zur Festungsartillerie-Kaserne mußten wir im Hof eine Weile Warten. Da schrie ich innerlich zu Gott, er möge mich doch bewahren, daß ich da drin nicht des Teufels werde. Alsbald hörte ich im Innern eine Stimme ganz ruhig zu mir sagen: ››Dir mag da drin begegnen, was da will; du hast alles aus meiner Hand anzunehmen. Ich bin es, der dich da hineinstellt; du hast es deshalb allein mit mir zu tun und ich mit dir.<< Dies konnte ich fassen und glauben. Es blieb auch fest in mir iiber die ganze Militärzeit und bewährte sich selbst unter den schwersten Stürmen. ... Goldregenheft Nr. 22 |
 |
Margarete Noth Eine Bibel findet ihren Platz Geschichten aus der Nachkriegszeit Franz, 1966, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 61 Eine Bibel fíndet ihren Platz Mehrere Sommerwochen hindurch war Nickel, der Sohn eine Freundin, Während eines Studienaufenthaltes mein Gast gewesen, und ich hatte ihn schon fast wieder vergessen, als an meinem Geburtstag ein Päckchen von ihm kam. »Ich habe mir<<, schrieb er dazu, ››hin und her überlegt, womit ich Ihnen meinen Dank ausdrücken und eine wirkliche Freude bereiten kann. In der Buchhandlung, in der ich den Inhaber durch meine Ratlosigkeit schon fast zur Verzweiflung gebracht hatte, wurde mir schließlich diese Bibel vorgelegt. Sogleich erinnerte ich mich an die Ihre, die so abgegriffen und unansehnlich geworden ist, und ich hoffe nun zuversichtlich, daß dies für Sie so unentbehrliche Buch im neuen Gewand mehr Freude bringt als irgendein anderes« Guter Nickel! Er begriff noch nicht, daß ein Mensch mit seiner Bibel verwächst, und daß ich mich von der meinen trotz zerschabten Einbandes und verblichenen Goldschnittes niemals trennen würde, solange sie noch zusammenhielt. So stellte ich das kostbare saffiangebundene Buch vorläufig in den Bücherschrank, gewiß, daß ich selbst es niemals brauchen würde. Vielleicht aber fand ich einmal einen Menschen, dem es zum Lebensbuch werden könnte, einen, der mit hungrigem Herzen danach griff. Ein halbes Iahr war dariiber vergangen. Ab und zu hatte ich es schon zögernd in die Hand genommen, um es einem der Menschen zu schenken, die auf der Suche nach Wahrheit sich einzeln oder in kleinen Gruppen zum Gespräch einfanden. Aber immer wieder stellte ich es zweifelnd oder abwartend zurück. Es war ... |
 |
Waltraud Nicolas Das andere Gesicht Geschichten aus Russland Franz, 1967, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 62 DIE BABUSCHKA UND DER REICHE JÜNGLING ››Babuschka, erzähl uns eine Geschichte<<, bettelten die Jüngsten. ››Ja, Babuschka, erzähl etwasl« fielen die Frauen ein. Wenn die Babuschka erzählte, wurde es in der Frauenzelle still wie in der Kirche. Dann glitten die endlosen Abende dahin wie bunte Kinderträume, über denen man die Wirklichkeit vergaß, diese rauhe und graue Wirklichkeit des Stalingrader Untersuchungsgefängnisses, in dem wir Lachen und Weinen verlernt hatten. »Ich weiß nichts mehr<<, seufzte die alte Babuschka. »Alle Märchen, die ich kenne, habe ich schon erzählt. Und sonst weiß ich nur noch die heiligen Geschichten, aber die wollt ihr ja nicht hören.<< »Meinetwegen erzähl auch die heiligen Geschichten - besser als gar nichts<<, sagte Lena müde. »Was soll man denn tun in diesem elenden Verdammtsein zum Nichtstun? Und vom Denken wird man beinahe verrückt« »Nun fang schon an, irgend etwasi« drängten die Mädchen. »Also gut, hört zul« sagte die Babuschka. »Genau weiß ich es nicht mehr, ich kann ja nicht lesen, und mir hat es auch nur meine Mutter erzählt - das ist schon lange her. Es war einmal ein junger Zarensohn, der wohnte in einem Schloß, das ganz aus blauen und grünen Diamanten gebaut war. So ein prächtiges Schloß hatte es auf der weiten Welt noch nicht gegeben. Die Türen waren aus Silber und die Tische und Stühle aus purem Gold. Im Garten zwitscherten bunte Vögel, die Rosen waren so groß wie Pfannkuchen, und die Lilien leuchteten wie der Mond. Wenn ihr aber erst in die Schränke und Truhen gesehen ... |
 |
Rainer List Johann Jakob Kuhn in Zainingen Franz, 1967, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 63 Die Schwäbische Alb gehört ohne Zweifel zu den reizvollsten Landschaften unseres Landes. Vielgestaltig, bald rauh, schroff und abweisend, bald heimelig, lieblidi und einladend begegnet sie dem Wanderer - einst und heute. Die Natur prägt diese Landschaft so stark, daß der Mensch, der sie bewohnen will, ein Stück der Natur in sidi aufnehmen muß. Kein Wunder, daß audi bei den Älblern, den Menschen auf der Alb, Rauhes und Zartes, Derbes und Inniges auf vielgestaltige Art vermisdit erscheinen. Auf der Höhe der Schwäbischen Alb, etwa zwölf Kilometer östlich von Urach und 800 Meter hoch, liegt das Dorf Zainingen. Als dem Magister Iohcmn Iakob Kuhn im Jahre 1729 die Pfarrstelle dort übertragen wurde, da fielen ihm zuerst die Disteln und Dornen seiner neuen Aufgabe in die Augen. Kulm war der Sohn eines Uracher Bürgers; er kannte also die Menschen der Alb. Er war auch mit 33 Jahren kein Jüngling mehr, dem es an Erfahrung gefehlt hätte. Aber was er in seiner neuen Gemeinde vorfand und beobachten mußte, das brachte sein Blut in Wallung. So hatte er sich seine Gemeinde nicht vorgestellt! Das Fluchen war ihm das erste Ärgernis. Einige der Männer taten sich mäditig groß damit. Lästerliche Redensarten, ellenlange ››Kraft<<-Ausdrücke und häßliche Verwünschungen begleiteten die alltäglidisten Arbeiten. Wo lautstarke Schreier vorangehen - und sei's mit bösem Beispiel -, da folgen in kurzem viele andere nach. In Zainingen hatte diese üble Sitte so um sich gegriffen, daß sogar Kinder und Frauen auf der Dorfstraße lauthals fluchten. Ähnlich widerwärtig war für den neuen Pfarrer die Sonntagsbeschäftigung, der viele Zaininger mit Leidenschaft ... |
 |
Werner Krause Es gibt keinen anderen Weg Das Leben der Maria Scobcova Franz, 1968, 30 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 65 Als Lisa Pilenko in Anapa, einem Hafenstädtchen am Schwarzen Meer, ihre Iugendjahre verlebte, regierte in Rußland der letzte Zar. Sie kannte damals keine Sorgen. Ihre Eltern konnten es sich leisten, jedes Iahr, bevor der Winter begann, weit hinauf in den Norden in die damalige Hauptstadt Petersburg zu reisen, wo die Familie mehrere Monate bei einer wohlhabenden und in der Gesellschaft angesehenen Großtante wohnte. Natürlich bot die Hauptstadt des großen Russischen Reiches vielerlei Abwechslung. Früh lernte die kleine Lisa den Prunk der vornehmen Welt kennen. Aber damals schon begnügte sie sich nicht mit äußeren Eindrücken. Ihr wacher Verstand versuchte, tiefer in das Innere der Dinge einzudringen. Schon als Kind ahnte sie, daß der Glanz aller Äußerlichkeiten trügt und auf die Dauer nicht befriedigen kann. Ihr feines Gemüt litt tief, wenn sie offensichtliche Ungerechtigkeiten bemerkte und wenn andere Kummer und Sorgen hatten. Wie konnte Gott das zulassen, und wie konnten es viele wohlhabende Menschen ertragen, manche ihrer Mitinenschen in größter Armut dahinvegetieren zu sehen? Lisa sehnte sich immer mehr danach, darüber mit jemand zu sprechen, der dank seiner Stellung den notwendigen Weitblick hatte. Vielleicht würde ihr dann manches klarer, und sie wäre die schreckliche Unruhe los? Schließlich glaubte sie, solch eine Persönlichkeit in Konstantin Petrowitsch, einem guten Bekannten ihrer Großtante, gefunden zu haben. Er gehörte zu den Großen im zaristischen Rußland: als Oberprokuror stand er an der Spitze der höchsten kirchlichen Behörde, des Heiligen Synod, und war in dieser hervorragenden Stellung allein dem Zaren unterstellt. Konstantin Petrowitsch war ein kinderlieber Mann. Jedesmal wenn Lisa mit ihren Eltern aus dem Süden in Petersburg eintraf, unterrichtete ihn die Großtante von der Ankunft der Verwandten. Meistens suchte er kurz darauf das Haus der Großtante auf, um die Verwandten wiederzusehen.... Maria Skobzowa geboren als Jelisaweta Jurjewna Pilenko, * 8. Dezember in Riga; † 31. März 1945 in Ravensbrück, war eine russische Dichterin, Nonne und Gerechte unter den Völkern. Während des Zweiten Weltkriegs war sie Mitglied der französischen Widerstandsbewegung. Bekannt wurde sie unter dem Namen Mutter Maria |
 |
Hannah Müller-Koller Das Brandmal Eine Weihnachtsgeschichte Franz, 1969, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 66 Urn die Kirche, eine alte Wehrkirche, lief die dicke Mauer, oben abgeflacht. Einstmals mußten vier Türme Friedhof und Gotteshaus abgeschirmt haben. Ietzt War nur noch einer da, der sogenannte Wachturm. Er barg ein Zimmer mit Nebenraum. Darunter führte durch das Tor der bucklige, holprige, gepflasterte Weg, der Kirchenweg für das ganze Dorf. Durch das düstere Tor trugen die Bauern ih-re Kinder zur Taufe und die Toten zur letzten Ruhe. Der Hochzeitszug schritt durch das Tor: weiße Bräute, junge Männer mit dem Myrtenzweig im Knopfloch. So gingen sie noch heute, so waren schon ih-re Vorväter gegangen. Es war ein Dorf, in dem noch vie-le gute alte Sitten, aber auch seltsames Brauchtum lebte. Krieg und Flüchtlinge hatten manches verwischt und verändert. Der Wachturm zum Beispiel, der seit Jahr und Tag leer gestanden hatte, war jetzt einer jungen Kriegswitwe als Wohnung zugewiesen worden. Der Bürgermeister hatte für vierzig Flüchtlinge Unterkunft zu schaffen. Warum nicht den Turm einbeziehen? Ganz früher hatte dort eine alte Frau gewohnt, die allerdings als Hexe verschrieen war. Kein Wunder, denn im Turm sollte es umgehen, und die Toten lagen so nahe. Der Bürgermeister bot sein Turmgelaß an, lobte es sogar ein wenig: »Man ist allein. Es gibt keinen Streit. Und die Aussicht über die Mauer weg bis hinüber zum Fluß, wunderbar - und doch nicht weit ins Dorf, nicht so abseits gelegen<<, und er deutete auf die einsame Mühle mit ihren zwei Austragshäuschen. Vierzehn Personen hatte er dort untergebracht. Es meldete sich die junge Frau. Oder war sie vielleicht nicht ... |
 |
Werner Krause Der Weg nach Bethel Friedrich von Bodelschwingh Franz, 1969, 31 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 67 Der Theologie-Kandidat Friedrich von Bodelschwingh packte mit nachdenklicher Miene seine Sachen aus dem Koffer, legte sie in die Kommode neben dem kleinen Fenster und nahm auf dem Bettrand Platz. Er war am Ziel: Paris! Noch vor einem Jahr hätte der junge Mann nicht daran gedacht, hier mit der seelsorgerlichen Arbeit zu beginnen; denn sein Wunsch war seit langem die Heidenmission gewesen. Seine Gedanken wanderten noch einmal die Wege und Stationen der letzten Iahre zurück und verweilten mit besonderer Liebe in der Zeit seiner Tätigkeit in der Landwirtschaft, die vor dem Theologiestudium lag. Nach der Beendigung der Schulzeit am Dortmunder Gymnasium 1849 fiel ihm die Studienwahl nicht schwer. Für ihn kam damals nur das Studium der Landwirtschaft in Frage. Es stand für ihn fest, in Berlin zu studieren. Mit der Praxis wollte sich Friedrich von Bodelschwingh nicht auf dem verhältnismäßig kleinen Familiengut Velmede, zwischen Dortinund und Hamm gelegen, vertraut machen, sondem auf einem großen Gut mit einigen tausend Morgen, um möglichst viele Sparten seines zukünftigen Berufes gründlich kennenzulernen. Sein Vater, der vor einem Jahr, nach Ausbruch der Revolution, als preußischer Minister zuriickgetreten war, besorgte ihm beim alten Koppe in Kienitz im Oderbruch eine Lehrstelle. Der bei den Bauern wegen seiner Tüchtigkeit und großen Erfahrung geschätzte Koppe hatte sich ... |
 |
Elisabeth Schmidt-Schell Licht fällt in verpfuschtes Leben Die Beichte eines jungen Menschen Franz, 1970, 36 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 68 Seit dem ersten Gespräch, das ich mit Kurt führte, behauptet er, ich sei dümmer, als die Polizei erlaubt. So ausfallend benimmt er sich mir gegenüber, weil ich einen anderen Standpunkt vertrete als er und nicht bereit bin, seine Manieren anzunehmen. Ietzt habe ich ihm gesagt, daß ich mich nicht mehr in eine Diskussion mit ihm einlassen werde. Das werde ich auch strikt einhalten. Die ständigen Zänkereien bringen nichts ein. ››Gut<<, sagte er, »von mir aus mach doch, was du willst. Ich habe meine Erfahrungen gemacht und wollte nur dein Bestes. Du wirst sehen, wie weit du mit deiner Gutgläubigkeit kommst. Dir werden die Augen schon noch aufgehen.<< Immer, wenn Kurt sich nicht mehr zu helfen weiß, pocht er auf seine Erfahrungen und macht alles madig. Nur er allein will das Gute. Alle anderen sind Egoisten, hinterlistig und schlecht. Das nehme ich ihm aber nicht ab, obwohl ich erst vier Wochen im Betrieb bin und er schon ein ganzes Lehrjahr hinter sich hat. Schließlich habe ich auch schon Erfahrungen gesammelt und müßte lügen, wenn ich sagen würde, daß mir einer Unrecht getan hätte. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, daß Ehrlichkeit und Freundlichkeit nicht anerkannt werden, wie Kurt behauptet. So wie ich ihn bis jetzt kennengelernt habe, muß er völlig verdorben sein. Wie könnte er sonst auf solche Gedanken kommen und hinter allem, was die Arbeitskollegen tun, etwas Schlechtes sehen. Man traut doch anderen nur das zu, wozu man selbst fähig ist! - Wenn er nur ein bißchen Einsicht aufbringen würde, müßte er sich sagen, daß er mit seinem Verhalten von den anderen gar keine Freundlichkeit erwarten kann. Von Vertrauen ganz zu schweigen. Mit dem Lagerleiter, dem ich jetzt zur Ausbildung zugeteilt wurde, versteht sich Kurt überhaupt nicht. Ich dagegen komme ganz gut mit ihm aus. Zugegeben, Herr Trott ist nicht fehlerlos. Manchmal nimmt er sich ein bißchen zu wichtig, aber sonst ist er in Ordnung.Er bemüht sich, mir etwas beizubringen, und läßt auch ganz vernünftig mit sich reden. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, daß er mir gehörig über den Mund fahren würde, wenn ich mich aufführen würde wie Kurt. Und das mit Recht, finde ich. Soll er sich vielleicht von einem Lehrling auf der Nase herumtanzen lassen? Von mir aus kann mich Kurt jetzt bezeichnen wie er will. Ich lege mich nicht mehr mit ihm an und lasse mich auch nicht von ihm unsicher machen. Ich weiß nämlich, daß ich nicht schief liege... |
 |
Hans Huppenbauer Vater Huppenbauer vom Palmenwald (Kurhaus Palmenwald, Freudenstadt) Franz, 1972, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 3-7722-0132-6 4,00 EUR |
Goldregen Heft 69 Es war wenige Iahre vor Ausbruch des ersten Weltkriegs. Auf dem Bahnhof Eutingen war eben der Abendschnellzug aus Stuttgart eingefahren. Unter den wenigen Reisenden, die dem Zug entstiegen, befand sich ein älterer Herr, eine stattliche, aufrechte Gestalt mit breitrandigein Hut und leicht ergrautem Patriarchenbart. Während er am Bahnsteig entlangging, um in den bereitstehenden Zug nach Freudenstadt umzusteigen, grüßte ihn aus einem offenen Wagenfenster ein Unbekannter mit den Worten: ››Hallo, Huppenbauer, Württembergs geliebter Herrl« Der Mann, dem dieser überschwengliche Gruß galt, war der Leiter des christlichen Kurhauses Palmenwald in Freudenstadt, der frühere Basler Missionar David Huppenbauer. Jugendjahre Die Heimat der Huppenbauer ist Untertürkheim bei Stuttgart. Die offenbar plattdeutsche Form des Namens bedeutet: ein Bauer, der eine Hufe bewirtschaftet, das heißt ein Stück Land, das mit einem Pferd bearbeitet werden kann. In Untertürkheim wurde auch David Huppenbauer am 2. Dezember 1855 als Sohn des Weingärtners Bartholomäus Happenbauer geboren. Er verbrachte dort die ersten acht Iahre seines Lebens im Kreis seiner Geschwister, seiner älteren Schwester Doris (der späteren Oberschwester im Stuttgarter Olgaspital) und der zwei jüngeren Geschwister Wilhelm und Lydia (die beide im Missionsdienst an der Goldküste gestorben sind). Als er sieben Jahre alt war, verlor David seine Mutter, eine liebe, fromme Frau, der es ein Anliegen war, »ihre Kinder dem Heiland zuzuführen<<. Ein Iahr nach dem Tod der Mutter heiratete der Vater wieder und zog nach Schorndorf, der Heimat seiner zweiten Frau, wo er noch bis ins 80. Lebensjahr seinen Weinberg, sein »Paradiesle-<<, bebaute. Im Elternhaus herrschte strenge christliche Zucht, war der Vater doch treues Mitglied und später Leiter der altpietistischen Gemeinschaft. Der zu allerlei Bubenstreichen aufgelegte Iunge hat offenbar seinen fromrnen Eltern viel Sorge bereitet. Kurz vor seinem Tod spielte er einmal auf seine Iugendzeit an, als er auf dem Basler Missionsfest bei der dreieinhalb Stunden dauernden Generalkonferenz ... |
 |
Martha Pampel Marei und ihr Vater Franz, 1972, 30 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 70 Große, schwarze Augen in einem pausbacltigen Gesicht, eine Stupsnase, hellblonde Locken, die das Köpfchen uingaben, und ein rnolliger Körper mit strainmen Beinen, wie es sich fiir ein dreijähriges Kind gehört, das War Marie-Elisabeth, genannt Marei, die kleine Tochter des Pfarrers. Wenn man es nicht sah, hörte man das kleine Mädchen ganz gewiß, denn sein Mund stand kaum einen Augenblick still. Wenn, die Mutter einen Augenblick nicht im Zimmer war, sprach es mit Gisela, seiner Puppe, oder es fragte Wollbäckchen, und der kleine Stoffbär hatte immer eine Antwort, sobald man ihn auf seinen Bauch drückte. Abends, wenn die Mutter sie ins Bett legte, weinte Marei nur selten. Es muß eben sein, dachte sie, und so murrte sie auch nicht, sondern freute sich auf die Geschichte, die ihr die Mutter jeden Tag vor dem Einschlafen erzählte. Die Mutter erzählte nur kurz, und auch wenn die Geschichten alt waren, waren sie fiir Marei doch immer wieder neu. Zum Schluß nahm die Mutter noch die Geige zur Hand und spielte:»Breit aus die Flügel beide« und hatte es gern, daß ihre kleine Tochter mitsang. Marei fing an, sich Gedanken zu machen über die Welt und über ihre eigene kleine Person, aber auch über Gott, zu dem man am Morgen und allabendlich sprach und dabei die Hände falten mußte, den man nicht sah und nicht hörte und der doch da war, wie es die Mutter sagte, und der die Engel schickte als seine Boten und Beschützer zu allen Menschen, die ihn darum baten. Marei glaubte diesen Worten, und so konnte die Mutter getrost das Licht ausmachen, Die Marei beschützten, waren ja noch stärker als der Kaufmann unten im Ort, der so groß war, daß sogar die Mutter an ihm hinaufsehen mußte. |
 |
Renate Sprung Ein Licht in der Nacht Eine Adventserzählung Franz, 1976, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 2,60 EUR |
Goldregen Heft 72 Ein Licht in der Nacht Adventserzählung von Renate Sprung Es war ein stürmischer Novemberabend. Auf dem Geländer des Bootstegs unten am Fluß saß ein junger Mann. Die Lichter der sich am anderen Ufer hügelaufwärts zíehenden Stadt leuchteten trüb durch den schrägfallenden Regen. Von der Erde stieg ein Geruch von moderndem Laub und verwelktem Gras zu einem dämmriggrauen Himmel, der aussah, als wolle er jeden Augenblick auf die Erde herabfallen. Der Herbstwind zauste ungestüm die das Ufer säumenden Weidenbüsche und peitschte die kahlen, tief herabhängenden Zweige klatschend ins Wasser des Flusses. Sonst war es still hier draußen. Keine Menschenseele weit und breit. Nur ein paar einsame Krähen hockten mit eingezogenen Köpfen auf einem grünlich schillernden Weidenstumpf. Der junge Mann schlug fröstelnd den Iackenkragen hoch. ››Wenn jetzt ein Lastkahn käme, könnte ich winken<<, überlegte er, »vielleicht würde er festmachen und mich mitnehmen. - Natürlich würde er das nicht tun<<, stellte er sogleich mit der ihm eigenen Sachlichkeit fest. Er erinnerte sich, die Anlegestelle drüben auf der anderen Seite gesehen zu haben, ein Stück unterhalb der Brücke. Die Kleidung des Mannes war denkbar einfach und der Iahreszeit nicht angemessen. Als man ihn vor zwei jahren abgeholt hatte, war es Frühling gewesen, Anfang Mai, und jetzt schrieb man Ende November. Der Mann trug eine hellbraune Cordsamthose und eine dunkelgrüne jacke aus Cord, aus deren Halsausschnitt der Kragen eines roten Sommerpullovers hervorsah. Seine Füße steckten in braunen Halbschuhen mit dünnen, abgelaufenen Gummisohlen. Er war nicht lebensmüde, obwohl er sich eingestand, daß irgendetwas an seiner Art zu leben nicht stimmte. Er wollte nur in Ruhe überlegen, wie es mit ihm nun weitergehen sollte. Sein Strafregister reichte vom Taschendiebstahl bis hin zum Überfall auf einen alten Mann. Dabei hatten sie ihn erwischt. Der Alte hatte zu laut um Hilfe gerufen. ››Ich wollte ihm nicht weh tun<< ... |
| vergriffene Titel der Reihe Goldregen | ||
| Bernhard Reusch Ein seltsamer Gast |
Goldregen Heft 1 | |
| Bernhard Reusch Sieh, das sind Gottes Wege |
Goldregen Heft 2 | |
| Bernhard Reusch O, daß ich wäre mitgegangen |
Goldregen Heft 4 | |
 |
Julius Seybold Der arme und doch reiche Schulmeister Goldregen Heft 7 Franz, Auflagen von 1962 und 1966, 22 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm 3-7722-0089-3 |
Goldregen Heft 7 »Mich in die Zeit zu schicken, Lehr mich, Herr Iesu Christl« In den Iahren 1790 bis 1834 lebte in dem lieblichen Örtchen Stockach bei Tübingen ein sehr armer Schulmeister mit Namen Klett. Er war einer der »Stillen im Lande<<, und bei ihm trat in besonderer Weise zutage, was der köstliche Vers ausdrückt: ›› Sie wandeln auf Erden und leben im Himmel, Sie scheinen unmächtig und schützen die Welt; Sie schmecken den Frieden bei allem Getümmel, Sie haben, die Ärmsten, was ihnen gefällt. Sie stehen im Leiden und bleiben in Freuden; Sie scheinen ertötet den äußeren Sinnen Und führen das Leben des Glaubens von innen.<< Heute noch lebt er im Herzen so vieler fort als leuchtendes Vorbild kindlichen Glaubens, herzlicher Liebe und lebendiger Hoffnung. Was hier in schlichten Worten zur Ehre Gottes niedergelegt ist, stammt teils aus Privatakten und mündlicher Überlieferung der Stockacher und andrer, teils aus >Dr. Barths Leben« von Werner. Klett hatte es schwer mit seiner großen Familie von etwa neun Kindern, denn seine Besoldung war eine gar knappe, jährlich siebzig Gulden Gehalt, auch für jene Zeit sehr wenig, und die Nutzniefšung einiger Gemeindegrundstücke mußten ihm ausreichen. Er nährte sich auch in gewöhnlichen Iahren zwar spärlich, doch ehrlich davon, immer zufrieden und dankbar gegen seinen Gott. Dabei erfuhr er die Wahrheit... |
| Bernhard Reusch Was Liebe vermag |
Goldregen Heft 8 | |
| Bernhard Reusch Der deutsche Christbaum im Felsengebirge |
Goldregen Heft 9 | |
| Julie Koch Heimkehr am Konfirmationstag |
Goldregen Heft 10 | |
| Bernhard Reusch Zwei Rabengeschichte |
Goldregen Heft 11 |
|
| Bernhard Reusch Du sollst den Feiertag heiligen |
Goldregen Heft 13 |
|
| Bernhard Reusch Der arme Graf und der reiche Köhler |
Goldregen Heft 14 |
|
| Elisabeth Oehler-Heimerdinger Der Schneiderhannes |
Goldregen Heft 20 |
|
| Elisabeth Oehler-Heimerdinger Justinas Tochter |
Goldregen Heft 24 |
|
| Elisabeth Oehler-Heimerdinger Kusine Hedwig |
Goldregen Heft 25 |
|
| Hannah Müller Aus dem Alltag einer alltäglichen Frau |
Goldregen Heft 28 |
|
| Anna Katterfeld Der Engel aller Hütten |
Goldregen Heft 30 |
|
| Hannah Müller Bevor die Weihnachtslieder brennen |
Goldregen Heft 31 |
|
 |
Friedrich Baun Schulmeister Kolb von Dagersheim 1784-1859 Franz, 1964, 36 Seiten, 50 g, geheftet, |
Goldregen Heft 32 Jugendzeit Immanuel Gottlieb Kolb ist seiner ganzen Gemüitsart nach ein echter Schwabe. Im Herzen des Schwabenlandes, in Schönaich bei Böblingen, stand auch seine Wiege, wo er am 28. Dezember 1784 geboren wurde, und in Dagersheim, ebenfalls im Kreis Böblingen, hat er die meiste Zeit seines Lebens verbracht. Er entstamrnte väterlicher- und miitterlicherseits einer Lehrerfamilie; schon der Großvater und Urgroßvater waren Schulmeister gewesen, ebenfalls in Dagersheim, seiner zweiten Heimat. Im Elternhaus Schönaich herrschte strenge Sitte und Ordnung; die Kinder Wurden auferzogen >›in der Zucht und Vermahnung zum Herrn<<. Unter neun Kindern, sechs Knaben und drei Mädchen, die den Schulmeistersleuten beschert worden waren, stand Gottlieb in der Mitte. Bei dem schmalen Einkommen des Vaters und den schlechten Zeiten -- es begannen damals die Napoleonischen Kriege -- war das tägliche Brot oft recht knapp; noch in seinem Alter konnte Kolb davon sagen, wie die besorgte Mutter den Kindern zuweilen die Kartoffeln vorgezählt habe, damit keines eine zu viel oder zu wenig erhalte. Auch geriet die Familie eine Zeitlang in solche Not, daß ihr eine Scheune zum Aufenthalt dienen mußte. Diese Schule der Armut und Entbehrung verlieh Kolb die ihn kennzeichnende Bescheidenheit, die ihn später befähigte, gerade mit einfachen Leuten niederen Standes so verständnisvoll und herzlich teilnehmend umzugehen. Seiner geistigen Entwicklung jedoch taten diese dürftigen äußeren Verhältnisse keinen Eintrag. Gesund und kräftig wuchs er heran und zeigte in mancher Beziehung eine Frühreife, daß er die Leute oft in Erstaunen versetzte. So hat er z. B. schon mit zwei Jahren Melodien nachgesungen. Obwohl er der Liebling der frommen Mutter war, ließ ihm diese nichts hingehen, sondern hielt immer auf strengen Gehorsam. Bei seinem starken Eigenwillen wardies oft keine leicht Sache ... Heft als pdf |
| Hannah Müller Das Gerüst |
Goldregen Heft 33 |
|
| Julius Roessle Johann Caspar Lavater |
Goldregen Heft 40 |
|
| Hannah Müller Die Sprengung |
Goldregen Heft 41 |
|
| Anna Katterfeld Die erste Blutzeugin |
Goldregen Heft 42 |
|
 |
Hannah Müller Furcht vor Weihnachten Weihnachtsgeschichten Franz, 1961, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm |
Goldregen Heft 46 FURCHT VOR WEIHNACHTEN Beate hatte den ganzen Tag gearbeitet. Die Wohnung blitzte und blinkte. Es roch nach feinem Kuchen. Die Heizung surrte, und frische Tannenzweige dufteten in der Wärme. Beate zog sich urn, hängte das Arbeitskleid an den Haken. Bald wiirde ihr Mann heiinkoinmen. Er sollte sie sauber und gepflegt finden, das mochte er gern. Sie beide waren kein junges Ehepaar mehr. Die Kinder lebten ihr eigenes Leben, und rnanchnial wurde schon vom Ruhestand gesprochen. Beate ging in der Wohnung hin und her, richtete das Abendessen, sah nach der Uhr. Da begannen die Glocken zu läuten. Die Kirche stand nicht weit. Die Glocken läuteten Advent. Beate wußte das. Sie bekam traurige Augen. Wie viele Mensehen sich wohl über das Adventsgeläute freuen, wie viele schon ihre Freude weiter laufen lassen bis hin zur Weihnachtszeit, zum Heiligen Abend! Sie seufzte ein wenig vor sich hin. ››Ich«, dachte sie, »ich freue mich nicht, nicht auf Advent, erst recht nicht auf l?leilinachten. ich, ich 'fürchte mich.« Sie wußte auch, warum. Es war jedes Iahr dasselbe. Zu Weihnachten gehören Wünsche, und zu diesen gehörte hinwiederum Geld. Nicht, daß Beate und ihr Mann arm gewesen wären, o nein, sie lebten in geordneten und guten Verhältnissen. Aber wenn Weihnachten sich anzeigte und Beate Wollte, ja mußte schenken und um Geld für Weihnachten bat, dann wurde ihr Mann unwillig, böse. »Ach, das Getue mit den Geschenken! Schreibe jedem einen schönen Brief, darüber kann man sich auch freuen.« Und wenn dann Beate erwiderte: »Aber du kannst doch Rudolf... |
| Rita von Gaudecker Marianne und Petra |
Goldregen Heft 52 |
|
 |
Werner Krause Mutter, ich werde dich nie vvergessen Der Weg des Pastors Christian Jensen Franz, 1974, 32 Seiten, 50 g, geheftet, 12,5 x 19 cm |
Goldregen Heft 60 Die Schule in dem kleinen Kirchdorf Fahretoft an der Nordsee war aus, und die Kinder drängten lärmend hinaus. Der neunjährige Christian Jensen schien es heute eiliger zu haben als alle andern; denn als Niss Payssen ihm nachrief, ob er nachmittags zum Püddenland komme, um auf dem tiefen, mit Wasser bedeckten Gelände Boot zu fahren, bekam er keine Antwort. Der kleine Jensen eilte sofort zum Kaufmann, um einige Besorgungen fiir die Mutter zu erledigen, und machte sich dann schnell auf den Weg zur heimatlichen Lütjenswarf. Die Liitjenswarf bestand aus einem breiten Erdhügel, auf dem mehrere Gebäude standen. Eines der Häuser gehörte Christians Vater, dem Deicharbeiter Volquard Jansen. Christian hatte von der Schule bis zum Elternhause einen Weg von etwa einer halben Stunde. ››Mia, meine arme, kranke Miai« fliisterte der Junge mehrmals während des Laufens. Seine Schwester, zwei Jahre jünger als er, hatte ihn heute morgen so sonderbar angesehen, als er vor dem Schulgang an ihr Bettchen getreten war, um sich zu verabschieden. Das ernste Gesicht des Vaters und die versteckten Tränen der Mutter hatten ihm bereits in den letzten Tagen verraten, daß sein Schwesterchen sehr krank war. Jetzt kam er am Friedhof vorüber. In diesem Augenblick fiel ihm das Lied ein, das seine Mutter gern und oft sang: »Nach einer Prüfung kurzer Tage erwartet uns die Ewigkeit<<. ››Nein, lieber Gott, nein! Meine Mia soll nicht auf den Friedhofl« schrie der Junge mit Tränen in den Augen. Es war nur noch eine kurze Strecke bis zur Lütjenswarf. Keuchend rannte er den Deich entlang. Noch ein paar Schritte, dann öffnete er die rot und gelb bemalte Türe und betrat die Diele. Die Mutter erwartete ihn schon. Sie stand mit gefalteten Händen und verweinten Augen vor der Stube. ››Nein, Mutter!<< schrie Christian noch ganz außer Atem. Da preßte die Mutter beide Hände vor das Gesicht und sagte schluchzend: >›Doch, Christian, .unsere Maria ist von uns gegangen« Der Junge trat fassungslos an ihr Bettchen. Da lag sie, die kleine Maria, blaß und stumm, doch schön und friedlich wie ein kleiner Engel. Die Mutter beugte sich zu ihm hinab und sagte: »Ich soll dir von unserer Mia etwas bestellen. Als du zur Schule gegangen warst, sagte sie zu mir: >Wenn Christian wieder kommt, sage ihm, daß ich im Himmel bin.<< - »Dann will ich auch dort sein!<< rief Christian. »Wir müssen warten, bis uns der Herr ruft<<, erwiderte die Mutter leise und trat gebeugt an das Fenster ... Heft als pdf |
| Elisabeth Meyer Der Bund mit Gott |
Goldregen Heft 64 |
|
| Hildegard Krug Um des Evangeliums willen |
Goldregen Heft 71 | |