| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Papsttum im mittelalterlichen Europa, Böhlau Verlag | ||
 |
Stephan Pongratz Gottes Werk und Bosos Beitrag Die Bewältigung des Alexandrinischen Schismas (1159–1177) in den Papstviten des Kardinals Boso Böhlau Verlag, 2023, 560 Seiten, Hardcover, 978-3-412-52665-8 90,00 EUR |
Papsttum im
mittelalterlichen Europa Band 11 Die Papstbiographik des Mittelalters als Mittel zur Krisenbewältigung? Neue Forschungsergebnisse zu einer der wichtigsten Quellen zur Geschichte des 12. JahrhundertsDie Papstbiographien des Kardinals Boso bieten einen einzigartigen Einblick in die von Kirchenspaltungen und dem Kampf mit dem deutschen Kaisertum geprägte Geschichte des 12. Jahrhunderts. Unter seinen Texten sticht die Vita Papst Alexanders III. (1159-11181) hervor, der nicht nur einen der längsten und wichtigsten Pontifikate des Mittelalters erlebte, sondern auch in einem jahrzehntelangen Konflikt Kaiser Friedrich I. Barbarossa gegenüberstand. Bosos zeitgenössische Biographie wurde vor dem Hintergrund dieser damals noch aktuellen Auseinandersetzung geschrieben und stellt keineswegs eine neutrale Geschichtsdarstellung dar. Vielmehr argumentierte der Kardinal mal mehr, mal weniger subtil zugunsten seines Papstes und war sich auch für bewusste Falschdarstellungen nicht zu schade. Das vorliegende Werk nähert sich diesem wichtigen Text aus quellenkritischer Perspektive und kommt zu neuen Erkenntnissen über den Verlauf der Auseinandersetzung von Papst und Kaiser sowie über das Weltbild der mittelalterlichen Kurie. |
 |
Isabel Blumenroth Das Alexandrinische Schisma in Briefen und Ideenwelt des Arnulf von Lisieux und Johannes von Salisbury Böhlau Verlag, 2021, 847 Seiten, gebunden, 978-3-412-52207-0 110,00 EUR |
Papsttum im
mittelalterlichen Europa Band 10 Die Briefsammlungen des normannischen Bischofs Arnulf von Lisieux und des angelsächsischen Gelehrten Johannes von Salisbury verraten viel über die Innensicht und überzeugungen ihrer Verfasser zu jenem großen Konflikt, der die Kirche in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Atem hielt. Die Studie analysiert die Schismabriefe unter Berücksichtigung von Vorgängerwerken wie Arnulfs Schmähschrift gegen Gerard von Angoulême und dem berühmten Policraticus des Johannes von Salisbury. Damit zeigt sie nicht zuletzt, dass sich das Papstschisma und der 1164 aufbrandende Disput zwischen dem englischen Herrscher und Thomas Becket für Zeitgenossen wie Arnulf von Lisieux und Johannes von Salisbury nicht, wie bisher in der Forschung argumentiert, auf getrennten Bühnen abspielten, sondern dass sie sich in deren Augen sogar gegenseitig bedingten. Inhaltsverzeichnis |
 |
Wendan Li Die Vita Papst Gregors IX. (1227–1241) Papst und päpstliches Amt in kurialer Sicht Böhlau Verlag, 2021, 373 Seiten, Hardcover, 978-3-412-52128-8 60,00 EUR |
Papsttum im
mittelalterlichen Europa Band 9 Der vorliegende Band gewinnt über die Vita Papst Gregors IX. und in Auseinandersetzung mit etlichen weiteren Quellen grundlegende Einsichten in den Pontifikat Gregors IX. Untersucht werden die Entstehung- und Überlieferungsgeschichte der Vita, die engen Bezüge zur Papstgeschichtsschreibung des Mittelalters, die programmatische Ausrichtung auf die Herrschaft im Kirchenstaat, die Bedeutung der beiden Exkommunikationen Friedrichs II. im Gedankengang der Vita und nicht zuletzt die Stilisierung von päpstlichem Protagonisten und kaiserlichem Antagonisten. Es wird deutlich, dass die Vita dem Papsttum in erster Linie als eine Legitimations- und Verteidigungsschrift in den Krisenjahren 1239/40, und weiter als ein Reservoir für politische, finanzielle, rechtliche und liturgische Antworten diente. Gregor IX. prägte die Heiligkeit des Papstes, die Territorialpolitik und das eschatologische Gedankengut der römischen Kurie nachhaltiger, als der vorherigen Forschung bewusst war. |
 |
Florian Eßer Schisma als Deutungskonflikt Böhlau Verlag, 2019, 874 Seiten, gebunden, 978-3-412-51332-0 120,00 EUR |
Papsttum im
mittelalterlichen Europa Band 8 Das Konzil von Pisa und die Lösung des Großen Abendländischen Schismas (1378–1409) Seit Wahl und Gegenwahl im Jahr 1378 konkurrierten in der westlichen Christenheit zwei Kontrahenten um das Papstamt. Beide fanden jeweils in Teilen Europas Unterstützung, das sich folglich in zwei Gehorsamsbereiche (Obödienzen) spaltete. Über 30 Jahre wurden immer wieder neue Vorschläge zur Lösung dieses Großen Abendländischen Schismas gemacht, doch blieb die Verdopplung des Papsttums bestehen. Erst 1408/1409, als sich Kardinäle beider Seiten von ihren Oberhäuptern lossagten und gemeinsam ein papstloses Konzil in Pisa betrieben, kam es zu einer wesentlichen Veränderung der Fronten. Der Band beschäftigt sich mit diesem Konzil von Pisa im Jahr 1409 als spezifischem Lösungsversuch für das Schisma. Das Papstschisma begreift er dabei als einen Konflikt konträrer Deutungen, deren Gegeneinander die via concilii sowie das Zustandekommen und die Ausgestaltung des Pisaner Konzils wesentlich beeinflusste. Gegenstand der Arbeit ist damit ein mittelalterliches Problem sowie die Arten und Weisen, wie die Menschen damals versuchten, es zu lösen – mit besonderem Blick auf die via concilii, den Lösungsweg des Konzils. Die Arbeit unternimmt hierzu eine umfassende Analyse der Praxis des Pisanums und vorausgehender Konzilsentwürfe sowie der dabei entwickelten und konfligierenden Deutungen. |
 |
Benjamin Oskar Schönfeld Die Urkunden der Gegenpäpste Böhlau Verlag, 2018, 456 Seiten, gebunden, 978-3-412-50913-2 79,00 EUR |
Papsttum im
mittelalterlichen Europa Band 7 Zur Normierung der römischen Kanzleigewohnheiten im 11. und beginnenden 12. Jahrhundert In Zeiten des Schismas waren Urkunden für die konkurrierenden Päpste das wichtigste Mittel, ihre Legitimationsvorstellungen, Argumente und Ansprüche auszudrücken. Die Forschung hat diesem Umstand bislang nur eingeschränkte Aufmerksamkeit geschenkt. Die Studie unterzieht nun erstmals diese zentralen Quellen einer systematischen Untersuchung. Anhand ausgewählter Kontroversen um die cathedra Petri im Hochmittelalter führt sie vor allem die diplomatische Entwicklung einzelner Urkundenelemente, deren graphische und inhaltliche Gestaltung im Detail vor und weist den katalysatorischen Einfluss der Konkurrenz im langfristigen Formalisierungsprozess der hochmittelalterlichen Papsturkunde nach. Inhaltsverzeichnis |
 |
Étienne Doublier Ablass, Papsttum und Bettelorden im 13. Jahrhundert Böhlau Verlag, 2017, 752 Seiten, gebunden, 978-3-412-50806-7 120,00 EUR |
Papsttum im
mittelalterlichen Europa Band 6 Der Band stellt den beeindruckenden Aufstieg des Ablasses im Laufe des 13. Jahrhunderts in den Mittelpunkt, als er sich von einem marginalen und auf wenigen Regionen beschränkten Gebrauch zu einer der beliebtesten Frömmigkeitspraktiken überhaupt und somit zu einem gewaltigen Massenphänomen entwickelte. Untersucht wird dabei in erster Linie die Rolle, die bei dieser Ausbreitung die jüngst entstandenen Bettelorden einnahmen, insbesondere die Prediger- und Minderbrüder. Es wird deutlich, dass auf der einen Seite der Ablass zur Etablierung der Mendikanten und ihrer Seelsorge maßgeblich beitrug, während auf der anderen Seite die Legitimität des umstrittenen Instituts von prominenten Theologen aus den Reihen der neuen Orden nachhaltig untermauert wurde. Von diesem Prozess profitierte aber am Ende vor allem das Papsttum, das sich dadurch als höchste heilsvermittelnde Instanz der Christenheit profilierte. Inhaltsverzeichnis |
 |
Florian Hartmann Brief und Kommunikation im Wandel Medien, Autoren und Kontexte in den Debatten des Investiturstreits Böhlau Verlag, 2016, 401 Seiten, gebunden, 978-3-412-50529-5 79,00 EUR |
Papsttum im
mittelalterlichen Europa Band 5 Der Investiturstreit galt lange als epochales Ereignis der mittelalterlichen Geschichte. Generationen von Historikern haben sich der Kontroverse gewidmet und dabei die großen politischen Themen diskutiert. Auch die jüngst belebte Debatte um Heinrichs IV. Gang nach Canossa hat den Blick auf die politischen Dimensionen konzentriert. Vor dem Hintergrund einer auf kulturgeschichtliche Fragen ausgerichteten Geschichtswissenschaft überrascht diese Verengung. Aus dieser Perspektive gilt es, die kommunikative Situation in den Mittelpunkt zu rücken, nach Medien der Auseinandersetzung zu fragen, nach räumlichen Dimensionen und nach jenen Veränderungen, die sich aus dem neuen kommunikativen Kontext für die Streitkultur ergaben. |
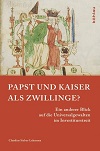 |
Claudius Sieber-Lehmann Papst und Kaiser als Zwillinge? Böhlau Verlag, 2015, 203 Seiten, gebunden, 978-3-412-22450-9 45,00 EUR |
Papsttum im
mittelalterlichen Europa Band 4 Ein anderer Blick auf die Universalgewalten im Investiturstreit Gregor VII., Heinrich IV. und der Gang nach Canossa von 1077 gehören zum Grundbestand historischen Wissens in Westeuropa: Die Machtsphären von »imperium« und »sacerdotium« traten in der Folge auseinander, indem Wahl und Amtseinsetzung von Geistlichen – die Investitur – neu geregelt wurden. Warum kam es nicht zu einer friedlichen Einigung? Konnten Kaiser und Papst sich nicht als ebenbürtige Zwillinge verstehen, wie es das berühmte Bild des Sachsenspiegels wenigstens bildlich nahelegt? Leider boten die biblischen Zwillinge Jakob und Esau kein positives Vorbild, und das negative Bild von Zwillingsbeziehungen erweist sich als fest verankertes Denkmuster des jüdisch-christlichen Weltbildes. Dies könnte ganz anders sein, wie der Vergleich mit antiken und außereuropäischen Kulturen zeigt. Inhaltsverzeichnis |
 |
Ursula Gießmann Der letzte Gegenpapst: Felix V. Böhlau Verlag, 2014, 410 Seiten, gebunden, 978-3-412-22359-5 85,00 EUR |
Papsttum im
mittelalterlichen Europa Band 3 Studien zu Herrschaftspraxis und Legitimationsstrategien (1434–1451) Der letzte Gegenpapst Felix V. (1440–1449) war vor seiner Wahl zum Papst durch das Basler Konzil Amadeus VIII., Herzog von Savoyen. Diese Vergangenheit als erfolgreicher Landesfürst prägte seinen Pontifikat. Das Buch beschäftigt sich mit zentralen Momenten des Pontifikats wie Wahl, Krönung und Rücktritt. Die Autorin zieht historiographische und urkundliche Quellen heran und untersucht zudem materielle Zeugnisse, die in Inventaren und Rechnungen verzeichnet sind. Aus der Analyse der Repräsentation und Herrschaftspraxis wird eine zentrale Legitimations-Strategie Felix’ V. deutlich: Es fand eine vielschichtige Verschmelzung der päpstlichen Repräsentation mit derjenigen des savoyischen Herzogshauses statt. Auf diese Weise entstand als Hybrid eigener Art ein herzoglicher Papst und vice versa ein päpstlicher Herzog. " |
 |
Clara Harder Pseudoisidor und das Papsttum Böhlau Verlag, 2014, 290 Seiten, gebunden, 978-3-412-22338-0 50,00 EUR |
Papsttum im
mittelalterlichen Europa Band 2 Funktion und Bedeutung des apostolischen Stuhls in den pseudoisidorischen Fälschungen Die pseudoisidorischen Fälschungen sind seit 400 Jahren Gegenstand der historischen Forschung. Entstanden im Frankenreich des 9. Jahrhunderts, galten sie das ganze Mittelalter hindurch als authentisch und wurden erst 1628 entlarvt. Sie beeinflussten das kanonische Recht und trugen zur Ausbildung des päpstlichen Primats bei. Die genauen Hintergründe ihrer Entstehung sind dabei nach wie vor umstritten. Jetzt liegt erstmals eine vergleichende inhaltliche Studie zu diesem 'größten Betrug der Weltgeschichte' (J. Haller) vor. Im Fokus steht die Bedeutung des Bischofs von Rom, die innerhalb des Fälschungskomplexes einer unterschiedlichen Schwerpunktsetzung unterliegt. Zudem wird die Entstehungsgeschichte der Fälschungen im mittleren 9. Jahrhundert einer grundlegenden Neubewertung unterzogen. Es wird deutlich, dass die pseudoisidorischen Fälschungen die kirchenrechtliche Autorität des Papsttums bewusst untermauerten und dadurch die Beziehungen zwischen Frankenreich und Rom nachhaltig veränderten. Inhaltsverzeichnis |
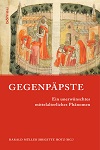 |
Harald Müller Gegenpäpste Ein unerwünschtes mittelalterliches Phänomen Böhlau Verlag, 2012, 468 Seiten, gebunden, 978-3-412-20953-7 85,00 EUR |
Papsttum im
mittelalterlichen Europa Band 1 Gegenpäpste durchziehen die Kirchengeschichte von der Spätantike bis zum Ende des Mittelalters. Dabei ist der mehrdeutige Begriff zugleich zeitgenössisches Stigma und Urteil „ex post“. Er schließt die so Bezeichneten aus der historischen Reihe der Nachfolger Petri aus und raubt ihnen plakativ jede Legitimation. Der Band unternimmt erstmals den Versuch, die teils hartnäckig geführten Konkurrenzkämpfe um das römische Bischofsamt systematisch zu beleuchten: Kommunikations-, Handlungs- und Legitimationsstrategien der Protagonisten sowie die Wahrnehmungsmuster der Zeitgenossen stehen im Mittelpunkt. In dieser Perspektive bilden die „Gegenpäpste“ gleichsam Prüfsteine, an denen Reichweite und Fragilität des universalen Autoritätsanspruchs des mittelalterlichen Papsttums sichtbar werden. Leseprobe |