| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Forschung zur Kirchenrechtswissenschaft, Echter Verlag | Jus Ecclesiasticum, Mohr Siebeck | Kirchenrecht | Kirchenrechtliche Studien, Kirchenrechtliche Bibliothek, LIT Verlag | Mainzer Beiträge zum Kirchen- und Religionsrecht | Münchener Theologische Studien, Kanonistische Abteilung | Religionsrechtliche Studien, TVZ |
|
Jus Ecclesiasticum, Claudius Verlag / Mohr Siebeck |
||
|
Jus Ecclesiasticum Herausgegeben von Axel Frhr. von Campenhausen, Michael Frisch, Michael Germann, Martin Heckel, Hans Michael Heinig, Christoph Link, Gerhard Tröger und Heinrich de Wall (geschäftsführend) Die Schriftenreihe Jus Ecclesiasticum. Beiträge zum evangelischen Kirchenrecht und Staatskirchenrecht (JusEccl) widmet sich der Erforschung von Grundsatzproblemen und Sonderfragen des modernen Religionsrechts in einer pluralistischen Gesellschaft, das einerseits in den Religionsgemeinschaften – besonders in den evangelischen Kirchen, ihren Zusammenschlüssen und ihren ökumenischen Verbindungen – und andererseits im freiheitlich-demokratischen Kultur- und Sozialstaat entstand und gilt. Die Reihe sucht besonders die differenzierten Zusammenhänge und Unterschiede zwischen der Rechtsgeschichte und dem Rechtssystem, den theologischen und den juristischen Prinzipien, den geistesgeschichtlichen Ursprüngen und rechtsvergleichenden Gegenbildern, der Theorie und der Praxis dieser Rechtsgebiete zu klären. Liste der lieferbaren Titel Januar 2019, pdf |
||
 |
Friedrich Lutz Vom Recht zur Berechtigung Subjektivierung des Rechts und Überindividualisierung des Rechtsschutzes am Beispiel des "Grundrechts auf Sonntag" Mohr Siebeck, 2020, 394 Seiten, Hardcover, 978-3-16-159596-7 99,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum,
Band 123 Das "Grundrecht auf Sonntag" ist das jüngste in einer Reihe von "Rechten", die das Bundesverfassungsgericht in freier richterlicher Rechtsschöpfung einer Zusammenschau verschiedener Verfassungsbestimmungen entnimmt. Darauf haben zuletzt die Kirchen und Gewerkschaften eine Vielzahl von Rechtsbehelfen insbesondere gegen sonntägliche Ladenöffnungen gestützt. Lutz Friedrich untersucht, wie diese und andere Normenverbindungen bis weit in den Bereich des objektiven Rechts hinein und abseits der bekannten dogmatischen Muster subjektive öffentliche Rechte und Klagerechte neu begründen. Er nimmt dabei nicht nur zu Detailfragen des Religionsverfassungsrechts Stellung, sondern stellt ausgehend vom Sonntagsschutz auch ganz grundlegende Erwägungen an zur Verfassungsdogmatik und zur Vergrundrechtlichung der Rechtsordnung sowie zu Fragen des gerichtlichen Rechtsschutzes und der Gewaltenteilung. Dazu gehört eine kritische Analyse faktischer Popular- und Verbandspopularklagen in den Bereichen Sonntag, Umwelt bzw. Klima und europäische Integration, die das geltende Prozessrecht durchbrechen und den freiheitlichen demokratischen Verfassungsstaat vor gewaltige Herausforderungen stellen. Das "Grundrecht auf Sonntag" ist das jüngste in einer Reihe von "Rechten", die das Bundesverfassungsgericht in freier richterlicher Rechtsschöpfung einer Zusammenschau verschiedener Verfassungsbestimmungen entnimmt. Darauf haben zuletzt die Kirchen und Gewerkschaften eine Vielzahl von Rechtsbehelfen insbesondere gegen sonntägliche Ladenöffnungen gestützt. Lutz Friedrich untersucht, wie diese und andere Normenverbindungen bis weit in den Bereich des objektiven Rechts hinein und abseits der bekannten dogmatischen Muster subjektive öffentliche Rechte und Klagerechte neu begründen. Er nimmt dabei nicht nur zu Detailfragen des Religionsverfassungsrechts Stellung, sondern stellt ausgehend vom Sonntagsschutz auch ganz grundlegende Erwägungen an zur Verfassungsdogmatik und zur Vergrundrechtlichung der Rechtsordnung sowie zu Fragen des gerichtlichen Rechtsschutzes und der Gewaltenteilung. Dazu gehört eine kritische Analyse faktischer Popular- und Verbandspopularklagen in den Bereichen Sonntag, Umwelt bzw. Klima und europäische Integration, die das geltende Prozessrecht durchbrechen und den freiheitlichen demokratischen Verfassungsstaat vor gewaltige Herausforderungen stellen. (Literatur zum Dritten Geobt, Du sollst den Feiertag heiligen) |
 |
Sina Haydn-Quindeau Die kirchliche Mittelstufe Eine rechtsvergleichende Analyse der Organisationsstrukturen der Mittleren Ebene im Verfassungsaufbau der Evangelischen Landeskirchen in Deutschland Mohr Siebeck, 2020, 201 Seiten, Hardcover, 978-3-16-159707-7 69,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum,
Band 122 Die Mittlere Ebene der evangelischen Landeskirchen zwischen Kirchengemeinden und landeskirchlicher Leitung hat in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewonnen. Vielfältige Kompetenzen wurden sowohl von den Kirchengemeinden als auch von den Landeskirchenleitungen auf die Mittlere Ebene verlagert. Sina Haydn-Quindeau analysiert die Organstrukturen und Handlungsfelder der Mittleren Ebene der 20 weitgehend autonomen landeskirchlichen Rechtsordnungen rechtsvergleichend, wobei sie die verschiedenen Regelungen strukturiert und in Leitungsmodelle zusammenfasst. Sie hinterfragt die Unterschiede zwischen den Landeskirchen bezüglich ihrer Ursprünge in Konfession, Tradition und Strukturbedingungen. Sich dabei stellende Grundlagenfragen erörtert sie anhand ihrer historischen, theologischen und juristischen Hintergründe. Die Mittlere Ebene der evangelischen Landeskirchen zwischen Kirchengemeinden und landeskirchlicher Leitung hat in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewonnen. Vielfältige Kompetenzen wurden sowohl von den Kirchengemeinden als auch von den Landeskirchenleitungen auf die Mittlere Ebene verlagert. Sina Haydn-Quindeau analysiert die Organstrukturen und Handlungsfelder der Mittleren Ebene der 20 weitgehend autonomen landeskirchlichen Rechtsordnungen rechtsvergleichend, wobei sie die verschiedenen Regelungen strukturiert und in Leitungsmodelle zusammenfasst. Sie hinterfragt die Unterschiede zwischen den Landeskirchen bezüglich ihrer Ursprünge in Konfession, Tradition und Strukturbedingungen. Sich dabei stellende Grundlagenfragen erörtert sie anhand ihrer historischen, theologischen und juristischen Hintergründe. |
 |
Hans-Michael Heinig Göttinger Gutachten IV Kirchenrechtliche Gutachten in den Jahren 2008-2020. Erstattet vom Kirchenrechtlichen Institut der EKD Mohr Siebeck, 2021, 664 Seiten, Hardcover, 978-3-16-159855-5 129,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum,
Band 121 Dieser Band dokumentiert Gutachten, die das Kirchenrechtliche Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland in den Jahren 2008-2020 zu Grundsatzproblemen des Kirchen- und Staatskirchenrechts erstattet hat. Die Beiträge in diesem Band reichen von Grundsatzfragen bis zu der Arbeit am Detail. Manche behandeln praxisrelevante Spezialprobleme, zu denen sich oft bislang kein anderes Schrifttum finden lässt. Andere, wie etwa Stellungnahmen für Gerichtsverfahren, sind von generellem rechtswissenschaftlichem Interesse und haben teils auch einen stärker dokumentarischen Charakter. Die Themengebiete der Untersuchungen sind: Kirchenverfassung - Organisationsrecht, Selbständigkeit der Kirchengemeinden - Kirchliches Dienst- und Arbeitsrecht - Kirchliches Finanz- und Haushaltsrecht - Diakonie, Werke und Einrichtungen - Kirchengut, Staatsleistungen, Baulast, Patronat - Stiftungen - Staatskirchenrechtliche Einzelfragen. Dieser Band dokumentiert Gutachten, die das Kirchenrechtliche Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland in den Jahren 2008-2020 zu Grundsatzproblemen des Kirchen- und Staatskirchenrechts erstattet hat. Die Beiträge in diesem Band reichen von Grundsatzfragen bis zu der Arbeit am Detail. Manche behandeln praxisrelevante Spezialprobleme, zu denen sich oft bislang kein anderes Schrifttum finden lässt. Andere, wie etwa Stellungnahmen für Gerichtsverfahren, sind von generellem rechtswissenschaftlichem Interesse und haben teils auch einen stärker dokumentarischen Charakter. Die Themengebiete der Untersuchungen sind: Kirchenverfassung - Organisationsrecht, Selbständigkeit der Kirchengemeinden - Kirchliches Dienst- und Arbeitsrecht - Kirchliches Finanz- und Haushaltsrecht - Diakonie, Werke und Einrichtungen - Kirchengut, Staatsleistungen, Baulast, Patronat - Stiftungen - Staatskirchenrechtliche Einzelfragen. |
|
Elias Bornemann Die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates Mohr Siebeck, 2020, 306 Seiten, Hardcover, 978-3-16-159238-6 89,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum,
Band 120 Die religiös-weltanschauliche Neutralität ist der ""Schlüsselbegriff"" des deutschen Religionsverfassungsrechts. Trotz seiner zentralen Stellung bestehen erhebliche Unsicherheiten über den genauen Bedeutungsgehalt dieses Verfassungsgrundsatzes. Um eine möglichst ganzheitliche Betrachtung zu ermöglichen, nähert sich Elias Bornemann dem Neutralitätsgebot von mehreren Seiten. Er erarbeitet die historischen Grundlagen des Rechtsbegriffs, beleuchtet Bezüge zur politischen Philosophie und schafft rechtsdogmatische Anknüpfungspunkte. Hierauf aufbauend werden in Rechtsprechung und Wissenschaft verschiedene Konzepte religiös-weltanschaulicher Neutralität identifiziert und sowohl auf ihre Verfassungsmäßigkeit als auch ihre Leistungsfähigkeit hin untersucht. Die Ordnungs- und Analyseleistungen dieser Arbeit sind damit Struktur und Anleitung für die künftige Diskussion über das verfassungsrechtliche Verhältnis von Staat und Religion. Die religiös-weltanschauliche Neutralität ist der ""Schlüsselbegriff"" des deutschen Religionsverfassungsrechts. Trotz seiner zentralen Stellung bestehen erhebliche Unsicherheiten über den genauen Bedeutungsgehalt dieses Verfassungsgrundsatzes. Um eine möglichst ganzheitliche Betrachtung zu ermöglichen, nähert sich Elias Bornemann dem Neutralitätsgebot von mehreren Seiten. Er erarbeitet die historischen Grundlagen des Rechtsbegriffs, beleuchtet Bezüge zur politischen Philosophie und schafft rechtsdogmatische Anknüpfungspunkte. Hierauf aufbauend werden in Rechtsprechung und Wissenschaft verschiedene Konzepte religiös-weltanschaulicher Neutralität identifiziert und sowohl auf ihre Verfassungsmäßigkeit als auch ihre Leistungsfähigkeit hin untersucht. Die Ordnungs- und Analyseleistungen dieser Arbeit sind damit Struktur und Anleitung für die künftige Diskussion über das verfassungsrechtliche Verhältnis von Staat und Religion. |
|
 |
Rudolf Smend Abhandlungen zum Kirchen- und Staatskirchenrecht Hrsg. v. Hans Michael Heinig, Hendrik Munsonius u. Jens Reisgies Mohr Siebeck, 2019, 260 Seiten, Leinen 978-3-16-156613-4 60,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum, Band 119 Rudolf Smend zählt zu den bedeutenden Staatskirchen- und Kirchenrechtlern der jungen Bundesrepublik. Dieser Band realisiert seinen Plan, verstreut veröffentlichte Beiträge zum Kirchen- und Staatskirchenrecht parallel zu seinen »Staatsrechtlichen Abhandlungen« gebündelt der Leserschaft zur Verfügung zu stellen. Als Gründungsleiter des Kirchenrechtlichen Instituts nahm Smend an der Neuvermessung dieser Rechtsgebiete teil und machte Einsichten aus dem Kirchenkampf fruchtbar. Breite historische Kenntnis und hohe Sensibilität für die Problemlagen kennzeichnen seinen Stil. Smend legte keinen in sich geschlossenen Entwurf vor, sondern erörterte akute Fragestellungen. Die Beiträge sind nicht nur von wissenschaftsgeschichtlichem Interesse, sondern vermitteln bis heute maßgebliche Einsichten zum Verhältnis von Staat und Kirche, zum Körperschaftsstatus, zum kirchlichen Verfassungsrecht und zu Methodenfragen im Kirchenrecht. |
 |
Christoph Link Gesammelte Abhandlungen zu Geschichte und Gegenwart des Rechts in Staat und Kirche Hrsg. v. Heinrich de Wall u. Michael Germann Mohr Siebeck, 2020, 1594 Seiten, Leinen 978-3-16-153703-5 220,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum
Band 118 Mit einer großen Zahl grundlegender Arbeiten hat Christoph Link das evangelische Kirchen- und das Staatskirchenrecht mit ihren Grenzgebieten sowie die Verfassungs- und Geistesgeschichte des öffentlichen Rechts nachhaltig beeinflusst. Tiefe geistes- und verfassungshistorische Fundierung als Grundlage eines juristisch tragfähigen Ausgleichs widerstreitender Positionen zeichnet auch seine Arbeiten zu Problemen des geltenden Rechts aus. Neben Arbeiten zu den historischen und geistigen Grundlagen des kirchlichen und des staatlichen Rechts stehen Beiträge zu nach wie vor aktuellen Themen. Sie reichen von der Zulässigkeit religiöser Symbole in Klassenzimmern über die Voraussetzungen der Verleihung des Körperschaftsstatus´ an nichtchristliche Religionsgemeinschaften bis hin zu Fragen des Medienrechts oder des Grundrechtsschutzes für Sozialversicherungsträger. Die Vielfalt der juristischen Arbeitsgebiete spiegelt die Weite von Links wissenschaftlichem Horizont. Die Verbindung juristischer Dogmatik mit historischen Perspektiven und, wo angebracht, theologischen Bezügen ist charakteristisch für sein wissenschaftliches Profil. Der vorliegende Band macht die wichtigsten, an verschiedenen und nicht immer leicht zugänglichen Orten veröffentlichten Arbeiten Links neu zugänglich. |
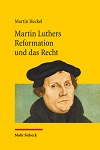 |
Martin Heckel Martin Luthers Reformation und das Recht Die Entwicklung der Theologie Luthers und ihre Auswirkung auf das Recht unter den Rahmenbedingungen der Reichsreform und der Territorialstaatsbildung im Kampf mit Rom und den »Schwärmern« Mohr Siebeck, 2016, 998 Seiten, Broschur, 978-3-16-154468-2 29,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum,
Band 114 Die Entwicklung des evangelischen Kirchenrechts und des Staatskirchenrechts in Deutschland seit Beginn der Reformation ist nur aus der steten Wechselwirkung der juristischen Probleme und Dynamik mit ihren theologischen und politischen Ursachen und Folgen zu erfassen. Erst durch ihre Umsetzung in Rechtsformen führen die geistigen und gesellschaftlichen Kräfte und Bewegungen zur umwälzenden Veränderung oder beharrlichen Verfestigung ihrer Epoche. Durch seine rechtshistorischen Aspekte und Analysen will dieses Werk auch den theologischen und historischen Nachbardisziplinen dienen, auf deren Vorarbeiten es fußt. Es ist problemgeschichtlich ausgerichtet. Es sucht die Entstehung und Wandlung der rechtlichen Institutionen aus den geistlichen und weltlichen Ursprüngen, die dem modernen Empfinden fremd geworden sind, verständlich zu machen und zugleich das Bewußtsein der Kontinuität zu stärken, die unsere pluralistische Geisteswelt und Rechtsordnung mit ihren geschichtlichen Wurzeln verbindet und bis heute prägt und bedingt. Es erstrebt keine handbuchartige Vollständigkeit. Manche Phänomene werden daher detailliert in Nahsicht, andere distanziert im Überblick behandelt. Im Aufbau wechselt es zwischen der chronologischen Schilderung des Geschehens und der systematischen Darstellung der Probleme und Institutionen, um weder auf narrative Anschaulichkeit noch auf systematische Exaktheit zu verzichten. Zeitliche Vorgriffe und Rückblenden, auch Wiederholungen, sind deshalb unvermeidlich. Querverweise wollen die abschnittsweise Lektüre erleichtern. Ausblicke auf die Gegenwart wurden nicht gescheut. Die Individualität geschichtlicher Erscheinungen gewinnt durch historische Rechtsvergleichung ohne Nivellierung an Profil. In diesem Buch kommt Luther selbst zu Wort. Mit ausführlichen Zitaten seiner Schriften will es den Theologen, Historikern und Juristen als einschlägiges Luther-Lesebuch dienen. (Aus dem Vorwort) |
 |
Julia Lutz-Bachmann Mater rixarum? Verträge des Staates mit jüdischen und muslimischen Religionsgemeinschaften Mohr Siebeck, 2016, 589 Seiten, Hardcover, 978-3-16-153416-4 109,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum,
Band 110 Staatskirchenverträge mit den großen christlichen Kirchen sind ein altes und vielerprobtes Instrument zur Koordination ihrer jeweiligen Rechte und Interessen, waren aber immer auch Gegenstand des Streits: " Concordatum - mater rixarum ". Julia Lutz-Bachmann widmet sich der verfassungsrechtlichen Untersuchung der Fortentwicklung des Staatskirchenvertragsrechts hin zu einem paritätischen Religionsverfassungsvertragsrecht insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aufbauend auf einer historischen Herleitung und einer Beleuchtung der grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Probleme dieses Rechtsgebiets analysiert sie Inhalte und verfassungsrechtliche Implikationen von Verträgen des Staates mit jüdischen und muslimischen Gemeinschaften. Im Ergebnis zeigt sich, dass der religionsverfassungsrechtliche Vertrag zwar " mater rixarum " bleibt, er sich aber auch unter den Bedingungen einer pluralen religiösen Landschaft neu bewährt und durch die Herstellung von Einzelfallgerechtigkeit vielfältige Chancen zu Ausgleich und Befriedung im freundlich-fördernden neutralen Staat birgt. Inhaltsverzeichnis |
 |
Hans Ulrich Anke Die Neubestimmung des Staat-Kirche-Verhältnisses in den neuen Ländern durch Staatskirchenverträge Zu den Möglichkeiten und Grenzen des staatskirchenvertraglichen Gestaltungsinstruments Mohr Siebeck, 2000, 451 Seiten, Hardcover, 978-3-16-147319-7 59,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum Band
62 Nach der Wiedervereinigung stellte sich Staat und Kirchen in den neuen Ländern die Aufgabe, ihr Verhältnis zueinander im Rahmen der freiheitlichen Ordnung des Grundgesetzes von Grund auf neu zu gestalten. Hans Ulrich Anke arbeitet die rechtlichen Möglichkeiten heraus, die der Staatskirchenvertrag als eingeführtes Gestaltungsinstrument dem Staat, den Kirchen und den Jüdischen Verbänden bietet, um ihre staats- bzw. kirchenpolitischen Ziele umzusetzen. Zunächst erarbeitet Hans Ulrich Anke die gemeinsamen Gestaltungsanliegen von Staat und Kirche, bevor er dann ihre Umsetzung in den neuen Staatskirchenverträgen anhand von vier grundlegenden Funktionen darstellt: der Förderfunktion, der Absicherungsfunktion, der Kooperationsfunktion und der Einbindungsfunktion. Damit lassen sich Rechtsnatur und Wirkungsweise der Staatskirchenverträge teilweise neu bestimmen. Die staatskirchenvertraglichen Bindungen stellen innerstaatliches Staatsvertragsrecht dar. Es ermöglicht auf der einen Seite eine Bindung des staatlichen Gesetzgebers zugunsten des kirchlichen Vertragspartners, die zwar einem eingeschränkten Gemeinwohlvorbehalt unterliegt, im übrigen aber verfassungsgerichtlich durchsetzbar ist. Auf der anderen Seite erlaubt es auch eine weitgehende Einbindung des kirchlichen Wirkens in die staatliche Aufgabenwahrnehmung sowie eine differenzierte kulturstaatliche Kirchenpolitik des säkularen Staates. Außerdem setzt sich Hans Ulrich Anke mit den aktuellen Problemen und Streitigkeiten bei der Auslegung und Anwendung der einzelnen Vertragsbestimmungen in der staatskirchenrechtlichen Praxis auseinander. Nach der Wiedervereinigung stellte sich Staat und Kirchen in den neuen Ländern die Aufgabe, ihr Verhältnis zueinander im Rahmen der freiheitlichen Ordnung des Grundgesetzes von Grund auf neu zu gestalten. Hans Ulrich Anke arbeitet die rechtlichen Möglichkeiten heraus, die der Staatskirchenvertrag als eingeführtes Gestaltungsinstrument dem Staat, den Kirchen und den Jüdischen Verbänden bietet, um ihre staats- bzw. kirchenpolitischen Ziele umzusetzen.Zunächst erarbeitet Hans Ulrich Anke die gemeinsamen Gestaltungsanliegen von Staat und Kirche, bevor er dann ihre Umsetzung in den neuen Staatskirchenverträgen anhand von vier grundlegenden Funktionen darstellt: der Förderfunktion, der Absicherungsfunktion, der Kooperationsfunktion und der Einbindungsfunktion. Damit lassen sich Rechtsnatur und Wirkungsweise der Staatskirchenverträge teilweise neu bestimmen. Die staatskirchenvertraglichen Bindungen stellen innerstaatliches Staatsvertragsrecht dar. Es ermöglicht auf der einen Seite eine Bindung des staatlichen Gesetzgebers zugunsten des kirchlichen Vertragspartners, die zwar einem eingeschränkten Gemeinwohlvorbehalt unterliegt, im übrigen aber verfassungsgerichtlich durchsetzbar ist. Auf der anderen Seite erlaubt es auch eine weitgehende Einbindung des kirchlichen Wirkens in die staatliche Aufgabenwahrnehmung sowie eine differenzierte kulturstaatliche Kirchenpolitik des säkularen Staates.Außerdem setzt sich Hans Ulrich Anke mit den aktuellen Problemen und Streitigkeiten bei der Auslegung und Anwendung der einzelnen Vertragsbestimmungen in der staatskirchenrechtlichen Praxis auseinander. |
| Wolfgang Bock Das für alle geltende Gesetz und die kirchliche Selbstbestimmung Mohr, 1995, 360 Seiten, Leinen, 3-16-146492-3 978-3-16-146492-8 64,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum Band 55: Eine verfassungsrechtliche Untersuchung am Beispiel des Amtsrechts der evangelischen Kirchen |
|
 |
Wilhelm Maurer Die Kirche und ihr Recht Jus Ecclesiasticum Band 23 Mohr Siebeck, 1976, 590 Seiten, 1010 g, Leinen, Schutzumschlag, 3-16-637702-6 20,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum Band
23 Schutzumschlag eingerissen, Leineneinband mit leichten Alterungsspuren, Buchblock wenig / nicht gebraucht Die im Verlauf des Kirchenkampfes offenbar gewordene Problematik der traditionellen Grundlegung evangelischen Kirchenrechtes wurde für Wilhelm Maurer zum Ausgangspunkt seines Nachdenkens über den Zusammenhang von Kirche und Recht. Der vorliegende Band vereinigt alle wesentlichen, zwischen 1937 und 1968 zu diesem Thema publizierten Beiträge. Der gegenwärtigen Problematik will Maurer auch dort dienen, wo er sich der Geschichte des Kirchenrechts zuwendet. Dabei geht es ihm in erster Linie um den Aufweis von Notwendigkeit und Möglichkeit eines in den Bekenntnissen der Reformation gründenden Rechts der lutherischen Kirche. Einen weiteren Schwerpunkt legt er auf den Versuch, durch Klärung des aus dem 19. Jahrhundert übernommenen Erbes das Kirchenrecht zu einem besseren Verständnis seiner selbst zu bringen und für die Bewältigung der heute gestellten Aufgaben freizusetzen. Dem gleichen Ziel wollen jene Arbeiten dienen, die sich unter Verarbeitung der Erfahrungen des Kirchenkampfes unmittelbar dem bestehenden und neu zu schaffenden Recht der Kirche zuwenden. Der Band bietet damit eine Art Organon theologisch reflektierten Kirchenrechtes, das schon Auswirkungen gezeitigt hat, aber auch für die Zukunft fruchtbar zu machen ist. Sehr verehrter, lieber Herr Maurer! Sie gehören zu den wenigen evangelischen Theologen, die das früher intensiv geführte Gespräch mit der Jurisprudenz aufgenommen haben. Dabei haben Sie es stets verstanden, das Proprium Ihrer Disziplin in die Diskussion einzubringen. Ob es um die Bedeutung des Bekenntnisses, des Amtes oder der Sakramente für die Gestalt und damit für die Rechtsfragen der Christenheit ging, stets haben Sie die Wechselbeziehung zwischen Rechtswissenschaft und Theologie aufzuzeigen gewußt. Dieser Fragestellung wird heute im Bereich der evangelischen Theologie nicht das Gewicht beigemessen, das ihr gebührte. Wenn nun zu Ihrem 75. Geburtstag Ihre wichtigsten Aufsätze aus diesem Gebiet in einer kirchenrechtlichen Reihe vorgelegt werden, so wird darin deutlich, welche Beachtung Ihre Arbeiten auch und gerade im juristischen Bereich finden. Dieser Gruß zu Ihrem Geburtstag möge - so hoffen und wünschen wir - ermuntern, das Gespräch zwischen evangelischer Theologie und Rechtswissenschaft wieder intensiver zu führen. Wir denken, daß dies Ihren Intentionen am meisten entspricht. Denn es ging Ihnen in Ihrer Arbeit in Kirche und Theologie stets um die Sache, nicht um Ihre Person. Wir sind sicher, daß wir im Namen all Ihrer dankbaren Schüler, der Sie schätzenden Kollegen und Sie liebenden Freunde sprechen, wenn wir Ihnen Gottes Segen für Ihren weiteren Lebensweg wünschen. Erlangen, den 7. Mai 1975 Ihre Gerhard Müller und Gottfried Seebaß |
 |
Rudolf Smend Kirchenrechtliche Gutachten in den Jahren 1946 - 1969, Claudius Verlag / Mohr Siebeck, 1972, 387 Seiten, kartoniert, 978-3-16-637131-3 44,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum Band 14 Erstattet vom Kirchenrechtlichen Institut der Evang. Kirche in Deutschland, Göttingen, unter der Leitung von Rudolf Smend |
 |
Ernst-Lüder Solte Theologie an der Universität Claudius Verlag / Mohr Siebeck, 1971, 320 Seiten, kartoniert, 978-3-16-637121-4 32,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum Band 13 Staats- und kirchenrechtliche Probleme der theologischen Fakultäten |
 |
Thomas Pieter Wehdeking Die Kirchengutsgarantien Claudius Verlag / Mohr Siebeck, 1971, 258 Seiten, kartoniert, 978-3-16-637111-5 34,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum Band 12 Die Kirchengutsgarantien und die Bestimmungen über die Leistungen der öffentlichen Hand an die Religionsgesellschaften im Verfassungsrecht des Bundes und der Länder |
 |
Uvo Andreas Wolf Jus divinum Claudius Verlag / Mohr Siebeck, 1970, 230 Seiten, kartoniert, 978-3-16-637101-6 27,00 EUR |
Jus Ecclesiasticum Band 11: Erwägungen zur Rechtsgeschichte und Rechtsgestaltung |
 |
Uvo Andreas Wolf Jus divinum Claudius Verlag / Mohr Siebeck, 1970, 230 Seiten, kartoniert, 978-3-16-637101-6 27,00 EUR |
Band 11: Erwägungen zur Rechtsgeschichte und Rechtsgestaltung |
 |
Martin Daur Die eine Kirche und das zweifache Recht Claudius Verlag / Mohr Siebeck, 1970, 200 Seiten, kartoniert, 978-3-16-637081-1 27,00 EUR |
Band 9: Eine Untersuchung zum Kirchenbegriff und der Grundlegung kirchlicher Ordnung in der Theologie Schhleiermachers. |
| Klaus Schlaich Kollegialtheorie Claudius Verlag / Mohr Siebeck, 1969, 328 Seiten, kartoniert, 978-3-16-637071-2 34,00 EUR |
Band 8 Kirche, Recht und Staat in der Aufklärung |
|
| Irmtraut Tempel Bischofsamt und Kirchenleitung in den lutherischen, reformierten und unierten deutschen Landeskirchen Claudius Verlag / Mohr Siebeck, 1966, 192 Seiten, kartoniert, 978-3-16-637031-6 20,00 EUR |
Band 4 | |
| Christoph Link Die Grundlagen der Kirchenverfassung im Luth. Konfessionalismus des 19. Jahrhunderts insbesondere bei Theodosius Harnack Claudius Verlag / Mohr Siebeck, 288 Seiten, Kartoniert, 978-3-16-637021-7 27,00 EUR |
Band 3 | |
| Gerhard Tröger Das Bischofsamt in der evangelisch-lutherischen Kirche Claudius Verlag / Mohr Siebeck, 1966, 155 Seiten, kartoniert, 978-3-16-637011-8 19,00 EUR |
Band 2 | |
 |
Dietrich Pirson Universalität und Partikularität der Kirche Claudius Verlag / Mohr Siebeck, 343 Seiten, kartoniert |
Band 1: Die Rechtsproblematik zwischenkirchlicher Beziehungen |