| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Kleine Reihe Religion | Religion für kleine Leute |
| Religion für kleine Leute, Ernst Kaufmann Verlag | ||
|
Eine Bilderbuchreihe, die 4-8jährige
Kinder zu einer ersten Begegnung mit dem christlichen Glauben führt. |
||
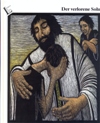 |
Regine Schindler Der verlorene Sohn Ernst Kaufmann Verlag, 1994, 26 Seiten, gebunden, 21 x 25,5 cm 3-7806-2306-4 4,90 EUR |
Religion für kleine Leute Nachwort für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher Das Gleichnis vom verlorenen Sohn gehört im Lukasevangelium (Lukas 15, 11-32) eng zusammen mit den beiden anderen Gleichnissen, die Gottes Freude über die Rettung des Verlorenen ausdrücken: dem Gleichnis vom verlorenen Schaf (15,3-7) und jenem von der verlorenen Drachme (15,8-10). Mit den drei Gleichnissen antwortet Jesus auf die Entrüstung der Pharisäer, die sich darüber ärgern, daß er Zöllner und Sünder aufnimmt und mit ihnen ifšt. Die Gleichnisse sind aber nicht einfach Verteidigungsreden. Sie drücken aus, wie es im Gottesreich ist: Gott kümmert sich - wie Jesus - um die Verlorenen zuerst. Er freut sich über die Umkehr, über das Auffinden oder Zurückholen der „Verlorenen“ mehr als über alle Rechtschaffenheit. Nun ist, ganz besonders im Hinblick auf Kinder, die Vielschichtigkeit unseres Textes und seiner Deutung kompliziert. Andererseits scheint es, gerade im Sinn moderner Gleichnistheorien, gar nicht nötig, ja nicht einmal richtig, die Gleichnisse zu deuten, in unsere Welt hinein zu „übersetzen“. Die Gleichnisse sprechen für sich selbst. Beim Erzählen, beim Vorlesen, beim Betrachten der Bilder werden sie im Kind lebendig. Die Geschichte vom verlorenen Sohn hat zwei Teile. Es ist die Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Beide stehen in ihrer völlig verschiedenartigen Verlorenheit dem aktiven, initiativen Vater gegenüber. Der Vater aber mit seiner Freude, seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe steht im Mittelpunkt der beiden Sohn-Geschichten und verbindet sie zu einer überzeugenden. Erzählung mit zwei Gipfelpunkten. Sie spricht uns als zwei „Typen“ von verlorenen Menschen an. Oder aber: Wir entdecken in uns Züge beider Söhne. Es wäre darum nicht richtig, im älteren Bruder nur ein Abbild der Pharisäer zu sehen. Im Hinblick auf die Fragen größerer Kinder oder auf Gespräche, die sich mit ihnen ergeben, seien hier einige Informationen beigefügt: - Zum Problem der Erbteilung: Im Normalfall erbte der ältere Sohn den Bauernhof. Dem jüngeren stand nach damaligem Recht ein Drittel des väterlichen Besitzes zu. In der Regel hatte aber der Vater bis zu seinem Tod die Nutznießung des Ganzen. Es spricht für die Großzügigkeit dieses Vaters, daß er zu seinen Lebzeiten teilt und dem jüngeren Sohn eine Abfindung gibt. Rechtlich verliert der jüngere Sohn damit alle Ansprüche, auch auf Nahrung und Kleidung. - Zum Ausziehen des jüngeren Sohns: Ein sehr großer Teil der Juden lebte damals in der „Diaspora“, also außerhalb von Palästina. Möglicherweise War es für einen Vater durchaus auch positiv, wenn der jüngere Sohn sich außerhalb des armen Berglandes eine neue Existenz aufbauen wollte. - Zum Schweinehüten: Schweine waren für die Juden unreine Tiere. Die Arbeit als Schweinehirt bedeutete also eine totale menschliche und religiöse Erniedrigung. - Zum Bekenntnis der Sünde (Verse 18 und 21, resp. S. 12 und 16): Im Hinblick auf jüngere Kinder habe ich die Wendung „ich habe gesündigt“ nicht gebraucht. Es schien mir Wichtig, die Geschichte nicht mit dogmatisch-theologischen Begriffen zu belasten. Im „Böse-Sein“ und im Satz „Es tut mir leid“ klingt das Thema von Sünde und Sündenvergebung an, ohne daß die schwierigen Wörter gebraucht werden. Das Gleichnis als Ganzes bringt das Lob des Gottesreichs, in dem alle Sünde vergeben wird, besser zum Ausdruck als das Erklären oder Betonen dieser Stellen. - Zum Verlorensein des jüngeren Sohnes: Er ist tatsächlich - nicht im moralischen Sinn - verloren. Als Schweinehirt hat er alles verloren. Die Erinnerung an den Vater ist das einzige, was ihm bleibt. Andererseits hat der Vater ihn verloren; er wußte nichts mehr von seiner Existenz und erkennt bei der Rückkehr, daß der Sohn nicht nur für ihn außer Sichtweite, sondern objektiv verloren war. Der Gegensatz von „verloren“ und wiedergefunden (oder „wieder da“) ist so stark, daß ihm der Gegensatz tot - lebendig entspricht. - Vorsichtig wurde das Gleichnis, im Sinne einer besseren Anschaulichkeit, für die Kinder etwas erweitert. Auf eine grundsätzliche Übersetzung in das Umfeld und die Sprache heutiger Welt wurde verzichtet. So bleibt (oder wird) die Welt Jesu ein Stück weit lebendig: eine Welt mit Knechten und Mägden, mit einer bäuerlichen Umgebung und alten jüdischen Bräuchen, in denen Vergebung eigentlich nicht vorgesehen ist - eine Welt, in der die Frauen kaum erwähnt werden. Daß Jesus im Gleichnis nicht nur von sich und seinem aufregenden, ja ärgerlichen Verhalten spricht, sondern von Gott und seinem Reich erzählt, wird im Text dieses Buches nicht ausdrücklich gesagt. Es kann sich aber im Gespräch mit Kindern, auch aus dem ergänzenden Erzählen der beiden anderen Gleichnisse aus Lukas 15 ergeben. Und es spricht aus der Erzählung als Ganzes: Mit dem Vater, dessen Liebe und Güte alle Gesetzmäßigkeiten dieser Welt über den Haufen wirft, ist Gott gemeint. Und Vielleicht ergibt es sich nach dem Hören oder Vorlesen, daß die Kinder es plötzlich für selbstverständlich halten, daß der ältere Sohn dann doch am Fest teilnimmt. Es wäre ein Zeichen dafür, daß die Botschaft Jesu auch heute zum Tragen kommen kann. R. S. Beispielseite Text Beispielseite Bild |
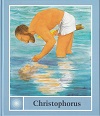 |
Regine Schindler Christophorus Ernst Kaufmann Verlag, 1985, 24 Seiten, 230 g, Glanzpappband, 19 x 22 cm 3-7806-0420-5 14,00 EUR |
Religion für kleine Leute Nachwort für Eltern und Erzieher Die Verehrung des Heiligen Christophorus [einer der 14 Nothelfer] ist zum ersten Mal im fünften Jahrhundert in Chalkedon (am Bosporus) bezeugt: Eine Kirche wurde ihm geweiht, er hatte im 3. Jahrhundert in Kleinasien gelebt und war als christlicher Märtyrer gestorben. Fürs 6. Jahrhundert wird eine Christophorus-Kapelle in Reims (Frankreich), um 600 ein Christophorus-Kult in Toledo (Spanien) bezeugt; ums Iahr 1000 taucht der Heiligenname in Konstantinopel sehr häufig auf, in der heutigen Schweiz wurde ihm zur gleichen Zeit das Hospiz in Pfäfers, das am Durchgangsverkehr von Süden nach Norden lag, geweiht. Im hohen Mittelalter spielte der Heilige in Meßgebeten eine stets wachsende Rolle. - Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Verehrung des Christophorus - als Beschützer des Verkehrs! - sehr populär. 1969 wurde er aus dem katholischen Festkalender gestrichen. Die knappen Daten zum Christophorus-Kult sind nichtssagend ohne die Legende, die dahinter steht, eine Legende, die märchenhafte Züge hat und an verschiedenen Orten, rund ums Mittelmeer, sehr verschiedenartig weitererzählt wurde. Eine historische „Vita”, eine Lebensbeschreibung des Christophorus, existiert -im Gegensatz etwa zu Martinus - nicht, wohl aber, neben der Legende, unzählige reizvolle bildliche Darstellungen. Luther nannte Christophorus „den christlichen Menschen schlechthin". In diesem Sinn kann er auch für Kinder zur Identifikationsfigur werden. Christophorus ist ein Riese, in der östlichen Variante der Geschichte, die wir hier berücksichtigt haben, hat er einen Hundekopf. Er heißt denn auch Reprobus - das bedeutet der „Verdammte”, der „Verruchte”. Mit der Taufe, durch seine Begegnung mit Christus legt er sein tierisches Wesen ab: Indem er Christ wird, wird er auch ein „richtiger“ Mensch. Allerdings ist dazu ein langer, gefährlicher Weg, zu dem stets von neuem ein Suchen und Aufbrechen gehört, nötig. Immer wieder neu will Reprobus den mächtigsten Herrscher suchen und ihm dienen. In diesem wiederholten Neubeginn, im Bestehen von Gefahren, auch in der Bereitschaft zu dienen, finden wir Märchenmotive, auch Wiederholungen, die eine große Eindringlichkeit der Geschichte bewirken. Auch die Tatsache, daß die Hilfe im Schwachen erscheint, vorerst in der Mitteilung des armen Einsiedlers, dann in Christus, der als kleines hilfloses Kind auftritt, ist einerseits ein Märchenzug, anderseits ein Zeichen für den christlichen Menschen, der nicht aufhört, nach Gott zu suchen und der dann in Christus den Retter findet: Christus, der arm ist, schwach, ganz bei den Menschen - anderseits König über die ganze Erde, stark, ein Helfer in der Not. Für diesen Reichtum wird der wunderbare Baum am Schluß der Legende zum Symbol. Es wäre gut, wenn Kinder anhand der Christophorus-Legende etwas von diesem Kontrast erleben und dann in ihr eigenes Leben mitnehmen Würden. Dies geschieht, so scheint mir, durch intensives Nacherleben der Geschichte, durch Betrachten der starken Bilder. Es geschieht im Innern, Vielleicht weitgehend im Unbewußten der Kinder. Eine bewußte „Anwendung”, eine gezielte Besprechung ist wohl kaum nötig. Beispielseite Text Beispielseite Bild |
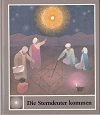 |
Regine Schindler Die Sterndeuter kommen Ernst Kaufmann Verlag, 1985, 26 Seiten, mit 13 Bildseiten, kartoniert, 3-7806-0421-3 9,00 EUR |
Religion für kleine Leute mit Bildern von Hilde Heyduck-Huth Nachwort für Eltern und Erzieher Sei es von Krippenfiguren, von Weihnachtsspielen oder von bunten Geschenkpapieren: Die Figuren, die zur Weihnachtsgeschichte gehören, sind den meisten Kindern bekannt: Engel, Hirten, Könige, der Stern und der Stall mit Maria, Iosef und dem Kind. Oft erscheinen in Spielen oder auf Bildern Hirten und Könige gleichzeitig an der Krippe. Es schien uns richtig, in diesem Buch ausschließlich der Weihnachtsgeschichte nach Matthäus (2. Kap.) zu folgen. Wahrend bei Lukas der Engel zu den Hirten kommt und damit die Ärmsten in der Nähe des Stalls als erste die frohe Botschaft erfahren, so sind es bei Matthäus im weit entfernten Babylonien wohnende Magier, die durch einen wunderbaren riesengroßen Stem auf das neugeborene Kind aufmerksam gemacht Werden. Erst im Lauf des Mittelalters wurden diese Männer - in Anlehnung an Prophezeiungen des Alten Testaments - zu Königen, erst später erhielten sie Namen: Kaspar, Melchior, Balthasar, erst lange nach der Niederschrift der Bibel Wurden sie zu drei Königen stilisiert, vermutlich wegen der drei in der Bibel erwähnten Gaben: Gold, Weihrauch, Myrrhe. An sich handelt es sich um eine Gruppe von Sterndeutern ohne angegebene Zahl. Es schien uns darum erlaubt, der Gruppe auch Zapor, das Kind eines der Magier beizugeben. Mit ihm können sich die kleinen Betrachter oder Leser der Geschichte identifizieren. Indem der Stern diesen babylonischen Gelehrten erscheint, wird gezeigt: Auch zu diesen ganz fernenVölkern, Heiden, kommt die Botschaft von Iesu Geburt. Mit dieser Geburt kommt also die Hoffnung für die ganze Menschheit, nicht nur für die luden, auf die Erde. Aber die fernen Magier haben gehört von den Schriften der luden, den Prophetenbüchern und Psalmen, in denen vom Friedensfürst, vom Retter aller Menschen die Rede ist. Darum wird der Stern für sie mehr als ein astronomisches Wunder oder eine astrologische Konstellation. Das Zeichen wird zu einem Signal für sie und bewegt sie zum Aufbrechen. In unserer Geschichte wiederholen sich darum einige Zeilen aus dem 72. Psalm, in denen vom Helfer oder Retter die Rede ist - einem König, zu dem alle gehören möchten, der allen hilft, wie der Regen in trockener Zeit. Die Magier machen sich auf einen gefährlichen und mühsamen Weg. Aber der Stern geht voran. Er zeigt den Weg und muntert zum Durchhalten auf. Die Geschichte ist voller Kontraste: Der mächtige Herodes ist nicht der gesuchte König - der gesuchte Retter aber ist arm, selbst hilfsbedürftig. Da, wo man ihn nicht suchen würde und wo es auch Herodes nicht alleine finden kann, ist das Kind zu finden. Es ist - die Reise der Sterndeuter hat lange gedauert - nicht mehr der Säugling in der Krippe wie im Lukas-Evangelium. Maria und Iosef haben ein Haus im Städtchen Bethlehem bezogen. Vermutlich geht Iosef hier seinem Zimmermannshandwerk nach, bis ihm im Traum der Weg nach Ägypten gezeigt wird. Äußerlich finden die Magier nach der langen Reise nichts Spektakuläres in Bethlehem. Fast könnte man mit ihnen enttäuscht sein. Sind nicht sie selbst mit ihren Geschenken das Aufregende in dieser armenWelt eines jüdischen Landstädtchens? Und dennoch: Sie beten das Kind an. Sie fallen auf die Knie - eine Geste, wie sie nur von einem großen Herrscher üblich ist. Sie sind erfüllt von der Gewißheit, daß dieser „ganz andere” König ihnen helfen wird. Sie wissen nicht wie - aber das stört sie nicht. „Wir danken dir, daß du da bist." Das ist die Hauptsache für sie. Vielleicht spüren die Kinder an Weihnachten etwas von dieser Sterndeuter-Hoffnung. Vielleicht sehen sie durch diese Geschichte auch im Schenken und Beschenktwerden einen neuen Sinn: Das eigentliche Geschenk für uns ist das arme Kind - und das Schenken ist es vor allem, das Freude bereitet. Es ist zu hoffen, daß Kinder wissen möchten, wie es weiter geht mit diesem Jesus, was sich hinter dem Satz „Er wird ein Helfer sein“ versteckt. Dadurch könnte diese Weihnachtsgeschichte Zum Anlaß werden, auch nach dem Fest weiterzuerzählen - vom erwachsenen Iesus, der ganz besonders auch zu jenen Menschen gekommen ist, die nicht so ganz dazugehören, aus dem Rahmen fallen, fremd sind wie die Sterndeuter aus dem fernen Babylonien. Beispielseite Text Beispielseite Bild |
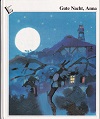 |
Regine Schindler Gute Nacht, Anna Von 11 Alltagsgeschichten aus wird eine Brücke zum Gebet geschlagen. Ernst Kaufmann Verlag, 1990, 24 Seiten, 24 Seiten mit zahrl. farb. Bildern, kartoniert, Großformat 3-7806-2303-X 6,00 EUR |
Religion für kleine Leute Mit Bildern von Ivan Gantschev Nachwort für Eltern und Kinder Jeden Abend erzählen sich Anna und ihre Eltern, was sie am Tag erlebt haben. Einmal ist es Anna, die beginnt, andere Male der Vater oder die Mutter: Kleine Geschichten von wichtigen, aber auch unscheinbaren Begebenheiten! Unmerklich kommt dabei jedes Mal ein anderes Thema zur Sprache: die Naturgewalten (in Blitz und Donner), die Wunder der sich stets erneuernden Erde (Samen im Frühling), unsere Nahrung (und der Hunger anderer!), die Dun kelheit der Nacht und der Mond (es gibt Dinge, die „nur halb zu sehen“ sind), I-Iund und Katze, Ausländer unter uns, Streit und Rollenfixierung (Kindergartenszene), „Was der Mensch alles kann“ (von der Feuerwehr bis zur Medizin), die Begegnung mit alten Menschen, unsere Beziehung zur Sprache, der Sonntag. Bei all diesen Themen geht es um das Verarbeiten von Erlebnissen des Tages - ein Vorgang, den man jedem Kind vor dem Schlafen wünschen möchte, auchwenn es auf improvisiertere Weise als in diesem Buch geschieht. Nach jeder kleinen Geschichte kommt von Annas Mutter oder Vater refrainartig die Frage: „Wollen wir die Geschichte hineinnehmen in unser Abendgebet?“ Darauf könnte ein schon bekanntes festgeformtes Kindergebet folgen, das durch das vorangehende Gespräch und die kleine Geschichte eine neue Dimension erhält. An sich sind wir, wenn wir beim Abendritual kindliches Leben und das Reden mit Gott zusammenbringen, schon im Mittelpunkt der christlichen Erziehung. Die hier vorliegenden Texte gehen einen Schritt weiter. Der Erwachsene, der mit dem Kind betet, stellt die betreffenden Inhalte ausdrücklich hinein in die Beziehung zu Gott und formt im Gebet das recht Spezielle kindlichen Erlebens um zum Allgemeinen, so daß aus dem Erzählen bewußtes Denken, Loben, Bitten und Fragen wächst. Dadurch wird nicht nur der vergangene Tag re?ektiert, sondern das Gottesbild des Kindes geformt. Kinder erfahren Gott, angefangen bei der Anrede im Gebet, immer wieder anders - als einen Gott, dem wir vieles zu verdanken haben, der seine Kinder liebt wie eine gütige Mutter, der uns beim Friedenschließen hilft, der in Jesus bei uns ist und uns ermuntert, Ungerechtigkeit zu sehen und zu verändern, Andersartige zu lieben. So werden hier kleine Gutenachtgeschichten, zusammen mit einem kindgemäßen Dialog und den Gebeten zu einem elementaren Glaubensunterricht, der sich einerseits im Alltag, andererseits in der Gebetshaltung aufgehoben weiß. Es wäre meine Hoffnung, daß Kinder und Erwachsene über die hier erzählten Geschichten hinaus - zwischen Erinnern und phantasievollem Erfinden - weitererzählen und dabei Stimmungen, Freuden, Ängste und Probleme zur Sprache - und vor Gott bringen, vorerst vermutlich in Worten, die Erwachsene für das Kind suchen. Dies verlangt gleichzeitig großes Einfühlungsvermögen und das Bekennen eigenen Glaubens. Es ist eine unbequeme und doch bereichernde Aufgabe, die Vater und Mutter, auch Großeltern und Erzieherinnen immer Wieder zum Nachdenken über den eigenen Standort führt. Nicht nur Erzählen, Reden und Beten ist dabei wichtig, sondern auch das gemeinsame meditative Stillesein. Dazu möchten die Bilder dieses Buches auf besondere Weise anregen. Sie wollen den Geschichten nicht weitere Einzelheiten beifügen, sondern dem Kind Stimmungen vermitteln, seine eigene Phantasiewelt öffnen, vertiefen und unprogrammiertes Weiterdenken ermöglichen. R.S. Beispielseite 1 Beispielseite 2 |
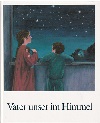 |
Waltraud M. Jacob Vater unser im Himmel Ein Bilderbuch mit einem Nachwort von Helmut Zechner Ernst Kaufmann Verlag, 1991, 16 Seiten, 2 Seiten Nachwort, 300 g, Gebunden, 21 x 25 cm 3-7806-2271-8 10,00 EUR |
Religion für kleine Leute Nachwort für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher Kinder begegnen schon in frühen Jahren dem Vaterunser, sei es im liturgischen Rahmen des Gottesdienstes oder bei gottesdienstlichen Handlungen wie Taufe, Trauung oder Beerdigung. Nicht wenige Eltern und Erzieher ziehen es aber beim Beten mit Kindern vor, auf das vielfältige Angebot an Kindergebeten zurückzugreifen, in denen Gebetsinhalte und -anliegen in kindgemäßer Form und Sprache und bedacht an der Vorstellungswelt des Kindes orientiert formuliert sind. Die Vielzahl und dichte Folge abstrakter Begriffe (Reich, Wille, Schuld, Versuchung, Kraft, Herrlichkeit usw.) hält sie davon ab, mit den Kindern in gleicher Weise das Vaterunser zu beten, obgleich diese schon früh erfassen, daß es mit diesem Gebet etwas Besonderes auf sich hat und es im Glaubensleben der Erwachsenen wichtig ist. Jesus hat das Vaterunser seinen jüngern und Anhängern als ›› Modell« vorgestellt, das anderes Beten gewiß nicht ausschließen und abwerten, aber als Beispiel, Anleitung und Regulativ - vor allem, was die Gebets/øaltmfzg betrifft - vor und über allem anderen Beten stehen soll: >›Wenn ihr betet..., sollt ihr so beten« (Matthäus 6,5-9a). Dieser Modellcharakter, den ]esus seinem Gebet beilegt, sollte eigentlich dazu ermutigen, es auch mit Kindern zu beten und die vielerlei Einwände, Bedenken und Unschlüssigkeiten abzulegen. Einen Exklusivanspruch seines Gebets als ein Gebet nur für Erwachsene hatte jesus mit Sicherheit nicht im Sinn, wohl aberdas Mandat an diese, es auch mit Kindern und Heranwachsenden zu beten und es ihnen - wie alle Glaubensdinge und -inhalte - zu vermitteln und verständlich zu machen. Dieses Anliegen hat sich die Künstlerin zu eigen gemacht, indem sie, wissend um die Bedeutung des Bildhaften im Kindesalter, das visuelle Element sorgsam eingesetzt hat, um die einzelnen Bitten des Vaterunsers kindgemäß mit Inhalten zu füllen, für das Kind umzusetzen und ihm nahezubringen. Aus der Fülle vieler Deutungsmöglichkeiten greift sie für jede der sieben Bitten eine heraus. Zwei Kinder, ein Mädchen und ein junge, führen als ldentifikationsfiguren durch das Buch. Die dargestellten Situationen sind gewissermaßen Momentaufnahmen aus ihrem Leben. Beim Durchblättern und Betrachten des Buches mit dem Kind werden an der einen oder anderen Stelle ausweitende und weiterführende, aber auch regulierende Hinweise nötig sein. Letztlich trifft dies wohl für alle Bilder zu: - Zum Umschlagbild ››Vater unser im Himmel« In der Geborgenheit der Abendsituation erfahren die Kinder Momente, in denen sie Gott spüren. Gott ist nicht hinter den Sternen, sondern wo Menschen liebevoll miteinander umgehen: da ist ››Himmek<, da ist Gott bei und unter uns, ist er über uns mächtig. - Zur ersten Bitte »Dem Name werde geheiligt<<: Die Allmacht und Größe Gottes ist für Kinder am leichtesten einsichtig in den Wundern der Schöpfung. Mit der Schöpfung Verantwortlich umzugehen, ist eine Möglichkeit, den Namen Gottes zu heiligen. - Zur zweiten Bitte »Dem Reich komme«: Gottes Reich überwindet nicht nur unsere irdischen Zustände, es ist totale Erneuerung (››Siehe, ich mache alles neu<<, Offenbarung 21,5). Eines der Hindernisse auf dem Weg zum Reich Gottes ist die Ungerechtigkeit menschlicher Verhältnisse, für die Kinder ein feines Gespür haben. Der krasse Gegensatz zwischen Arm und Reich ist nur ein Beispiel für viele andere, die an dieser Stelle möglich wären. - Zur dritten Bitte »Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden«: Diese Bitte setzt rückhaltloses Vertrauen zu Gott voraus. Das Bild zeigt eine Situation der Geborgenheit, in der solches Vertrauen entstehen und wachsen kann. Zur vierten Bitte »Unser tägliches Brot gib uns heute«: Mit der Bitte um das tägliche Brot ist mehr gemeint als Essen und Trinken. Es gehört dazu auch liebevolle Geborgenheit in der Gemeinschaft mit Menschen, die uns nahestehen. Das Bild gibt eine Situation wieder, in der drei Generationen um den Tisch sitzen. Die vielen kleinen Gesten der Zuwendung zeigen, daß sie über Essen und Trinken hinaus miteinander Gemeinschaft halten. Zur fünften Bitte ›› Und vergig uns unsere Schuld, wie wir vergeben unsern Schuldigern«: Menschliches Leben ist ohne Schuld nicht denkbar. Auch Kinder kennen Schuld. Sie verletzen und kranken einander, zerstören und machen kaputt. Vergebung verlangt den mutigen Schritt auf den anderen zu, sie ist ein wechselseitiges Sich-Wiederfinden in der Gemeinschaft. Das Bild im Bilderbuch zeigt Schuld. Wie könnte die Vergebung der auf dem Bild dargestellten Schuld aussehen? Zur sechsten und siebten Bitte ›› Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dern Bösen « : Vor der Schuld liegt die Versuchung. Uns Erwachsenen mögen die Versuchungen, denen kleinere Kinder ausgesetzt sind, unbedeutend erscheinen - zum Beispiel die Unwahrheit sagen, petzen, jemanden auslachen oder schlechtmachen, feige oder selbstgerecht sein... Die auf dem Bild dargestellten Kinder sind solchen Versuchungen erlegen. Wir alle wissen, wieviel Standhaftigkeit nötig ist, um den vielfältigen Versuchungen, denen wir täglich ausgesetzt sind, zu widerstehen. Von daher hat die Bitte um Erlösung von allem Bösen eine tiefe und vielschichtige Dimension. -- Zum Lobpreis Gottes »Dem/z dem ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit<<: Die Kraft und die Herrlichkeit Gottes zeigt sich in allem, was uns umgibt. lm vertrauensvollen Umgang miteinander wird ein Stück Reich Gottes sichtbar. So verstanden spiegelt sich im Schlufšbild das ganze Vaterunser wider: Mitten im Alltag gelingt unerwartet ein Stück heiles Leben. Die Bilder insgesamt wollen Ansatzpunkte zur inhaltlichen Weiterführung, Ausgestaltung und Vertiefung kindgemäfšer Szenen zu den Bitten des Vaterunsers bieten. Beim Anlegen theologisch-exegetischer Kriterien sollte bedacht und nicht außer acht gelassen werden, daß im religionspädagogischen Bereich zur Vermittlung biblischer Inhalte primär immer auch Ansatz- und ››Anknüpfungspunkte<< aus der Vorstellungswelt und dem Erfahrungshorizont der Kinder geboten sind, die den Zugang zu weiterführenden Perspektiven erst ermöglichen. Als Grundsatz mag auch hier das Jesuswort gelten, wie es im Schlußbild zur Doxologie, zum resümierenden Lobpreis des ganzen Gebets Ausdruck findet: ››Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen« (Matthäus 18,34). Vertrauen auf Gott, der wie ein Vater oder eine Mutter sich um mich kümmert und dessen Wille mit zum Besten dienen will, ist Grund genug, zu ihm zu beten, sich und das Leben ihm und seinem Willen getrost anzuvertrauen: denn sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Helmut Zechner |
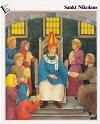 |
Regine Schindler Sankt Nikolaus Bilder von Carola Schaade. Religion für kleine Leute Ernst Kaufmann Verlag, 1989, 24 Seiten, 12 Farbbilder, 290 g, kartoniert, 3-7806-2302-1 |
Religion für kleine Leute Nachwort für Eltern und Erzieher Mehr als alle anderen Heiligengestalten gehört der Nikolaus ins Leben der Kinder. Er ist nicht nur gegenwärtig in weihnachtlichen Dekorationen, als Schokolade- und Lebkuchenfigur, sondern tritt als magische Gestalt in Familie, Kindergarten oder Schule auf. Die Kinder „glauben“ mehr oder weniger lange an ihn. Dabei spielt auch Angst eine gewisse Rolle, kommt er doch seit Jahrhunderten nicht nur, um überbordend zu schenken, sondern auch, um zu befragen oder gar zu bestrafen. Er ist also eine Kontrollinstanz, die heute zum Glück vor allem in humorvoller Weise „eingesetzt“ wird, fürs kleine Kind aber voller Geheimnisse bleibt. Es ist wichtig, daß Kindern - manche zeigen ja ihre Reaktion nach außen kaum - die Angst vor dieser Nikolaus-Gestalt genommen wird, und daß sie gleichzeitig die Figur des Heiligen, der hinter dem ganzen Brauchtum steht, kennen lernen. Indem Nikolaus in der vorliegenden Geschichte sein Kostüm vor den Kindern auszieht, demonstriert er: Ich will nicht Angst machen. Indem der Onkel aber vom Heiligen erzählt, erhält das Nikolausfest, als christliches Fest, für die Kinder einen neuen Sinn. Aus dem „Buch im Buch“ wird vor allem die Geschichte des Bischofs von Myra, wie sie aus der „Legenda aurea“ bekannt ist, lebendig. Im Gegensatz zu einer historischen Gestalt wie derjenigen des Heiligen Martin gibt es über die legendäre Figur des Nikolaus aber einen ganzen Kranz von Sagen, der weit über die Geschichte des Bischofs, der im 4. Jahrhundert in Myra gelebt haben könnte, hinausgeht. Mittelalterliche Legendenteile kamen hinzu und wurden durch buntes Brauchtum erweitert. Aus diesem ganzen späteren Komplex wurde für dieses Buch die Geschichte von den drei Schülern und die alten Nikolausumzüge, wie sie sich mancherorts bis in unsere Zeit finden, ausgewählt. Immer wieder können Kinder in diesem Büchlein Gharakterzüge entdecken, die den alten Heiligen und den heutigen „ gespielten“ Kapuzenmann verbinden: Er hilft phantasievoll, ohne Gegengaben zu erwarten; er kommt heimlich und unerkannt; er erinnert an das brave Kind, das Nikolaus selbst einmal war, aber auch an den Knecht Ruprecht, der früher Nikolaus und Christkind in Umzügen begleitete und von den Kindern das Bravsein erwartete. Die vorliegende Geschichte könnte anregen, in Kindergarten, Schule oder Familie den Nikolaus in ähnlicher Weise durchschaubar zu machen, indem er sich zum Beispiel vor den Augen der Kinder verkleidet oder entkleidet. Aber auch wenn einfach ein Sack vor der Tür steht oder nachts die Stiefel gefüllt werden, kann die Gestalt des Sankt Nikolaus, die hinter dem Brauchtum steht, Kindern nähergebracht werden. Sie sollen es dabei nicht vor allem einem drohenden Heiligen „recht“ machen wollen und folgsam sein, sondern sich zu phantasievollem Schenken und Helfen in der Vorweihnachtszeit anregen lassen, so daß der übliche Schenkzwang einen neuen Sinn erhält. In erster Linie soll die geheimnisvolle Nikolausgestalt Kindern Freude machen. Nicht zuletzt aber möge die Legende an das Leben ]esu erinnern und die Erwachsenen ermuntern, ergänzend einige Jesusgeschichten zu erzählen - jene, die auch den Heiligen als Kind geprägt haben könnten: Geschichten, in denen sich jesus um Arme und Aufšenstehende kümmert. So kann dieses Büchlein Kinder und Erwachsene in besonderer Weise durch die Adventszeit begleiten. Frau Professor Ottilie Dinges und Herrn Fachschuldirektor Frieder Schmitthenner möchte ich für ihre Beratung und ihre Anregungen bei der Entstehung dieses Büchleins herzlich danken. R. S. |
|
Regine Schindler Ein Apfel für Laura Ernst Kaufmann Verlag, 1991 |
Religion für kleine Leute Ein armes Mädchen erlebt Glück und Leid, Arm und Reich fragt direkt nach Gott. Ein anregendes Buch zu einem unbequemen Thema 28 Seiten mit farbigen Bildern, Großformat Glanzpappband |
|
|
Regine Schindler Zwei Ritter schließen Frieden . Ernst Kaufmann Verlag, 1987 |
Religion für kleine Leute Ernst Kaufmann Verlag, 1987, 24 Seiten, reich bebildert, Glanzpappband |
|
|
Regine Schindler Deine Schöpfung - meine Welt Ernst Kaufmann Verlag, 1982, |
Religion für kleine Leute 24 Seiten, Glanzpappband |
|
|
Helen lernt
leben Ernst Kaufmann Verlag, 1982 |
Religion für kleine Leute Die Kindheit der taub-blinden Helen Keller |
|
|
Das verlorene Schaf Ernst Kaufmann Verlag, 1980, |
Religion für kleine Leute | |
|
Regine Schindler Benjamin sucht den lieben Gott Ernst Kaufmann Verlag, 1979 |
Religion für kleine Leute | |
|
Regine Schindler Jesus teilt das Brot. Ernst Kaufmann Verlag, 1993, 3-7806-0422-1 |
Religion für kleine Leute Eine Geschichte zum Abendmahl. |
|
|
Regine Schindler Steffis Bruder wird getauft Ernst Kaufmann Verlag, 1993, 24 S., Bilder, Paperback, 3-7806-0432-9 |
Religion für kleine Leute |
|
|
Regine Schindler Pele und das neue Leben Ernst Kaufmann Verlag, 1981, 24 Seiten, viele Bilder, Leinen, 3-7806-0415-9 |
Religion für kleine Leute Eine Geschichte von Tod und Leben. Bilder von Hilde Heyduck-Huth |
|
|
Florian in der
Kirche Ernst Kaufmann Verlag, 1979 |
Religion für kleine Leute | |
|
RegineSchindler Martinus teilt den Mantel Ernst Kaufmann Verlag, 1983 |
Religion für kleine Leute | |
|
Regine Schindler Und Sara lacht Eine biblische Geschichte neu erzählt von Regine Schindler. Bilder von Eleonore Schmid. Ernst Kaufmann Verlag, 1984, |
Religion für kleine Leute Gedenken der sieben jüdischen Prophetinnen Sara, Abrahams Frau, 2200 v.Chr Gen 12-17; Hebr 11,11 Mirjam, Moses Schwester,.1600 v. Chr Exodus15 Debora, Richterin Israels, 1200 v. Chr. Richter 4-5 Hanna, Samuels Mutter, 1100 v. Chr. 1Samuel 1 Abigajil, Davids kluge Frau. 1000 v. Chr. 1Samuel 25 Hulda, die Prophetin, 640 v.C. 2Chronik 34-35 Ester, jüdische Königin, 460 v.C. Esther 4-8 |
|