| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Buddhismus | Hinduismus | Chinas Religionen | |
| Manichäismus | Manichäische Handschriften |
|
Manichäismus |
||
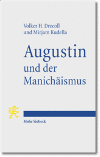 |
Volker Henning Drecoll /
Mirjam Kudella Augustin und der Manichäismus Mohr Siebeck, 2011, 230 Seiten, fadengeheftete Broschur, 978-3-16-150841-7 29,00 EUR |
Welche Bedeutung hat der Manichäismus für Augustin und seine Theologie? Um diese Frage zu beantworten, untersuchen Volker Henning Drecoll und Mirjam Kudella in drei Schritten die Zeit Augustins als Manichäer, seinen Kampf gegen den Manichäismus und die Frage eines möglichen Einflusses des Manichäismus auf Augustins Theologie. Zunächst wird der nordafrikanische Manichäismus dargestellt, wobei eine Vermischung mit Nachrichten aus den koptischen Manichaica oder späteren Quellen konsequent vermieden wird, um in chronologischer wie regionaler Hinsicht ein präzises Bild für das lateinischsprachige Nordafrika zu erhalten. Auch die Frage, inwiefern der Manichäismus als Dualismus und als Gnosis einzuschätzen ist, wird dabei gestellt. Hieran schließt sich eine Darstellung dessen an, was über den jungen Augustin als manichäischen „Hörer“ bekannt ist, was den Manichäismus für ihn attraktiv gemacht haben mag und warum er sich von diesem wieder abwandte. In einem zweiten Teil kommt die Bekämpfung des Manichäismus durch den Presbyter und Bischof Augustin in den Blick, und zwar in der antimanichäischen Polemik, aber auch in den Grundentscheidungen seiner Theologie, etwa der Ontologie oder dem Schriftverständnis. Die literarische antimanichäische Tradition aus der Zeit vor Augustin wird dabei ebenso beachtet wie die Manichäismusvorwürfe, die gegen Augustin schon zu seinen Lebzeiten erhoben wurden. Schließlich untersuchen die Autoren, inwiefern Augustins Denken vom Manichäismus beeinflusst ist, etwa in der Gottes- und Seelenlehre, der Willens- und Sündenvorstellung, der Christologie, dem Konzept von Heilsgeschichte oder dem Schriftverständnis. |
 |
Jessica Schrinner Zwischen Selbstverständlichkeit und Schweigen. Die Rolle der Frau im frühen Manichäismus Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, 494 Seiten, Hardcover, 978-3-938032-60-2 110,00 EUR |
Oikumene. Studien zur antiken Weltgeschichte Band 11 Die spätantike Weltreligion des Manichäismus wurde von dem in einer judenchristlichen Täufersekte im Zweistromland aufgewachsenen Propheten Mani (216-276/277 n.Chr.) gestiftet. Die manichäische Hierarchiestruktur, die Mani selbst früh etablierte, unterteilte sich in zwei Gruppen: die den Klerus repräsentierenden Electi und die Katechumenen, die Laien. Die Funktionen und Aufgaben der Frauen und Männer in der Rolle als Electi und Katechumenen, die Stellung dieser beiden Gruppen gemäß manichäischer und antimanichäischer Texte sowie die manichäische Rezeption der biblischen und frühchristlichen Frauenbilder sind Gegenstand der Untersuchung. Dafür werden manichäische und antimanichäische Quellen des Zeitraums vom 4. bis ins frühe 7. Jahrhundert ausgewertet. Aufgrund der ausgeprägten manichäischen Missionsbestrebungen wurden auch spätere Quellentexte insofern herangezogen, als sie direkt und indirekt überlieferte Fragmente und Zitate aus manichäischen Quellen enthalten. Die Dissertation wurde mit dem Wissenschaftspreis der Stiftung der Universität Augsburg und mit dem Dissertationspreis der Graduiertenschule für Geistes- und Sozialwissenschaften Augsburg ausgezeichnet. Inhaltsverzeichnis |
 |
Brigitte Berges De natura boni / Contra Secundinum Manichaeum Die Natur des Guten / Gegen den Manichäer Secundinus Schöningh, 2010, 425 Seiten, Festeinband, 978-3-506-76346-4 83,00 EUR |
Augustinus Opera, Gesamtausgabe
Band 22 Eingeleitet, neu übersetzt und kommentiert von Brigitte Berges, Bernd Goebel und Friedrich Hermanni In seiner Abhandlung »Die Natur des Guten« präsentiert Augustinus die Quintessenz seiner Auseinandersetzung mit dem Manichäismus, einer spät-antiken Weltreligion, der er selbst angehangen hatte. Im Mittelpunkt dieser Debatte steht die Frage, ob unsere Erfahrung des Bösen zeigt, dass es in der Welt Dinge gibt, die ihrem Wesen nach schlecht sind; und ob daher mit den Manichäern neben dem guten, göttlichen Prinzip ein zweites, böses Prinzip anzunehmen ist. Dabei geht Augustinus so detailliert auf den manichäischen Mythos ein, dass seine Schrift eine der wichtigsten Quellen für die Mythologie der Manichäer darstellt. Zugleich legt er in komprimierter Form seine ausgereifte Metaphysik des Guten und des Bösen dar. Das macht dieses Werk zu einer geeigneten Einführung in die Fundamente augustinischer Weltanschauung und Ontologie. Die Ausgabe bietet neben Originaltext, Neu-übersetzung und Einzelkommentierung eine umfangreiche historsich-systematische Einleitung. Der Brief des Manichäers Secundinus, auf den Augustin mit seiner Schrift »Gegen den Manichäer Secundinus« reagiert, ist eine der wichtigsten Quellen für den Manichäismus in Rom. Secundinus versucht darin, Augustinus für den Manichäismus zurückzugewinnen. In seiner Antwort bestreitet Augustinus den Manichäern ihren Anspruch, die Bibel richtig zu deuten. Zu-gleich wird Augustins genaue Kenntnis der manichäischen Mythologie wie Theo-logie deutlich. Die Ausgabe bietet einen kritisch revidierten Text, eine Neuübersetzung, eine historische Einleitung sowie eine Kommentierung des Briefes des Secundinus und die Antwort Augustins. |
 |
Josef Lössl De vera religione Die wahre Religion Schöningh, 2007, 328 Seiten, Festeinband, 978-3-506-75615-2 59,00 EUR |
Augustinus Opera, Gesamtausgabe
Band 68 Eingeleitet, übersetzt und herausgegeben von Josef Lössl Nach der kritischen Edition ins Deutsche übersetzt und mit ausführlicher Einleitung und Kommentierung versehen: De vera religione - ein grundlegendes Frühwerk Augustins. Ist Religion mit einem Wahrheitsanspruch verbunden? Basiert der christliche Glaube auf einer Willkürentscheidung oder lässt er sich rational vertreten? Welche innere Struktur hat der Glaube? Diese und weitere fundamentale Fragen stellt Augustinus in seiner frühen Schrift. Verfasst im Jahre 390, vier Jahre nach der Bekehrung und kurz vor dem Antritt des Presbyteramts, enthält dieses Werk gewissermaßen das theologische Gesamtprogramm des noch ganz am Anfang stehenden Kirchenlehrers. Es geht um die Zurückweisung des noch vor kurzem vertretenen Manichäismus, der paganen Philosophie, des Polytheismus, des Judentums, und einer Vielzahl christlicher Häresien, sowie um die Annahme des katholischen Glaubens. Gleichzeitig bemüht Augustinus sich um das Verstehen dieses Glaubens mit Hilfe der neuplatonischen Philosophie und einer reflektierten Bibelhermeneutik. Ziel des christlichen Lebens ist das innere Wachsen in diesem Glauben bis hin zur Vollkommenheit. Die Ausgabe enthält parallel zum lateinischen Text der kritischen Standardedition eine nach dieser Edition erstellte deutsche Übersetzung, sowie den Erstdruck der griechischen Teilübersetzung des Prochoros Kydones. Inhaltsverzeichnis |
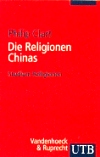 |
Philip
Clart Die Religionen Chinas Studium Religionen Uni - Taschenbücher (UTB), 2009, 220 Seiten, kartoniert, 978-3-8252-3260-3 |
Der Band bietet einen chronologischen
Abriss zu den Religionen Chinas. Er informiert über Konfuzianismus, Daoismus, "Volksreligion" und Buddhismus, Christentum, Manichäismus, Islam. Er fasst Kernthemen in knappen Abhandlungen zusammen und hebt ihre Bedeutung für das Gesamtbild der chinesischen Religiosität hervor. Der Schwerpunkt liegt auf der Kontextualisierung, d. h. auf der Einbettung allen religiösen Handeins und aller religiösen Sinngebung in historische und soziokulturelle Zusammenhänge. aus der Reihe UTB |
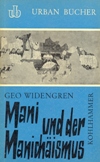 |
Geo Widengren Mani und der Manichäismus Kohlhammer Verlag, 1961, 170 Seiten 153 g, kartoniert |
Urban Taschenbücher 57 Zu diesem Band: Der bekannre schwedische Religionsforscher gibt eine auf neuesten Forschungsergebnissen beruhende zusammenfassende Darstellung des Lebens und der Lehre des Mani, der im 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung aus iranischen, hellenistischen und christlichen Elementen gemischte Religion gestiftet hat, die zeitweise eine ernste Bedrohung des Christentums bedeutete. Erst seit den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts besitzen wir manichäische Originalschriften. die der Sand Ägyptens bewahrt hatte und die die Konservierungskunst von Varer und Sohn Ibscher der Forschung zugänglich gernacht haben. Wenn auch große Teile cles Fundes noch der Entzifferung harren, so erlauben die his jetzt veröffentlichten Texte doch die Zeichnung eines geschlossenen Bildes des maniächischen Systems. Auch die kirchliche Organisation und der Kultus sowie die manichäische Kunst werden dargestellt. Und in einem Schlußkapitel Widengren vor den Augen des Lesers die Persönlichkeit des Mani erstehen, der nach dem beurteilt wird, was er sein wolltez Träger der göttlichen Offenbarung und Apostel des Lichts. |