| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
|
Bibliothek der griechischen Literatur |
|||
|
Die Serie BGL bringt seit
1971 in drei Abteilungen moderne deutsche Übersetzungen
bedeutsamer literarischer, religiös-theologischer sowie
historiographischer Werke der antik-heidnischen,
griechisch-patristischen und byzantinischen Gedankenwelt. Der Schwerpunkt liegt auf solchen Texten, die bisher noch nicht in die deutsche Sprache übertragen worden sind. Die Übersetzungen sind auf wissenschaftlicher Basis erarbeitet und genügen hohen sprachlichen Anforderungen. Sie sind verbunden mit einem wissenschaftlichen Kommentar und einer gründlichen Einführung in Leben und Werk des Autors mit einem Verzeichnis seiner Werke und ihrer Editionen. |
|||
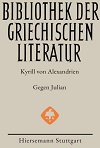 |
Kyrill von Alexandrien Gegen Julian Hiersemann, 2023, 700 Seiten, 2 Bände, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-2327-8 388,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 94 1. und 2. Halbband Band 1: Widmungsschreiben an Theodosios und Buch I bis V 978-3-7772-2126-7 Band 2: Buch VI bis X + Die griechischen Fragmente 978-3-7772-2127-4 Was aber ist mit ihrem imposanten und berühmten Plato? Hielt er sich nicht bei den Sportlehrern auf und verweilte anfangs gerne auf den Ringplätzen, bevor er sich vom Athletenschweiß lossagte und zur Philosophie überging? Der Bischof Kyrill von Alexandrien hat zu Beginn des fünften nachchristlichen Jahrhunderts auf die Polemik geantwortet, die der Kaiser Julian Apostata 60 Jahre zuvor gegen die Christen gerichtet hatte. Seine Widerlegung, die nicht weniger polemisch formuliert ist als Julians Angriff auf die christliche Lehre, legt Zeugnis davon ab, dass Christen damals die Vertreter der paganen Tradition noch immer als Gegner wahrnahmen, gegen die es anzugehen galt. Die Ausgabe in zwei Bänden bieten die erste vollständige Übersetzung der Schrift Gegen Julian in eine moderne Sprache. Die Mehrheit der Übersetzer hat an der kritischen Edition von Kyrills Werk in den »Griechischen Christlichen Schriftstellern« mitgearbeitet. Auf dieser Edition basiert die vorliegende Übersetzung, die durch kommentierende Anmerkungen dieses wichtige Zeugnis der interreligiösen Debatte in der Spätantike erschließt. Übersetzt von Gerlinde Huber-Rebenich (* 1959) ist Professorin für Lateinische Philologie am Institut für Klassische Philologie der Universität Bern. Stefan Rebenich (* 1961) ist Professor für Alte Geschichte und Rezeptionsgeschichte der Antike am Historischen Institut der Universität Bern. Adolf Martin Ritter (* 1933) ist Professor Emeritus für Historische Theologie (Patristik) der Universität Heidelberg. Michael Schramm (* 1972) ist Privatdozent am Seminar für Klassische Philologie der Universität Göttingen. Thomas Brüggemann (*1966) ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Alte Kirchengeschichte der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn |
|
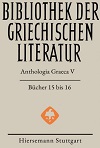 |
Anthologia Graeca Band 5: Bücher 15 und 16 Hiersemann, 2021, 265 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-2123-6 184,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 93 Die Anthologia Graeca endlich komplett: etwa viertausend altgriechische Epigramme aus über 15 Jahrhunderten in einer modernen deutschen Gesamtübersetzung Wir wüssten von der Antike sehr viel weniger, hätten wir diese große Anzahl kleiner Gedichte nicht. Als Gedichte auf einen Gegenstand oder eine Situation, oder sogar als Gedichte aufgeschrieben auf einem Gegenstand, etwa auf einer Statue oder einem Beil, sind diese Epigramme eine wertvolle Quelle für die Literatur- und Alltagsgeschichte. Weihungen alltäglicher Dinge, politische Querelen, Einweihungen von Tempeln undchristlichen Kirchen, militärische, sportliche oder amouröse Erfolge oder Natur katastrophenwerden in den Gedichten ebenso reflektiert wie mentalitätsgeschichtlich interessante Alltäglichkeiten von anrührender Trauer bis zu beißendem Spott. Die Übersetzung versucht, der Vielstimmigkeit der Sammlung gerecht zu werden und den heutigen Leser*innen einen möglichst unverstellten Blick auf diesen literarischen Schatz zu ermöglichen. Der Band enthält die Gesamtregister für Autoren und Namen/Sachen der Bände 1 bis 5. Beschreibung siehe Band 1 BGL 72: Band 1: Bücher 1 bis 5 ISBN 978-3-7772-1117-6 BGL 76 Band 2: Bücher 6 bis 8 ISBN 978-3-7772-1408-5 BGL 79 Band 3: Bücher 9 und 10 ISBN 3 978-3-7772-1611-9 BGL 89 Band 4: Bücher 11 bis 14 ISBN 978-3-7772-1920-2 BGL 93 Band 5, Bücher 15 und 16 ISBN 978-3-7772-2123-6 Der Herausgeber: Dirk Uwe Hansen (geb. 1963) ist promovierter Altphilologe und lehrt Gräzistik am Historischen Institut der Universität Greifswald; zudem übersetzt er Lyrik und Prosa aus dem Alt- und Neugriechischen und schreibt selbst Gedichte. |
|
 |
Kai Broderson Galenos: Arzt und Philosoph Fünf autobiographische Schriften Hiersemann, 2021, 223 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-2105-2 vergriffen, nicht mehr lieferbar |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 92 Corpus Galencium Band 2 Warum ein guter Arzt Philosoph sein muss Einführung von Florian Steger. Zweisprachige Ausgabe von Kai Brodersen Galen war der bedeutendste Arzt der römischen Kaiserzeit; seine Werke haben die Medizin bis in die Neuzeit maßgeblich beeinflusst. Doch wie sah sich Galen selbst? Fünf seiner Schriften erlauben uns, dies nachzuvollziehen: "Über seine eigenen Bücher" und "Über die Abfolge seiner eigenen Bücher" stellen uns Galens Werke vor,"Protreptikos" und "Über die Unverdrossenheit" offenbaren seine philosophische Position. Im Traktat "Dass der beste Arzt auch Philosoph ist" fordert Galen schließlich, dass der wahre Arzt auch philosophisch gebildet sein soll, und plädiert für eine Verbindung von Medizin und Philosophie. In einer neuen zweisprachigen Ausgabe mit einer ausführlichen Einführung, Anmerkungen und einem Anhang erschließt der Band die Werke in ihrem durch Neufunde erweiterten Textbestand. Kai Brodersen ist Professor für Antike Kultur an der Universität Erfurt. Florian Steger ist Professor für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Universität Ulm. |
|
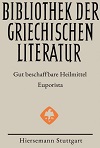 |
Kai Broderson Gut beschaffbare Heilmittel (Euporista) Hiersemann, 2020, 464 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-2038-3 98,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 91 Corpus Galencium Band 1 In der Stadt ist die ärztliche Versorgung gut – aber was tut man unterwegs? Drei dem großen Mediziner Galenos im 2. Jahrhundert n. Chr. zugeschriebene Bücher über Euporista verzeichnen dafür gut beschaffbare Heilmittel. Steine, Pflanzen und Tiere samt ihrer Produkte und Ausscheidungen sollen dazu beitragen, Krankheiten von Kopf bis Fuß zu behandeln. Die im Corpus Galenicum überlieferten Bücher wurden über viele Jahrhunderte weitergeschrieben: Während die Art der Krankheiten weitgehend konstant blieb, wurden neue Heilmittel und -verfahren notiert und neue Autoritäten – darunter auch Heilige – herangezogen. Die Bücher sind zugleich ein wichtiges Dokument der Medizingeschichte und ein Spiegelbild der bunten Alltagswelt in Antike und byzantinischem Mittelalter. Die drei Bücher sind nun erstmals in eine moderne Sprache übersetzt. Sie werden zweisprachig präsentiert und durch eine Einführung, einen Anhang und ein Register erschlossen. Inhalt Einführung Galenos von Pergamon Galenos’ Bücher für Glaukon Drei griechische Bücher über Euporista Wenn kein Arzt erreichbar ist »Das Nützliche nach Möglichkeit«: Theoretische Grundlage Praktische Anwendung Die Überlieferung des griechischen Texts Übersetzungen ins Syrische und Arabische Übersetzungen ins Lateinische Zahlen, Maße und Gewichte Neue Einblicke in die antike und byzantinische Welt |
|
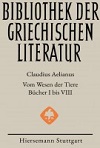 |
Claudius Aelianus Vom Wesen der Tiere - De Natura Animalium Bücher I bis VIII, Hiersemann, 2020, 283 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1904-2 174,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 90 Auf der Grundlage der Übersetzung von Paul-Gerhard Veh, bearbeitet und kommentiert von Philipp Stahlhut. Mit einer Einleitung von Dirk Uwe Hansen Von mythischen Vögeln, deren Verhalten man nur mit hinreichender Kenntnis der Odyssee begreifen kann, über lüsterne Papageienfische hin zu seriösen Ansätzen systematischer Naturbeobachtung reicht das breite Spektrum von Aelians tierkundlicher Schrift De Natura Animalium. Der in der Antike für seine sprachliche Eleganz gerühmte Redner hat es unternommen, in 17 Büchern vermischte Nachrichten aller Art über die bekannte und unbekannte Tierwelt seiner Zeit zum erbaulichen Nutzen seiner Leser aufzubereiten. Stets schwingt der Vergleich zum menschlichen Handeln mit, wenn Stärken und Schwächen der Tiere vorgestellt werden. Was unterhaltsam daherkommt, ist aber durchaus auf der wissenschaftlichen Höhe seiner Zeit erarbeitet und erweist sich als erstrangiger Quellentext für die Erforschung antiker Naturwissenschaft. Die genaue, frische und gut lesbare Neuübersetzung ist die Summe eines ganzen Forscherlebens. Sie wird ergänzt durch einen ausführlichen Kommentar, der Aelians Stand in die Tierkundetradition der Antike sowie seinen Rang bis heute einzuordnen hilft. Eine ausführliche Einleitung des Gräzisten Dirk Uwe Hansen zum literaturgeschichtlichen Umfeld Aelians und zur Gattung der sog. Buntschriftstellerei, in die sich Aelians ›Tierleben‹ einordnen lässt, rundet den Band ab. Philipp Stahlhut (geb. 1985) war wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-Sonderforschungsbereich »Bedrohte Ordnungen« im Bereich der Alten Geschichte am Historischen Seminar der Universität Tübingen und ist seit 2016 Lehrer am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium in Rastatt. |
|
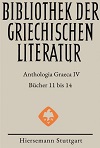 |
Anthologia Graeca. Band 4, Bücher 11 bis 14 Hiersemann, 2019, 334 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1920-2 198,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 89 Ins Deutsche übersetzt und erläutert von Christoph Kugelmeier, Dirk Uwe Hansen, Jens Gerlach und Jenny Teichmann Vom anrührenden Liebesgedicht über die Beschreibung antiker Statuen und christlicher Kirchen bis hin zu Spottgedichten, Grabsprüchen, Rätselversen und Sprachspielen findet sich in der 15 Bücher umfassenden Anthologia Graeca die gesamte Bandbreite dessen, was das klassische griechische Epigramm zu bieten hat. Diese in einer Heidelberger und einer byzantinischen Handschrift überlieferte umfangreiche Sammlung pointiert-kurzer Gedichte ist in ihrer inhaltlichen Vielfalt und literarischen Vielstimmigkeit ein kultur- und literaturhistorisches Dokument ersten Ranges. In der neuen, modernen und auf Texttreue in jeder Hinsicht bedachten Gesamtübersetzung erscheint nun der IV. Band mit den Büchern 11 bis 14. Diese Bücher bilden wiederum ganz charakteristische Einzelsammlungen: Da ist Buch 11 mit seinen scharfzüngigen Trink- und Spottepigrammen. Dann Buch 12 mit den hochberühmten Gedichten auf die homoerotische Liebe, eine Hauptquelle der Geschichte der Sexualität in der Antike. Weiter Buch 13 mit den vertrackten metrischen Beispielgedichten, sowie Buch 14 mit Rätseln und (tatsächlich!) Rechenaufgaben, die in Randglossen auch noch mit Formeln exemplifiziert werden. Beschreibung siehe Band 1 BGL 72: Band 1: Bücher 1 bis 5 ISBN 978-3-7772-1117-6 BGL 76 Band 2: Bücher 6 bis 8 ISBN 978-3-7772-1408-5 BGL 79 Band 3: Bücher 9 und 10 ISBN 3 978-3-7772-1611-9 BGL 89 Band 4: Bücher 11 bis 14 ISBN 978-3-7772-1920-2 BGL 93 Band 5, Bücher 15 und 16 ISBN 978-3-7772-2123-6 Der Herausgeber: Dirk Uwe Hansen (geb. 1963) ist promovierter Altphilologe und lehrt Gräzistik am Historischen Institut der Universität Greifswald; zudem übersetzt er Lyrik und Prosa aus dem Alt- und Neugriechischen und schreibt selbst Gedichte. |
|
 |
Menandros Rhetor Abhandlungen zur Rhetorik Hiersemann, 2019, 282 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1934-9 96,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 88 “Das Buch des Menandros, aber schnell!” Diesen Hilferuf sandte ein spätantiker Redenschreiber an seinen Bruder, dem er sein Exemplar geliehen hatte, ohne daran zu denken, dass er es für eine eigene Rede benötigt. Wie nämlich kann man ein Land, eine Stadt loben und wie einen Kaiser? Welche Rede verspricht Erfolg, wenn sich ein Politiker bei einem Machthaber oder seinem Statthalter einschmeicheln möchte? Was sagt man zur Begrüßung, was zum Abschied? Und mit welcher Rede kann bei Hochzeiten, Geburtstagen und Todesfällen reüssieren? Konkrete Antworten auf solche Fragen bieten zwei vor gut 1700 Jahren entstandene Abhandlungen des Menandros Rhetor mit praktischen Ratschlägen für Redenschreiber. Beide Traktate liegen nun erstmals in einer deutschen Übersetzung vor und werden in einer zweisprachigen Ausgabe präsentiert. Die Einführung stellt die Texte in ihren historischen Kontext, zahlreiche Anmerkungen und ein Anhang mit Register erschließen sie für ein heutiges Lesepublikum – und können damit auch heute Redenschreibern wie einst jenem Victor nützen, der das Buch des Menandros so dringend zurückhaben wollte. Kai Brodersen ist Professor für Antike Kultur an der Universität Erfurt. |
|
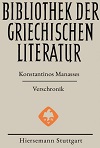 |
Konstantinos Manasses Verschronik Hiersemann, 2019, 350 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1902-8 164,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 87 Übersetzt, kommentiert und mit einer Einleitung versehen von Anneliese Paul und Andreas Rhoby Charmante, aber unbeherrschte Kronprätendenten, mädchenhafte fünfzigjährige Kaiserinnen, goldene Musikautomaten am Hof, eine ruinöse Schlacht bei Mantzikert (die Vorwand für den ersten Kreuzzug wurde) – der mittelbyzantinische Chronist Konstantinos Manasses schrieb keine trockenen Berichte, sondern Geschichten aus der Geschichte. Seine Chronik beginnt zwar mit der Schöpfung der Welt und reicht beinahe bis in die Lebenszeit des Autors, doch handelt es sich um mehr als eine Aneinanderreihung von historischen Fakten. Manasses war vielmehr daran interessiert, seiner Auftraggeberin Eirene, der Schwägerin des Kaisers Manuel I. Komnenos, auch von Mord und Totschlag, Liebe, Eifersucht und Neid zu erzählen. Die deutsche Erstübersetzung richtet sich nicht nur an die byzantinistische Fachwelt, sondern auch an ein Publikum von Historikern und Literaturwissenschaftlern, das entdecken möchte, wie es einem byzantinischen Autor des 12. Jahrhunderts gelang, von der Geschichte in abwechslungsreichen und spannenden Episoden zu erzählen. |
|
 |
Laura Carra Die Tübinger Theosophie Hiersemann, 2018, 362 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1818-2 164,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 86 Der Codex Tubingensis Mb 27 der Tübinger Universitätsbibliothek ist in vielerlei Hinsicht eine Besonderheit. Dieser Sammelband, den der Tübinger Griechischprofessor Martin Crusius im 16. Jahrhundert kopieren ließ, enthält die Abschrift einer ungewöhnlichen griechischen Handschrift: Diese hatte etwa 100 Jahre zuvor der Humanist Johannes Reuchlin Dominikanermönchen abgekauft, nachdem sie in Konstantinopel bei einem Fischhändler entdeckt und nach Basel gebracht worden war. Leider verbrannte diese Handschrift bei der Bombardierung Straßburgs durch die Preußen 1870 – wie so viele andere kostbare Handschriften aus Antike und Mittelalter. Bei diesem Text, der nach seinem Aufbewahrungsort «Tübinger Theosophie» genannt wird, handelt es sich um ein byzantinisches Exzerpt aus einer spätantiken Schrift eines christlichen Verfassers, eine Sammlung von antiken Orakeln, Wahrsagungen und Weisheitssprüchen. Die meist paganen antiken Orakeltexte und Sentenzen werden in synkretistisch anmutenden kurzen Paraphrasen und Kommentarpassagen christlich (um-)gedeutet, da gezeigt werden soll, dass die alte pagane und die neue christliche Religion im Grunde harmonieren. Diese spektakuläre und komplexe Schrift wird hier erstmals ins Deutsche übersetzt. Ein detaillierter Stellenkommentar erklärt zusammen mit der ausführlichen Einleitung den kultur-, religions- und philosophiegeschichtlichen Hintergrund und die denkwürdige Überlieferungsgeschichte. Der Beitrag von Helmut Seng, einem ausgewiesenen Experten des antiken Orakelwesens, bettet die «Tübinger Theosophie» zudem in ihren generischen und historischen Kontext ein. Inhaltsverzeichnis / Leseprobe |
|
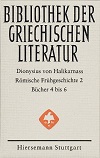 |
Dionysius von
Halikarnass Römische Frühgeschichte. Band 2: Bücher 4 bis 6 Hiersemann, 2018, 507 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1803-8 238,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 85 Die international gelobte, flüssige und bisweilen packend zu lesende Übersetzung der Römischen Frühgeschichte des Dionysius von Halikarnassos wird mit dem 2. Band fortgesetzt, der die Bücher 4 bis 6 umfasst. Diese Bücher führen uns direkt in die Zeit des Niedergangs der Königsherrschaft unter dem Tyrannen Tarquinius Superbus und in den Beginn der römischen res publica, der ins Werk gesetzt wurde durch die Verschwörung führender Mitglieder der Oberschicht unter Lucius Iunius Brutus nach der Vergewaltigung Lucretias durch Sextus Tarquinius. Das 6. Buch schließt ab mit der ersten Phase des römischen Kampfes mit den Latinern um die Vorherrschaft in Italien (dem foedus Cassianum) sowie des politisch-rhetorisch aufgeladenen Ständekampfes und der Ernennung der ersten Volkstribunen. Eine dichte Kommentierung philologischer, erzähltechnischer und historischer Aspekte des Werkes sowie ein Personen-, Namen- und Sachregister erschließen den Text der Bücher in ihrem historischen Kontext und Quellenwert für die Forschung. BGL 75: Band 1: Bücher 1 bis 3 ISBN 978-3-7772-1404-7 BGL 85: Band 2: Bücher 4 bis 6 ISBN 978-3-7772-1803-8 |
|
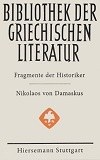 |
Nikolaos von Damaskus Fragmente der Historiker Hiersemann, 2018, 127 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1804-5 158,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 84 Der Schriftsteller und Diplomat Nikolaos von Damaskus (64 – 4 v. Chr.) mag heute überwiegend Spezialisten ein Begriff sein, zu seiner Zeit, derjenigen unmittelbar vor Christi Geburt, war er bestens vernetzt und geschätzt in höchsten Kreisen des Imperiums: Er war der Hauslehrer der Kinder, die Kleopatra mit Marcus Antonius hatte, er war befreundet mit Marcus Agrippa und dessen Schwiegervater Augustus, der ein Gebot erließ, dass alle Welt geschätzt würde, und politischer Berater am Hof des Königs Herodes von Judäa, der später aus Furcht um seine Herrschaft Kinder in Bethlehem ermorden lassen haben soll. Nikolaos war es zu verdanken, dass das angespannte Verhältnis zwischen Augustus und Herodes vorerst nicht zum Bruch zwischen Rom und Jerusalem geführt hatte. Neben seiner diplomatischen Betätigung brachte er ein beeindruckendes Oeuvre zusammen: Er schrieb in 144 Büchern die umfangreichste Universalgeschichte der Antike, die von bekannten Autoren wie Strabon, Flavius Josephus sowie Athenaios als Quelle verwendet wurde. In seiner Autobiographie (die früheste griechischsprachige, die zumindest in Teilen erhalten ist) gab er Auskunft über sein Studium und seine Philosophie. Weiterhin zeigt eine Sammlung besonderer Völkersitten das starke Interesse des Autors an Ethnographie. Keines dieser Werke ist vollständig erhalten, doch die erhaltenen Fragmente sind so zahlreich, dass sie ein großes Quellenkorpus bilden, das nun erstmals in deutscher Übersetzung vorgelegt wird, um das Werk des Nikolaos insbesondere der historischen Forschung leichter zugänglich zu machen. Die Ausgabe umfasst auch die Testimonia und Fragmente ungewisser Stellung, zweifelhafte Fragmente sowie einen Anhang mit Reden, die Nikolaos zugeschrieben wurden. Inhaltsverzeichnis / Vorwort / Einleitung Tino Shahin ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Abteilung für Alte Geschichte der Universität Bonn. |
|
 |
Alexanderhistoriker Fragmente der Historiker Die Alexanderhistoriker (FGrHist 117–153) Hiersemann, 2017, 515 Seiten, Leinen, 23,5 x 15 cm 978-3-7772-1721-5 218,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 83 Über kaum eine andere Persönlichkeit haben antike Autoren mehr geschrieben als über Alexander den Großen - wen wundert das angesichts seiner außerordentlichen Eroberungsfeldzüge und der Tatsache, dass nach seiner Herrschaft in der antiken Welt nichts mehr so war wie vorher? Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb bleiben die Biographie Alexanders und die Geschichte der Alexanderzeit legendenumrankt und schwer rekonstruierbar. Dieser Umstand ist in erster Linie auf die äußerst komplexe Überlieferungslage zurückzuführen, denn die einst zahlreichen Berichte von Zeitgenossen sind fast vollständig verloren und nur in den Werken späterer Autoren fassbar. Die vorliegende Übersetzung der Testimonien und Fragmente der Historiker der Alexanderzeit ist die erste Übertragung ins Deutsche. Inhaltsverzeichnis |
|
 |
Pseudo-Plutarch Leben der zehn Redner - Leben des Thukydides Hiersemann, 2017, 170 Seiten, Leinen, 23,5 x 15 cm 978-3-7772-1708-6 168,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 82 Von der glanzvollen Redekunst im alten Athen zeugen nicht nur überlieferte Reden etwa des attischen Staatsmanns Perikles, sondern auch Lebensbeschreibungen geschätzter Redner und Historiker, die über jene berichteten. Zwei Werke dieser Tradition der Rhetorik-Geschichte werden hier erstmals in moderner deutscher Übersetzung geboten: die Leben der zehn Redner, die lange fälschlich dem Plutarch zugeschrieben wurden, und die Thukydides-Vita, als deren Autor der spätantike Grammatiker Markellinos gilt. Beide Texte vereinen eine Fülle verschiedenster, zum Teil widersprüchlicher Überlieferungen und enthalten eine Vielzahl historischer Nachrichten sowie Zitate aus Quellen, die heute verloren sind. So stellen sie ein einzigartiges Zeugnis nicht nur für das Leben, sondern vor allem auch für das antike Nachleben der großen Rhetoriker dar. Die Einleitungen der Übersetzer geben, fachlich fundiert, aber allgemein verständlich, einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Entstehung und Überlieferung der Texte, zu ihren Quellen und möglichen Autoren. Zu beiden Texte findet sich ein ausführlicher Kommentar, der alle für das Verständnis der Übersetzungen nötigen historischen Ereignisse, Personen, Fachbegriffe und textlichen Besonderheiten erläutert. LEBEN DER ZEHN REDNER: Übersetzt, eingeleitet und erläutert von Alexander Düren LEBEN DES THUKYDIDES: Übersetzt, eingeleitet und erläutert von Wolfgang Will Inhaltsverzeichnis |
|
 |
Eustathios von Thessalonike Kaiserreden Hiersemann, 2016, 195 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1624-9 164,00 EUR siehe auch: Band 58: Libanios, Kaiserreden |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 81 Eingeleitet von Grammatiki Karla; aus dem byzantinischen Griechisch übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Karin Metzler Eustathios von Thessalonike (ca. 1115 – ca. 1195) nimmt eine herausragende Stellung in seiner Zeit ein, als Gelehrter ebenso wie als Redner am Kaiserhof wie auch durch seine Karriere in der kirchlichen Hierarchie. Sein Aufstieg im Patriarchat führte vom Kanzleischreiber zunächst bis zum Amt des Magisters der Rhetoren; in diesem Amt lehrte er von ca. 1166 an Grammatik, Rhetorik und Philosophie und hielt Reden am kaiserlichen Hof in Konstantinopel, wo er die Freundschaft mächtiger und gebildeter Adliger gewann. Seine philologischen Kommentare sind bis zum heutigen Tag eine Fundgrube, vor allem die zu Homers «Ilias» und «Odyssee». Unter kaiserlicher Protektion stand sein weiterer Aufstieg im Klerus: Um 1177 wurde er zum Bischof von Myra in Lykien nominiert, einer zwischen Byzantinern und Seldschuken umkämpften Region, die Eustathios vermutlich nie besucht hat; dem Einfluss des Kaisers Manuel I. Komnenos verdankte er, dass er stattdessen Erzbischof von Thessalonike wurde, der zweitgrößten Stadt des byzantinischen Reiches. Seine Amtszeit war aber von Auseinandersetzungen mit seiner Diözese geprägt. Er erlebte 1185 die Eroberung Thessalonikes durch die Normannen mit und schilderte sie in einer detaillierten Geschichtsdarstellung. In den letzten Jahren des 12. Jahrhunderts verlieren sich seine Spuren. Von der Verbindung zum Kaiserhof in Konstantinopel, auch noch während seiner Zeit als Erzbischof, zeugen seine Reden an Kaiser Manuel, die in diesem Band übersetzt sind (Reden O, M, N und K in der Edition von Peter Wirth). Sie können als Muster der enkomiastischen Preisrede gelten und zeigen byzantinische Rhetorik in Vollendung. Die Reden O, M und N entwerfen groß angelegte Bilder der Geschichte und Gegenwart des Byzantinischen Reiches; in Rede O und M geht es um ein Panorama der Außenpolitik; es wird in Rede O in einer großen Gesandtschaftsszene entfaltet, in Rede M im detaillierten, wenn auch aus vielen Anspielungen zu entschlüsselnden Bild der militärisch-diplomatischen Erfolge bei den Nachbarn, die die historische Entwicklung bestimmten. Rede N führt den Blick in die geschichtliche Tiefe: Ein idealer Zustand unter römischer Herrschaft ging durch die Auseinandersetzung mit den Seldschuken in eine Phase des Verfalls über und wurde durch die Reihe der Komnenenkaiser Alexios, Johannes und Manuel wieder zur Größe geführt. In allen Reden rühmt Eustathios gemäß der Topik der Kaiserrede militärische Erfolge des Kaisers; so wird in O und M über den Vorrang der Siege im Osten und im Westen gestritten, Rede N preist den Sieg in der Ebene des Mänander. Doch in Rede K, hier zum ersten Mal übersetzt, weicht das enkomiastische Feiern dem inständigen Appell, Kaiser Manuel möge künftig seine Gesundheit schonen und sich statt auf die militärischen auf die bedeutenden Aufgaben in Innenpolitik und dogmatischen Streitfragen konzentrieren. Diese Rede wurde offenbar gehalten, als Manuel schon Zeichen der Krankheit zeigte, die dann zu seinem Tod im September 1180 führte. Diese fremde Welt des Byzanz im 12. Jahrhundert wird in diesem Buch von verschiedenen Seiten erschlossen: Einleitungen führen in die Gattung der Preisrede in Byzanz ein, geben eine Übersicht über Leben und Werk des Eustathios und analysieren den Aufbau der einzelnen Reden, deren Stil und Auswahl erläutert werden. Ausführliche Anmerkungen zur Übersetzung erläutern den historischen Hintergrund und die literarische Gestaltung; eine wichtige Rolle spielt dabei die Entschlüsselung der Anspielungen und Zitate. Ein Register beschließt den Band. |
|
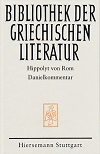 |
Hippolyt von Rom Danielkommentar Hiersemann, 2016, 211 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1614-0 198,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 80 Eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Katharina Bracht. Der Danielkommentar des Hippolyt von Rom, um 204 n. Chr. Verfasst, gilt als die älteste vollständig erhaltene Auslegung eines biblischen Textes aus christlicher Feder. Sein Autor, dessen Identität in der patristischen Forschung zwar intensiv, aber bislang ohne konkretes Ergebnis diskutiert wird, darf als innovativer Pionier christlicher Exegese bezeichnet werden. Sein Danielkommentar bietet daher einen einzig artigen Einblick in die Frühzeit des christlichen Bibelkommentars, d. h. einer Textgattung, die, mit allfälligen Modifikationen, in der gesamten Christentumsgeschichte gepflegt wurde. Bis in die Gegenwart werden Bibelkommentare von den exegetischen Wissenschaften produziert und von Studierenden und Lehrenden der Theologie, von Pfarrerinnen und Pfarrern, kirchlichen Mitarbeitern sowie anderen Interessierten verwendet. Mit dem vorliegenden Band wird der Danielkommentar des Hippolyt erstmals in einer deutschen Übersetzung vorgelegt. Beigegeben ist ein Kommentar zu diesem Kommentar: Hatte Hippolyt damals seinem Prätext, dem biblischen Danielbuch, einen Kommentar in Form eines Paratextes an die Seite gestellt, um seiner Leserschaft zu erklären, was an dem zu jener Zeit ca. 370 Jahre alten Danielbuch unverständlich geworden war, so wurde jetzt die Form des Anmerkungskommentars gewählt, um dasselbe Ziel für die heutigen Leser des inzwischen über 1800 Jahre alten Hippolytschen Danielkommentars zu erreichen. Besondere Sorgfalt ist darauf verwendet worden, das Geflecht der zahlreichen intertextuellen Bezüge, die zwischen Hippolyts Auslegung, dem kommentierten Text des Danielbuches und anderen Bibeltexten bestehen, nicht nur durch einen Bibelstellenapparat nachzuweisen, sondern dem heutigen Leser auch typographisch augenfällig zu machen. Die deutsche Übersetzung basiert auf der Textausgabe von Marcel Richard (GCS. NF 7, Berlin 2000), die erstmals den vollständigen griechischen Text bietet. Sie wird ergänzt um eine ausführliche Einleitung zum Autor der Schrift vor dem Hintergrund der so genannten Hippolyt-Frage, zu den Einleitungsfragen des Danielkommentars, zur Danielrezeption und -auslegung des Autors sowie zu seinem Bild von Geschichte und Endzeit im Allgemeinen und des historischen Rahmens der im biblischen Danielbuch geschilderten Ereignisse im Besonderen. Ein Literaturverzeichnis sowie Register der Stellen biblischer und anderer antiker Schriften wie auch der Personen, Orte und Sachen runden den Band ab. |
|
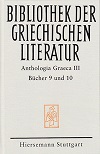 |
Anthologia
Graeca. Band 3: Bücher 9 und 10 Hiersemann, 2016, 323 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1611-9 228,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 79 Bearbeitung: Dirk Uwe Hansen; Jens Gerlach; Christoph Kugelmeier; Peter von Möllendorff; Kyriakos Savvidis Beschreibung siehe Band 1 BGL 72: Band 1: Bücher 1 bis 5 ISBN 978-3-7772-1117-6 BGL 76 Band 2: Bücher 6 bis 8 ISBN 978-3-7772-1408-5 BGL 79 Band 3: Bücher 9 und 10 ISBN 3 978-3-7772-1611-9 BGL 89 Band 4: Bücher 11 bis 14 ISBN 978-3-7772-1920-2 BGL 93 Band 5, Bücher 15 und 16 ISBN 978-3-7772-2123-6 |
|
 |
Libanios Musterreden Hiersemann, 2015, 318 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1510-5 198,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 78 Bearbeitung Ulrich Lempp Eingeleitet, aus dem Altgriechischen ins Deutsche übersetzt und kommentiert von Ulrich Lempp. Libanios (314 - ca. 393 n. Chr.) ist der produktivste und am besten überlieferte altgriechische Prosa-Autor und Sophist seiner Zeit. Die 63 Reden und die mehr als 1500 Briefe stellen wichtige Quellen dar für die Krisen des historisch und theologisch so bedeutsamen 4. Jahrhunderts. So sind und waren sie immer im Blickpunkt der Forschung. Anders ist der Befund bei den 51 Musterreden (declamationes) des Libanios. Sie sind wichtig als Textzeugnisse für die Qualität, die Bedeutung und die Reichweite seines Rhetorikunterrichts; der Autor hat dies selbst dokumentiert, und die Wirkungsgeschichte hat diese Einschätzung bestätigt. Freilich: Anders als Libanios' Reden stehen seine Musterreden der Zeit ihrer Entstehung und sogar der Biographie ihres Autors auffallend fern. Im Rhetorik-Lehrbetrieb des 4. Jahrhunderts waren offenbar Personen, Themen und literarische Muster der klassischen griechischen Zeit noch lebendig, selbst nach 700 und mehr Jahren; auch die Sprache orientiert sich an den Klassikern der Vergangenheit, vor allem an Demosthenes. Für diesen Übersetzungsband wurden 15 Musterreden des Rhetoriklehrers (etwa in Athen, Konstantinopel und Antiochia) ausgewählt. Es sind (in der maßgeblichen Ausgabe von R. Förster) die Musterreden 1, 5, 6, 12, 25-28, 30-32, 39, 41, 42 und 46. Bei ihnen ist die Echtheit unbestritten, zudem vermitteln sie einen Eindruck von der Breite des Themenspektrums und vom Reichtum der rhetorischen Gestaltungsmittel; ihre Wirkungsgeschichte war ein weiterer Gesichtspunkt bei der Auswahl. Ein Typ der Musterreden hat historisch bzw. literarisch beglaubigte Personen und Redesituationen zur Grundlage: Sokrates, Achilleus, Orestes oder der Menschenhasser Timon von Athen sind die Hauptfiguren; weil aber die Musterreden nach dem Vorbild der klassischen Rhetorik durchweg agonal angelegt sind, finden sich in den Texten jeweils auch die Gegner, also Sokrates' Ankläger, Odysseus, Klytaimnestra mit Aigisthos und Alkibiades. Und natürlich reiht sich der belesene Autor mit seiner eigenen Stimme bewusst ein in die literarische Vielstimmigkeit, die lange vor ihm begonnen hat (und die sich nach ihm dann weiter fortsetzt – bis in unsere Zeit). Wichtig ist ein Funktionswechsel innerhalb der Rhetorik: Anders als der «echte» Redner (und der Redenschreiber) der klassischen Zeit ist unser Autor nicht mehr auf das Ziel fixiert, ein Gremium argumentativ zu überzeugen, auch Sympathie zu gewinnen und dadurch in der Debatte zu siegen. In Musterreden hat der Autor vielmehr die Freiheit, auch «Verliererreden» zu gestalten. Dies gilt insbesondere für den zweiten Typ der Musterreden: Geizige, Neidische, unsympathische Väter, Parasiten und ähnliche Figuren, die auch aus der «Neuen» Komödie der Griechen bekannt sind, treten, oft in einem juristischen, aber wohl erfundenen Kontext, als Redner auf und offenbaren dabei ihren häufig bizarren Charakter. Eine umfassende Einführung informiert über den Autor und seine Zeit sowie über die Gattung und Eigenart der Musterreden; Beobachtungen zur rhetorischen Gestaltung ergänzen das Gattungsprofil. Schließlich geht es um die Frage, wie die Musterreden in das bisherige Libanios-Bild passen bzw. es ergänzen. Anmerkungen zur Übersetzung liefern notwendige Sachinformationen sowie sprachliches und literarisches Hintergrundwissen. Ein Register erschließt die Musterreden und ermöglicht den punktuellen Zugriff. |
|
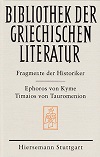 |
Fragmente der Historiker: Ephoros von Kyme und Timaios von
Tauromenion Hiersemann, 2015, 368 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1506-8 198,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 77 Bearbeitung; Jörg-Dieter Gauger; Barbara Gauger Ephoros von Kyme (FGrHist 70) und Timaios von Tauromenion (FGrHist 566) Mit Ausnahme Xenophons (gest. etwa 355 vor Chr.) präsentiert sich die Geschichts-schreibung des 4. vorchristlichen Jahrhunderts als Trümmerfeld; gleiches gilt für das 3. Jahrhundert. Die bedeutendsten Repräsentanten dieser Epoche, Theopomp (BGL Band 70), Ephoros und Timaios, sind wenigstens in mitunter spärlichen Fragmenten an teilweise sehr entlegener Stelle bis hin zur Spätantike und Byzanz erhalten, die uns auch nur in engen Grenzen erlauben, ihre Geschichtswerke und ihre Eigenheiten zu rekonstruieren. Der nach Theopomp meistzitierte Autor ist Ephoros von Kyme (* ca. 405 vor Chr.), Verfasser u. a. der ersten «Universalgeschichte», die mit der «Rückkehr der Herakliden» einsetzt und mit der Belagerung Perinths durch Philipp II. von Makedonien 340 vor Chr. endete. An zweiter Stelle steht Timaios von Tauromenion (ca. 350-260), der führende «Historiker des Westens», dessen Werk neben Sizilien auch Unteritalien und Rom behandelte und das mit dem Ausbruch des 1. Punischen Krieges 264 abschloss. Die vorliegende Über-setzung ihrer griechischen Testimonien und Fragmente ist die erste Übertragung ins Deutsche; sie folgt der Ausgabe von Felix Jacoby, FGrHist 70 und 566, ergänzt um eine ausführliche Einleitung zu Leben, Werk und Charakteristik beider Autoren, Literaturhinweise, eine Übersicht über die sie tradierenden Autoren, Namen- und Ortsregister sowie Anmerkungen zu den einzelnen Belegen. Bei ihnen wurde trotz gebotener Kürze besonderer Wert darauf gelegt, die neueste Literatur einzuarbeiten, um auf diese Weise einen möglichst aktuellen Einblick in die Forschungslage zu vermitteln. Fragmente der Historiker in der BGL: Band 70: Theopomp von Chio ISBN 978-3-7772-1000-1 Band 77: Ephoros von Kyme und Timaios von Tauromenion ISBN 978-3-7772-1506-8 |
|
 |
Anthologia
Graeca. Band 2: Bücher 6 bis 8 Hiersemann, 2014, 456 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1408-5 228,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 76 Ins Deutsche übersetzt und erläutert von Jens Gerlach, Dirk Uwe Hansen, Christoph Kugelmeier, Peter von Möllendorff und Kyriakos Savvidis. Herausgegeben von Dirk Uwe Hansen. Beschreibung siehe Band 1 BGL 72: Band 1: Bücher 1 bis 5 ISBN 978-3-7772-1117-6 BGL 76 Band 2: Bücher 6 bis 8 ISBN 978-3-7772-1408-5 BGL 79 Band 3: Bücher 9 und 10 ISBN 3 978-3-7772-1611-9 BGL 89 Band 4: Bücher 11 bis 14 ISBN 978-3-7772-1920-2 BGL 93 Band 5, Bücher 15 und 16 ISBN 978-3-7772-2123-6 |
|
 |
Dionysius von Halikarnass Römische Frühgeschichte. Band 1: Bücher 1 bis 3 Hiersemann, 2014, 366 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1404-7 194,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 75 Eingeleitet, aus dem Altgriechischen ins Deutsche übersetzt und kommentiert von Nicolas Wiater Die Römische Frühgeschichte des Dionysius aus dem kleinasiatischen Halikarnassos ist eines der wichtigsten Dokumente griechischer Kultur im Augusteischen Rom. Dionysius war nach dem Ende der Bürgerkriege ca. 30 v. Chr. Nach Rom gekommen. Dort unterrichtete er gebildete Griechen und Römer in Stil und Ästhetik der „klassischen“ griechischen Literatur, vornehmlich jener Werke also, die im fünften und vierten Jahrhundert v. Chr. In Athen entstanden waren. Gleichzeitig arbeitete Dionysius an einem historischen Großprojekt: Auf der Grundlage lateinischer wie griechischer historischer und antiquarischer Darstellungen schuf er in ursprünglich 20 Büchern eine detaillierte Beschreibung der Geschichte des römischen Volkes von seinen Ursprüngen über die Stadtgründung, die Königszeit und die Frühzeit der res publica bis zum Ausbruch des Ersten Punischen Krieges (264 v. Chr.). Neben einer echten Faszination für die Römer motivieren die aus griechischer Sicht besonders drängenden Fragen nach dem Wesen der Römer, den Gründen für ihre gewaltige Machtstellung und ihrem Verhältnis zu den Griechen das Werk. Zusammen mit der umfassenden Darstellung der römischen Geschichte des Livius stellt die Römische Frühgeschichte die wichtigste antike Auseinandersetzung mit der römischen Frühzeit dar. Wegen seines unterschätzten, ja sogar angezweifelten Wertes als historische Quelle und seines angeblichen «rhetorischen» Charakters fand die Geschichtsdarstellung des Dionysius im 20. Jahrhundert nur wenig Beachtung. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten hat man dessen zentrale Bedeutung für unser Verständnis der griechischen Intellektuellenkultur und kulturellen Identität sowie des griechisch-römischen Kulturaustauschs im späten Hellenismus und der frühen römischen Kaiserzeit zu schätzen gelernt. Diesem Rezeptionswandel Rechnung tragend, wird nun seit über 150 Jahren erstmals wieder eine deutsche Gesamtübersetzung der Römischen Frühgeschichte vorgelegt. Deren erster Band enthält neben der annotierten Übersetzung der ersten drei ‚Bücher‘ eine umfassende Einleitung, die das Oeuvre des Dionysius auf der Grundlage der neuesten Forschung in seinem kulturellen und historischen Kontext erschließt, ausführlich den Quellenwert der Frühgeschichte diskutiert und Stil und Überlieferungsgeschichte des Werkes charakterisiert. Die weitere Beschäftigung mit dem Text wird durch einen Index für Personen, Namen und Sachen erleichtert. In den kommenden Jahren werden weitere Teilbände die gleichfalls vollständig erhaltenen Bücher vier bis zehn sowie die Fragmente der Bücher elf bis zwanzig präsentieren. BGL 75: Band 1: Bücher 1 bis 3 ISBN 978-3-7772-1404-7 BGL 85: Band 2: Bücher 4 bis 6 ISBN 978-3-7772-1803-8 |
|
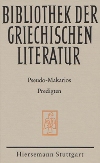 |
Pseudo-Makarios Predigten Aus den Sammlungen C und H Hiersemann, 2013, 440 Seiten, 240, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1301-9 220,00 EUR Bibliothek der griechischen Literatur Band 74 |
Bearbeitung: Martin Illert Unter dem Namen des Mönchsvaters Makarios von Ägypten sind vier große Textsammlungen überliefert, von denen bislang nur die „Fünfzig Geistlichen Homilien“ in der „Bibliothek der Kirchenväter“ und die „Reden und Briefe“ in Band 52 der „Bibliothek der Griechischen Literatur“ in einer deutschen Übersetzung zugänglich sind. Mit den hier übersetzen „Predigten“ liegen nun auch das Sondergut einer dritten, 1961 von Erich Klostermann und Heinz Berthold edierten Sammlung sowie die sieben Homilien des 1918 von George Leicester Marriott herausgegebenen Anhangs zu den „Fünfzig Geistlichen Homilien“ in deutscher Sprache vor. Die jedoch zu Unrecht dem ägyptischen Mönchsvater zugeschriebenen „Predigten“ wurden von einem Anonymus verfasst, der in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts im römisch-persischen Grenzraum lebte und dort eine asketische Gemeinschaft leitete. Pseudo-Makarios' Schriften zählen zu den wichtigsten Zeugnissen der griechisch-syrischen Brückenkultur im spätantiken Orient. Im Unterschied zu seinen Zeitgenossen Basilios dem Großen, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa entfaltet Pseudo-Makarios sein theologisches Denken nicht mittels dogmatischer Defi nitionen. Vielmehr verwenden seine „Predigten“ eine Fülle von Metaphern und Symbolen. Ihre Bilder aus dem Hofl eben, dem städtischen Patronage- und Klientelsystem, dem Handel, der Landwirtschaft oder dem militärischen Leben machen die „Predigten“ auch zu einer beachtenswerten Quelle für die spätantike Sozialgeschichte. Wie in den Werken der frühen syrischen Literatur, so begegnen auch bei Pseudo-Makarios biblische Sonderlesarten aus dem apokryphen Thomasevangelium und der Evangelienharmonie des Diatessaron. Die hier übersetzten Stücke wurden in byzantinischer Zeit aus älteren Teilsammlungen kompiliert und dokumentieren somit zugleich die Aufnahme der altkirchlichen Theologie durch die mittelalterliche Frömmigkeit des christlichen Ostens. Obwohl die Werke des Pseudo-Makarios für ihre spätantiken und mittelalterlichen Leser nicht durchgehend über jeden Häresieverdacht erhaben waren, übten sie dennoch einen starken Einfluss auf das geistliche Leben des ostkirchlichen Mönchtums aus. Insbesondere ihre Lehre von der Schau des göttlichen Lichtes im Gebet machte die Schriften des Pseudo-Makarios zu einem Herzstück ostkirchlicher Spiritualität. Der Übersetzung ist ein Quellen und Literaturverzeichnis beigegeben, ebenso ein Verzeichnis der Werke des Pseudo-Makarios. Der Text wird durch Register der Bibelstellen, der biblischen Namen, sowie der antiken und modernen Namen zusätzlich erschlossen. |
|
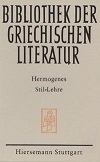 |
Hermogenes Stil-Lehre Hiersemann, 2012, 204 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1215-9 174,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 73 Bearbeitung: Ulrich Lempp Bereits im Alter von 15 Jahren war Hermogenes von Tarsos als Redner so berühmt, dass der römische Kaiser Mark Aurel diesen Wunderknaben persönlich kennenlernen wollte. Diese Begegnung im Jahr 175/6 n.Chr. ergibt eine sichere Datierung des Autors, der später freilich nicht durch Reden, sondern als Verfasser rhetorischer Fachliteratur bekannt wurde. Das Suda-Lexikon nennt im 10. Jahrhundert einen „Rhetorik-Lehrgang, den alle heranziehen“, als sein Werk. Erstmals liegt jetzt die „Stil-Lehre“ des Hermogenes in deutscher Übersetzung vor, ein Werk von kanonischer Bedeutung, das sich ausdrücklich an Platons Ideenlehre anlehnt. Sieben „Stilqualitäten“, die sogenannten Ideen, und neun „Komponenten“ erzeugen Texte bestimmter Art - ein System, das gleichermaßen dem Produzieren wie der Beurteilung von Texten nützt. Inhaltlicher Schwerpunkt sind natürlich Reden, und als Muster-Autor wird von Hermogenes immer wieder der geniale Demosthenes herangezogen. Aber auch Homer, Herodot, Platon, Thukydides, Isokrates, Lysias oder Xenophon, Schulautoren damals wie heute, werden ausführlich von Hermogenes zitiert und besprochen. Hermogenes’ Bedeutung spiegelt sich in der schnell einsetzenden, umfangreichen und lange anhaltenden Rezeption wider. Von dem Neuplatoniker Syrianos aus dem 5. Jahrhundert stammt der erste erhaltene Kommentar. Dank der platonischen Tradition überlebt Hermogenes die „dunklen“ Jahrhunderte, wird von byzantinischen Gelehrten gelesen und vielfältig erklärt. Im 16. Jahrhundert, der Renaissancezeit, fand er dann europaweit neues Interesse, Textausgaben sowie Übersetzungen ins Lateinische und in die Landessprachen folgten nach 1508 dicht aufeinander. Sein Einfluss auf die Literatur (z.B. Tasso, Milton, Ben Jonson), auf die Poetik (z.B. Scaliger, Ariost), auf die Universitäten und nicht zuletzt Schulen (z.B. Lehrpläne von Oxford und Cambridge) ist bedeutend. Ziel dieser deutschen Übersetzung ist es, möglichst viele der behandelten sprachlichen Elemente verständlich zu machen, z.B. die Metrik oder den Wortklang eines Zitats äquivalent zu übertragen und nicht erst mit einer Anmerkung nachträglich zu erläutern. Was schon den antiken Kommentatoren auffiel: Sein Text war kein Lehrbuch für Anfänger, sondern eine Art Leitfaden für Fachleute. Zwischen den Hörern von damals und den Lesern von heute liegen nicht nur fast 2000 Jahre, sondern auch ein ganz unterschiedlicher Wissensstand. Mit einer umfassenden Einführung und mit Anmerkungen soll dieser Abstand überbrückt werden. Zwei Register erschließen den Band, erleichtern vor allem auch den punktuellen Zugang: ein Verzeichnis der Namen und der Textzitate und ein Register der rhetorischen Elemente, auf denen Hermogenes seine Stil-Lehre aufgebaut hat. |
|
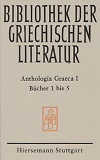 |
Anthologia
Graeca. Band 1: Bücher 1 bis 5 Band 72 der Reihe Bibliothek der griechischen Literatur Hiersemann, 2011, 195 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1117-6 149,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 72 Ins Deutsche übersetzt und erläutert von Jens Gerlach, Dirk Uwe Hansen, Christoph Kugelmeier, Peter von Möllendorff und Kyriakos Savvidis. Herausgegeben von Dirk Uwe Hansen. Fast 4000 griechische Epigramme aus 15 Jahrhunderten überliefert die in den Handschriften cod. Marc. Graec. 481 (Anthologia Planudea [nach dem byzantinischen Gelehrten Maximus Planudes, 13. Jahrhundert]) und cod. Pal. Graec. 3 (Anthologia Palatina [Heidelberg]) erhaltene Sammlung der ,Blütenlese‘ Anthologia Graeca, die hier in einer neuen deutschen Übersetzung vorgelegt wird. Sie entstand aus dem «Kranz», den der Dichter Meleagros von Gadara im 1. Jahrhundert v. Chr aus eigenen und fremden Gedichten geflochten hatte, wurde in der Folgezeit vielfach von Dichtern und Philologen bearbeitet und erweitert und erst tausend Jahre später durch die Redaktoren der palatinischen Handschrift zum Abschluss gebracht. Vom gewöhnlich kurzen, anrührend und schlicht formulierten Liebesgedicht über die Beschreibung antiker Statuen und christlicher Kirchen bis hin zu elaborierten Rätselversen und geistreichen Sprachspielereien findet sich in der Anthologia Graeca die gesamte Bandbreite dessen, was die griechische Literatur zu bieten hat. Viele der hier versammelten Dichter, die seit der Wiederentdeckung der Palatinischen Handschrift im Jahre 1602 vielfältig auf die Literaturgeschichte eingewirkt haben, wären uns ohne diese Anthologie nur schemenhaft oder gar nicht bekannt. Doch nicht nur als Auffangbecken für einzelne Werke ist diese nach Themen geordnete Sammlung wertvoll, auch in ihrer Gesamtheit, ihrer thematischen Vielfalt und literarischen Vielstimmigkeit ist sie ein kultur- und literaturhistorisches Dokument ersten Ranges - das Ganze ist auch hier mehr als die Summe seiner Teile. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach der verdienstvollen, heute aber antiquiert und gekünstelt wirkenden Übersetzung Hermann Beckbys verzichtet die nun herausgegebene moderne Übersetzung auf das Versmaß des Originals und strebt danach, Gedankengang und Stil der einzelnen Gedichte so genau wie möglich wiederzugeben. Dieser erste Band enthält die Bücher 1 (christliche Epigramme), 2 (die Epigramme des Christodoros), 3 (Epigramme aus dem Tempel der Apollonis in Kyzikos), 4 (die Proömien des Meleagros, des Philippos und des Agathias) und 5 (Liebesgedichte). Zwei Register erschließen ihn: ein Verzeichnis der Autoren und eines der Namen und Sachen. BGL 72: Band 1: Bücher 1 bis 5 ISBN 978-3-7772-1117-6 BGL 76 Band 2: Bücher 6 bis 8 ISBN 978-3-7772-1408-5 BGL 79 Band 3: Bücher 9 und 10 ISBN 3 978-3-7772-1611-9 BGL 89 Band 4: Bücher 11 bis 14 ISBN 978-3-7772-1920-2 BGL 93 Band 5, Bücher 15 und 16 ISBN 978-3-7772-2123-6 |
|
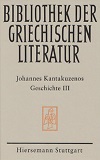 |
Johannes
Kantakuzenos Geschichte. Dritter Teil (Buch III) Hiersemann, 2011, 485 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1112-1 236,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 71 Dieser dritte Teil der «Geschichte» des Kaisers Johannes VI. Kantakuzenos (" 1295; † 1383), der fast den doppelten Umfang aufweist wie die vorigen, umfasst die Ereignisse vom Tod des Kaisers Andronikos III. 1341 bis zum Einmarsch des Kantakuzenos in Konstantinopel 1347. Auch jetzt erhalten wir einen guten Überblick über die historische Lage und über den «schlimmsten Bürgerkrieg seit Menschengedenken», der, so der kaiserliche Autor, aus dem «blühenden und stolzen Reich der Rhomäer («Ostrom») einen Schatten seiner früheren Größe» gemacht hatte. Kaiser Johannes VI. Kantakuzenos ist neben Michael VIII. die bedeutendste Persönlichkeit der byzantinischen Politik der Palaiologenzeit (1259-1453), und sein in vier Bücher eingeteiltes Geschichtswerk, das hier erstmals in deutscher Übersetzung vorgelegt wird, ist für jene krisenreiche Zeit ein ungewöhnlich aufschlussreiches Dokument. Mit gewissenhafter Sorgfalt gibt Kantakuzenos aus eigener Anschauung einen detaillierten Bericht über alle wichtigeren innen- und außenpolitischen Ereignisse der Jahre 1320 bis 1356. Der Leser gewinnt daraus tiefe Einblicke in Entwicklungen, die für die Geschichte des gesamten mittleren Ostens von ausschlaggebender Bedeutung sind. Darüber hinaus gibt das Werk Aufschluss über die Mentalität jener Zeit und über die Kräfte, durch die das Reich ein Jahrhundert später zugrunde gehen sollte. Der Band wird ergänzt durch einen Nachtrag zu Band II und ein Namen- und Sachregister. BGL Bd. 17: Johannes Kantakuzenos: Geschichte I, Erster Teil: Buch I. 1982. VIII, 336 Seiten. Leinen. ISBN 978-3-7772-8221-3. BGL Bd. 21: Johannes Kantakuzenos: Geschichte II, Zweiter Teil: Buch II. 1986. XIV, 291 Seiten. Leinen. ISBN 978-3-7772-8628-0 BGL Bd. 71: Johannes Kantakuzenos: Geschichte III, Dritter Teil: Buch III, 2011, X, 485 Seiten, |
|
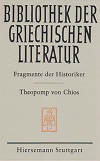 |
Fragmente der Historiker: Theopomp von Chios Hiersemann, 2010, 262 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-1000-1 nicht mehr lieferbar |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 70 Bearbeitung; Jörg-Dieter Gauger; Barbara Gauger FGrHist 115/116 Mit Ausnahme Xenophons präsentiert sich die Geschichtsschreibung des 4. Jahrhunderts v. Chr. Als Trümmerfeld. Die neben Xenophon bedeutendsten Repräsentanten dieser Epoche, nämlich Theopomp, Ephoros und Timaios, sind nur in Fragmenten an teilweise sehr entlegener Stelle erhalten, die uns auch nur in Grenzen erlauben, ihre Geschichtswerke und ihre Eigenheiten zu rekonstruieren. Denn dabei spielt das Auswahlinteresse des überliefernden Autors eine entscheidende Rolle. Der bis in die Spätantike und in die byzantinische Zeit meistzitierte Autor ist Theopomp mit ca. 462 Testimonien und Fragmenten sehr unterschiedlichen Umfangs und Inhalts bis hin zu reinen Ortsangaben. Theopomp, geb. um 378/377 v. Chr. Auf Chios und gest. nach 323, ist Verfasser u.a. einer „Epitome Herodots“ (der ersten in der griechischen Geschichtsschreibung), einer „Hellenika“ (12 Bücher), die an Thukydides anschloss (411-394 v. Chr.), vor allem aber der „Philippika“, mit denen erstmals eine Herrschergestalt, Philipp II. von Makedonien und seine Expansion in Griechenland, ins Zentrum einer historischen Darstellung rückt (360-336 v.Chr.; 16 von 58 Büchern beziehen sich nur auf ihn). Eingebettet freilich ist dies Werk in eine universalgeschichtliche Perspektive und verbunden mit zahlreichen Exkursen. Die vorliegende Übersetzung seiner Testimonien und Fragmente ist die erste Übertragung ins Deutsche; sie folgt der Ausgabe von Felix Jacoby, FGrHist 115, ergänzt um eine ausführliche Einleitung zu Leben, Werk und Charakteristik Theopomps, Literaturhinweisen, Übersicht über die tradierenden Autoren, Namen- und Ortsregister und einem Kommentar zu den einzelnen Belegen, bei dem trotz gebotener Kürze besonderer Wert darauf gelegt wurde, die neueste Literatur einzuarbeiten, um auf diese Weise einen möglichst aktuellen Einblick in die Forschungslage zu vermitteln. Fragmente der Historiker in der BGL: Band 70: Theopomp von Chio ISBN 978-3-7772-1000-1 Band 77: Ephoros von Kyme und Timaios von Tauromenion ISBN 978-3-7772-1506-8 |
|
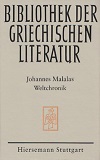 |
Johannes Malalas Weltchronik Band 69 der Reihe Bibliothek der griechischen Literatur Hiersemann, 2009, 266 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0911-1 238,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 69 Übersetzt von Prof. Dr. Johannes Thurn (†) und Prof. Dr. Mischa Meier (Bearb.). Mit einer Einleitung von Claudia Drosihn, Mischa Meier und Stefan Priwitzer und Erläuterungen von Claudia Drosihn, Katharina Enderle, Mischa Meier und Stefan Priwitzer Die Weltchronik des Johannes Malalas stellt das früheste erhaltene Beispiel einer byzantinischen Chronik dar. Das umfangreiche Werk, das in 18 „Büchern“ die Geschichte der Welt von der Schöpfung bis in die eigene Zeit des Autors erzählt, entstand wahrscheinlich nach dem Jahr 565 (Todesjahr Kaiser Justinians I.) in Antiocheia (heute Antakya in der Südosttürkei) und Konstantinopel. Der Autor, ein frommer Christ, der offenkundig eine gehobene Bildung besaß, war vermutlich in der römischen Provinzialverwaltung tätig, wo er Zugang zu wichtigen Aktien und Archiven hatte. Die Weltchronik des Johannes Malalas stellt in vielerlei Hinsicht ein einzigartiges Werk dar: Als christliche Chronik gibt sie beispielhaft Einblicke in das Geschichtsbild christlicher Zeitgenossen in der ausgehenden Spätantike, erweitert die vorgegebenen Gattungskonventionen aber permanent durch eigenständige, neue Ideen und Aspekte (z. B. Naturkatastrophen); als wichtige Quelle für die Ereignisse des späteren 5. und des 6. Jahrhunderts n. Chr. bereichert sie unsere Kenntnisse über eine zentrale Umbruchzeit der römischen und europäischen Geschichte; als monumentale Gesamtdarstellung der Vergangenheit bildete das Werk überdies den Ausgangspunkt zahlreicher späterer byzantinischer Chroniken, die sich entweder vielfach auf Johannes Malalas beriefen oder direkt Passagen aus seiner Chronik kopiert haben. Das wichtige Geschichtswerk des Johannes Malalas liegt nun erstmals in deutscher Übersetzung vor. Eine ausführliche Einleitung sowie kurze Anmerkungen und Verständnishilfen und Register (Namen; geographische Begriffe; Sachen) erleichtern dem Leser den Zugriff auf die Chronik, die zu den bedeutendsten historiographischen Schöpfungen der Spätantike zählt. Mischa Meier ist Professor und Direktor der Abteilung für Alte Geschichte des Historischen Seminars an der Universität Tübingen. |
|
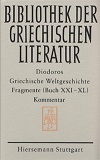 |
Diodoros Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Zweiter Halbband: Kommentar Hiersemann, 2008, 305 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0803-9 159,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 68 Bearbeitung: Gerhard Wirth; Diodor von Agyrions (1. Jahrhundert v. Chr.) «Bibliothek» ist die einzige in großen Teilen erhaltene vorchristliche Weltgeschichte. Sie reicht von der Entstehung der Welt bis in die Gegenwart des Verfassers, also in die Zeit der Eroberungen Caesars. Sein Ziel war es, «möglichst alle überlieferten historischen Ereignisse der ganzen Welt» in einem Werk zusammenzufassen. Dieses monumentale Geschichtswerk ist eines der umfangreichsten und kompaktesten, das aus der Antike bekannt ist. Der Autor selbst wählte den programmatisch passenden Titel, da er mit seinem Opus eine ganze historische Bibliothek ersetzen wollte. Diesen nicht unbescheidenen Vorsatz setzte er didaktisch geschickt um. So zeichnete Diodor für seine Leser die großen Entwicklungslinien der Weltgeschichte nach und machte sie mit den berühmten Personen vergangener Tage bekannt. Wegen ihrer offensichtlichen Vorzüge wurde seine «Bibliothek» gerade seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. gerne gelesen. Die Christen schätzten an ihr zudem den leicht moralisierenden Grundtenor. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die erhaltenen Partien der «Weltgeschichte» von hohem Quellenwert sind. So liefern etwa die Bücher 1 bis 5 und 11 bis 20 wie auch die zahlreichen Fragmente aus der dritten und vierten Dekade wertvolle Informationen. Zudem wirken seine sozialgeschichtlichen Passagen für den heutigen Leser überraschend modern. Und schließlich ist Diodors Weltgeschichte über weite Strecken die einzige noch existierende Quelle, die eine zusammenhängende Darstellung der historischen Ereignisse in der mediterranen Welt bietet. Die vollständig vorliegende deutsche Übersetzung des Gesamtwerkes – die erste seit über 150 Jahren – trägt dieser neuen Sicht der Forschung auf Diodor und sein Werk Rechnung. Die jeweils ausführlichen Band-Einleitungen ermöglichen ebenso wie die philologischen und historiographischen Kommentare einen Blick auf das Selbstverständnis einer großen Epoche. BGL Band 34 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9218-2 BGL Band 35 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X 978-3-7772-9220-5 BGL Band 45 Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII 978-3-7772-9739-2 BGL Band 55 Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV 978-3-7772-0125-2 (Beschreibung der Ausgabe) BGL Band 34 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9218-2 BGL Band 35 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X 978-3-7772-9220-5 BGL Band 45 Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII 978-3-7772-9739-2 BGL Band 55 Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV 978-3-7772-0125-2 (Beschreibung der Ausgabe) BGL Band 63 Griechische Weltgeschichte. Buch XVIII - XX. BGL Band 63.1 Griechische Weltgeschichte. Buch XVI BGL Band 63.2 Griechische Weltgeschichte. Buch XVII BGL Band 67 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Erster Halbband: Einleitung und Übersetzung BGL Band 68 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Zweiter Halbband: Kommentar |
|
 |
Diodoros Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Erster Halbband: Einleitung und Übersetzung Hiersemann, 2008, 305 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0802-2 159,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 67 Bearbeitung: Gerhard Wirth; Der griechisch-sizilianische Geschichtsschreiber Diodor (1. Jahrhundert v. Chr.) ist mit seiner „historischen Bibliothek“ als Quelle für Historiker, Philologen, Ethnologen, Archäologen und für alle an der Antike Interessierten von unbestreitbarem Wert. Von keinem anderen Geschichtsschreiber ist uns ein vergleichbar umfangreiches Geschichtswerk aus der klassischen Antike überliefert. Die vollständige Neuübersetzung Diodors Universalgeschichte im Verlag Anton Hiersemann weist mit dem hier anzuzeigenden Doppelband, der die Fragmente der Bücher XXI-XL umfasst, nunmehr sieben Bände auf und steht unmittelbar vor dem Abschluss. Diese Bücher sind für das Verständnis des Autors von zentraler Bedeutung, reichen sie doch bis in die von ihm selbst erlebte Zeit hinein. Zudem sind die zum Teil sehr umfangreichen Fragmente ohne Parallele, liefern mithin zahlreiche wichtige Detailinformationen für die behandelte Zeit. Chronologisch umfasst die hier vorliegende dritte und vierte Dekade die Ereignisse zwischen 301 (Schlacht bei Ipsos) und 60/59 (Konsulat Caesars). Trotz der fragmentarischen Überlieferung wird deutlich, wie sehr sich der Autor für die politischen und sozialen Verwerfungen des späten zweiten und ersten Jahrhunderts interessierte. Seine persönliche Sicht der Dinge, die er in den vorangegangen Büchern nur andeutete, kommt auf eine spezifische Weise zum Tragen. Diodor bietet einen eigenen, einen provinzialen Blick auf die Aufstiegsphase Roms zur Weltmacht. Mit dieser Übersetzung von Prof. Dr. Gerhard Wirth liegt seit der Ausgabe von Julius Friedrich Wurm aus dem Jahr 1840 erstmals wieder ein zuverlässiger deutschsprachiger Text vor. Der vom Übersetzer ebenfalls verfasste Kommentarteil bietet neben detaillierten Erläuterungen zu Sachfragen und Parallelüberlieferung eine umfangreiche Bibliographie, Listen hellenistischer Herrscher sowie einen Index. BGL Band 34 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9218-2 BGL Band 35 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X 978-3-7772-9220-5 BGL Band 45 Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII 978-3-7772-9739-2 BGL Band 55 Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV 978-3-7772-0125-2 (Beschreibung der Ausgabe) BGL Band 34 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9218-2 BGL Band 35 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X 978-3-7772-9220-5 BGL Band 45 Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII 978-3-7772-9739-2 BGL Band 55 Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV 978-3-7772-0125-2 (Beschreibung der Ausgabe) BGL Band 63 Griechische Weltgeschichte. Buch XVIII - XX. BGL Band 63.1 Griechische Weltgeschichte. Buch XVI BGL Band 63.2 Griechische Weltgeschichte. Buch XVII BGL Band 67 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Erster Halbband: Einleitung und Übersetzung BGL Band 68 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Zweiter Halbband: Kommentar |
|
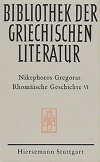 |
Nikephoros Gregoras Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Sechster Teil: Kapitel XXX - XXXVII Hiersemann, 2007, 215 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0707-0 128,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 66 Übersetzt und erläutert von Jan-Louis van Dieten BGL 4 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Erster Teil: Kapitel I - VII 978-3-7772-7309-9 BGL 8 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 1. Halbband: Kapitel VIII - IX ,6 978-3-7772-7904-6 BGL 9 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 2. Halbband: Kapitel IX,7 - XI 978-3-7772-7919-0 BGL 24 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Dritter Teil: Kapitel XII - XVII 978-3-7772-8805-5 BGL 39 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Vierter Teil: Kapitel XVIII - XXIV,2 978-3-7772-9402-5 BGL 59 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Fünfter Teil: Kapitel XXIV,3 - XXIX 978-3-7772-0300-3 BGL 66 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Sechster Teil: Kapitel XXX - XXXVII 978-3-7772-0707-0 |
|
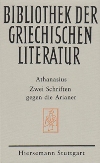 |
Athanasius Zwei Schriften gegen die Arianer Anton Hiersemann, 2006, 400 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0605-9 198,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 65 Verteidigungsschrift gegen die Arianer (Apologia contra Arianos). Geschichte der Arianer (Historia Arianorum) Eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Werner Portmann. siehe dazu auch: Fontes Christiani Band 38, Streitschrift gegen die Arianer |
|
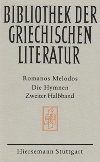 |
Romanos Melodos Die Hymnen Zweiter Halbband Hiersemann, 2006, 440 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0606-6 220,00 EUR Bibliothek der griechischen Literatur Band 64 zu BGL 62: Erster Teiband |
Romanos Melodos, ein Zeitgenosse des
byzantinischen Kaisers Justinian I., galt bei den Byzantinern
und gilt bis heute in der Orthodoxie als der bedeutendste
Dichter und Komponist kirchlicher Hymnen. Von den rund neunzig
Texten, die in den byzantinischen Handschriften den Autornamen
des Romanos tragen, sind wahrscheinlich zwei Drittel tatsächlich
ihm zuzuschreiben. Sie zeichnen sich durch besondere
Bildhaftigkeit und Lebendigkeit der Sprache aus. Diese als
"Kontakia" bezeichneten Hymnen wurden geschaffen, um im Rahmen
von kirchlichen Feiern (Meßliturgien, Nachtwachen) rezitiert zu
werden. Die Dichtungsform entstand wahrscheinlich im 5.
Jahrhundert, als Blütezeit gilt die Schaffenszeit des Romanos,
also die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts. Übersichtliche
Strophengliederung, akzentuierende Metren, stark rhythmischer
Gesang und die Beteiligung der Gläubigen, die in den Refrain am
Ende jeder Strophe einstimmten, machten das Kontakion zu einem
wirksamen Instrument eindringlicher Glaubensverbreitung. Die als echt angesehenen Hymnen des Romanos übersetzt Johannes Koder in die deutsche Sprache. Hierbei erfolgt die Ordnung der Hymnen in Anlehnung an den Festkalender der orthodoxen Kirche. Daher umfaßt die erste Gruppe sechzehn Hymnen der Kirchenfeste mit festem Datum zwischen dem 8. September (Geburt der Gottesgebärerin) und dem 29. August (Enthauptung Johannes des Täufers). Es folgt als zweite Gruppe die der 26 Hymnen der vorösterlichen Vorfasten- und Fastenzeit und als dritte Gruppe die der achtzehn Hymnen für die österliche und nachösterliche Zeit. Die Übersetzung sucht in Stil und Wortwahl die Liturgienähe der Originaltexte zu vermitteln, ohne "dichterisch" zu sein oder den Versuch zu unternehmen, die Originale nachzuempfinden. Die der Übersetzung vorangehende Einleitung stellt nicht nur den Hymnographen und sein Werk vor, sondern führt auch in das historische und literarische Umfeld ein. Die Anmerkungen bieten in knapper Form Erläuterungen zur Textgestaltung, zum Inhalt und zum kirchlichen Festbezug, weiters Hinweise auf Parallelen in anderen Texten, wobei Schwerpunkte bei der Bibel und bei Ephraim dem Syrer gesetzt werden. Dieser erste Teilband enthält die Einleitung und die ersten 32 Hymnen, der zweite wird weitere dreißig sowie den (nicht von Romanos geschaffenen) Akathistos Hymnos enthalten. Die Hymnen des Romanos Melodos, über eineinhalb Jahrtausende hinweg unbestrittener Höhepunkt orthodoxer Poesie, bieten einen unmittelbaren Zugang zur Geisteswelt der christlichen Spätantike und des frühen Mittelalters. Sie tragen heute dazu bei, die vermeintlich fremde byzantinische Kultur, die für das heutige Europa prägend war, besser zu verstehen. Darüber hinaus spiegeln die Hymnen den Wesenskern eines gesamtkirchlichen Glaubensverständnisses wider und eröffnen Lesern und Hörern einen unmittelbaren, kraftvollen und zugleich dichterischen Zugang zu christlichem Denken aus der Zeit vor Schismen und Glaubensspaltungen. |
|
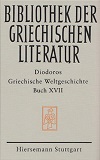 |
Diodoros Griechische Weltgeschichte. Buch XVII Hiersemann, 2009, 211 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0914-2 139,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 63.2 Bearbeitung: Moritz Böhme; Otto Veh 1 Karte mit dem Persienfeldzug Alexanders des Großen Mit dem 17. Buch dieser universalen «Weltgeschichte», das die Regierungszeit Alexanders des Großen (336 - 323 v.Chr.) behandelt, ist die neue Gesamtübersetzung dieses gewaltigen Werkes des griechisch-sizilianischen Historikers Diodor von Agyrion (heute: Agira / Sizilien; 1. Jh. v.Chr.) abgeschlossen. Das Buch beinhaltet den ältesten und einzig vollständig aus der Antike überlieferten Bericht über Alexander den Eroberer und Städtegründer. Seine Taten und ihre Folgen blieben bis in Diodors eigene Zeit hinein spürbar, erweiterten sie doch den geographischen und kulturellen Horizont der Griechen auf beispiellose Weise. Zusammen mit den später abgefassten Darstellungen Iustins und des Curtius Rufus bildet der Alexanderbericht Diodors die sogenannte Vulgata-Überlieferung, die in der Antike am weitesten ver breitete Version der Alexandergeschichte. In der Konzeption des Gesamtwerks markiert das 17. Buch zusammen mit Buch 16 (= BGL Band 63/1), das die Regierungszeit des makedonischen Königs Philipp II. (360/59 – 336/35) behandelt, einen Höhe- und Wendepunkt. Die aus dem Nachlass des Würzburger Philologen Otto Veh stammende Übersetzung wurde von Moritz Böhme bearbeitet und mit einer Einleitung sowie einem Kommentarteil zu Sachfragen, Parallelüberlieferungen und Forschungsliteratur versehen. Eine ausführliche Bibliographie und ein Index vervollständigen den Band. Eine Karte demonstriert die Feldzüge Alexanders. BGL Band 34 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9218-2 BGL Band 35 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X 978-3-7772-9220-5 BGL Band 45 Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII 978-3-7772-9739-2 BGL Band 55 Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV 978-3-7772-0125-2 (Beschreibung der Ausgabe) BGL Band 34 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9218-2 BGL Band 35 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X 978-3-7772-9220-5 BGL Band 45 Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII 978-3-7772-9739-2 BGL Band 55 Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV 978-3-7772-0125-2 (Beschreibung der Ausgabe) BGL Band 63 Griechische Weltgeschichte. Buch XVIII - XX. BGL Band 63.1 Griechische Weltgeschichte. Buch XVI BGL Band 63.2 Griechische Weltgeschichte. Buch XVII BGL Band 67 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Erster Halbband: Einleitung und Übersetzung BGL Band 68 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Zweiter Halbband: Kommentar |
|
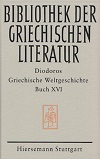 |
Diodoros Griechische Weltgeschichte. Buch XVI Hiersemann, 2007, 209 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0700-1 128,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 63.1 Bearbeitung: Thomas Frigo; Otto Veh In seiner in der Mitte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts niedergeschriebenen «Weltgeschichte» wollte Diodor aus Agyrion (Sizilien) in geographisch umfassender Darstellung die universalen Geschehnisse von den Frühzeiten der Götter und Menschen bis in seine Gegenwart, die Jahrzehnte der Feldzüge Caesars, schildern. Diodors auf 40 Bücher konzipierte «Bibliotheke», eine zu mehr als einem Drittel vollständig überlieferte und für die Altertumswissenschaften hoch bedeutsame Quelle, ist mit diesem Buch XVI an einer Zäsur der griechischen Geschichte angelangt: der Regierungszeit König Philipps II. von Makedonien (359–336). Zentrales Thema des XVI. Buchs ist der von Philipp, dem Vater Alexanders des Großen, so rücksichtslos wie zielstrebig und erfolgreich betriebene Aufstieg des den Griechen noch als halbbarbarisch-rückständig geltenden, zudem um 360 militärisch angeschlagenen Makedonien zur hellenischen Hegemonialmacht, die in der Schlacht von Chaironeia (338) über Athen und Theben triumphieren und sich bald darauf zur Invasion des Perserreichs anschicken konnte. Angesichts des rudimentären Erhaltungszustands der zeitgenössischen Geschichtsschreibung (Theopomp, Ephoros) ist Diodors Buch XVI als wichtigster zusammenhängender historiographischer Bericht über die Epoche Philipps einzuschätzen. Sein besonderer Reiz liegt auch darin, daß Diodors würdigende Darstellung der Leistungen des Makedonenkönigs ein wohltuendes Korrektiv zu den maliziös verzerrten, das Geschichtsbild jedoch nachhaltig prägenden Wertungen der zeitgenössischen athenischen Rhetorik (Demosthenes) bietet. Das vorliegende Buch wendet sich darüber hinaus in einem längeren Exkurs dem achaimenidischen Perserreich zu, das – am Vorabend des Alexanderzugs – unter Artaxerxes III. (359-338) einen letzten Gipfel seiner Machtstellung erreichte. Auch setzt Diodor die Schilderung der Wirren und Bürgerkriege in seiner sizilischen Heimat fort, mit eingehenden Beschreibungen der Kämpfe zwischen dem Tyrannen Dionysios II. von Syrakus († nach 338) und dessen Widersachern Dion sowie Timoleon. Diodors XVI. Buch, das in seiner Quellenbasis strittig ist und gehäufte chronologische Unklarheiten aufweist, erscheint einerseits als verwirrendes, eher schwer zugängliches Werk; es ist andererseits eine unverzichtbare Grundlage der Historiographie zum 4. Jahrhundert v. Chr. und markiert, gemeinsam mit der Alexandergeschichte des XVII. Buchs, einen Höhepunkt in der Konzeption der «Bibliotheke». Unter den Aspekten der immanenten Problematik wie auch der herausragenden Bedeutung von Diodor XVI und XVII werden beide Bücher in separaten Bänden vorgelegt. Die aus dem Nachlaß des Würzburger Philologen Dr. Otto Veh stammende Übersetzung ist von Thomas Frigo M.A. (Berlin) bearbeitet und mit einer ausführlichen Einleitung sowie einem detaillierten Kommentar zu Sachfragen, Parallelüberlieferung und Sekundärliteratur versehen worden; Zeittafel, Bibliographie und Index vervollständigen diesen Teilband der ersten deutschen Diodor-Gesamtedition seit Mitte des 19. Jahrhunderts. BGL Band 34 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9218-2 BGL Band 35 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X 978-3-7772-9220-5 BGL Band 45 Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII 978-3-7772-9739-2 BGL Band 55 Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV 978-3-7772-0125-2 (Beschreibung der Ausgabe) BGL Band 34 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9218-2 BGL Band 35 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X 978-3-7772-9220-5 BGL Band 45 Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII 978-3-7772-9739-2 BGL Band 55 Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV 978-3-7772-0125-2 (Beschreibung der Ausgabe) BGL Band 63 Griechische Weltgeschichte. Buch XVIII - XX. BGL Band 63.1 Griechische Weltgeschichte. Buch XVI BGL Band 63.2 Griechische Weltgeschichte. Buch XVII BGL Band 67 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Erster Halbband: Einleitung und Übersetzung BGL Band 68 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Zweiter Halbband: Kommentar |
|
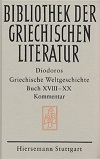 |
Diodoros Griechische Weltgeschichte. Buch XVIII - XX. Teilband B: Kommentar und Anhang Hiersemann, 2005, 211 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0517-5 149,00 EUR |
Bibliothek
der griechischen Literatur Band 63 B Bearbeitung; Otto Veh; Michael Rathmann Der griechisch-sizilianische Geschichtsschreiber Diodor (1. Jahrhundert v. Chr.) ist mit seiner in weiten Teilen erhaltenen "Weltgeschichte" als Quelle für Historiker, Philologen, Ethnologen, Archäologen und für alle an der Antike Interessierten von unbestreitbarem Wert. Die vollständige Neuübersetzung der erhaltenen Partien Diodors im Verlag Anton Hiersemann, Stuttgart, steht mit dem hier anzuzeigenden Teil, welcher die Bücher XVIII-XX umfaßt, nunmehr kurz vor der Vollendung. Er ist deshalb historiographisch besonders wertvoll, weil er die einzige zusammenhängende Darstellung des Frühhellenismus bietet, die aus der Antike überliefert ist. Die drei Bücher XVIII bis XX behandeln die politisch höchst brisanten Ereignisse unmittelbar nach dem Tod Alexanders des Großen 323 bis 302; es geht vor allem um die Kämpfe seiner Generäle um die Vorherrschaft in seinem Reich. Der Geschichtsschreiber berichtet ausführlich von den gewaltigen historischen Umwälzungen im Gebiet zwischen Griechenland und dem fernen Baktrien. Damit beschreibt dieser Abschnitt aus Diodors Gesamtwerk den Beginn des Hellenismus. Interessant sind darüber hinaus die Exkurse zur Geschichte der sizilischen Griechen und der Karthager im vierten Jahrhundert, sowie Diodors Aussagen zu der noch jungen mittelitalischen Macht am historischen Horizont: Rom. Die aus dem Nachlaß von Dr. Otto Veh stammende Übersetzung der Bücher XVIII und XIX wurde von Prof. Dr. Gerhard Wirth mit Buch XX komplettiert. Somit liegt seit der Ausgabe von Julius Friedrich Wurm aus den Jahren 1838/9 nun erstmals wieder ein zuverlässiger deutschsprachiger Text vor. Zu dem Halbband mit der Übersetzung (BGL 63 A) wurde von Dr. Michael Rathmann ein umfangreicher Kommentarteil (BGL 63 B; ISBN 3-7772-0517-6) erstellt, der neben einer Bibliographie auch einen Index enthält. BGL Band 34 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9218-2 BGL Band 35 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X 978-3-7772-9220-5 BGL Band 45 Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII 978-3-7772-9739-2 BGL Band 55 Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV 978-3-7772-0125-2 (Beschreibung der Ausgabe) BGL Band 34 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9218-2 BGL Band 35 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X 978-3-7772-9220-5 BGL Band 45 Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII 978-3-7772-9739-2 BGL Band 55 Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV 978-3-7772-0125-2 (Beschreibung der Ausgabe) BGL Band 63 Griechische Weltgeschichte. Buch XVIII - XX. BGL Band 63.1 Griechische Weltgeschichte. Buch XVI BGL Band 63.2 Griechische Weltgeschichte. Buch XVII BGL Band 67 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Erster Halbband: Einleitung und Übersetzung BGL Band 68 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Zweiter Halbband: Kommentar Bibliothek der griechischen Literatur Band 63 A |
|
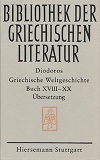 |
Diodoros Griechische Weltgeschichte. Buch XVIII - XX. Teilband A: Einleitung und Übersetzung Hiersemann, 2005, 314 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0516-8 149,00 EUR |
||
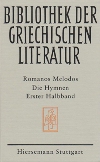 |
Romanos Melodos Die Hymnen Erster Halbband Hiersemann, 2005, 434 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0500-7 198,00 EUR Bibliothek der griechischen Literatur Band 62 zu BGL 64 Zweiter Halbband |
Romanos Melodos, ein Zeitgenosse des
byzantinischen Kaisers Justinian I., galt bei den Byzantinern
und gilt bis heute in der Orthodoxie als der bedeutendste
Dichter und Komponist kirchlicher Hymnen. Von den rund neunzig
Texten, die in den byzantinischen Handschriften den Autornamen
des Romanos tragen, sind wahrscheinlich zwei Drittel tatsächlich
ihm zuzuschreiben. Sie zeichnen sich durch besondere
Bildhaftigkeit und Lebendigkeit der Sprache aus. Diese als
"Kontakia" bezeichneten Hymnen wurden geschaffen, um im Rahmen
von kirchlichen Feiern (Meßliturgien, Nachtwachen) rezitiert zu
werden. Die Dichtungsform entstand wahrscheinlich im 5.
Jahrhundert, als Blütezeit gilt die Schaffenszeit des Romanos,
also die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts. Übersichtliche
Strophengliederung, akzentuierende Metren, stark rhythmischer
Gesang und die Beteiligung der Gläubigen, die in den Refrain am
Ende jeder Strophe einstimmten, machten das Kontakion zu einem
wirksamen Instrument eindringlicher Glaubensverbreitung. Die als echt angesehenen Hymnen des Romanos übersetzt Johannes Koder in die deutsche Sprache. Hierbei erfolgt die Ordnung der Hymnen in Anlehnung an den Festkalender der orthodoxen Kirche. Daher umfaßt die erste Gruppe sechzehn Hymnen der Kirchenfeste mit festem Datum zwischen dem 8. September (Geburt der Gottesgebärerin) und dem 29. August (Enthauptung Johannes des Täufers). Es folgt als zweite Gruppe die der 26 Hymnen der vorösterlichen Vorfasten- und Fastenzeit und als dritte Gruppe die der achtzehn Hymnen für die österliche und nachösterliche Zeit. Die Übersetzung sucht in Stil und Wortwahl die Liturgienähe der Originaltexte zu vermitteln, ohne "dichterisch" zu sein oder den Versuch zu unternehmen, die Originale nachzuempfinden. Die der Übersetzung vorangehende Einleitung stellt nicht nur den Hymnographen und sein Werk vor, sondern führt auch in das historische und literarische Umfeld ein. Die Anmerkungen bieten in knapper Form Erläuterungen zur Textgestaltung, zum Inhalt und zum kirchlichen Festbezug, weiters Hinweise auf Parallelen in anderen Texten, wobei Schwerpunkte bei der Bibel und bei Ephraim dem Syrer gesetzt werden. Dieser erste Teilband enthält die Einleitung und die ersten 32 Hymnen, der zweite wird weitere dreißig sowie den (nicht von Romanos geschaffenen) Akathistos Hymnos enthalten. Die Hymnen des Romanos Melodos, über eineinhalb Jahrtausende hinweg unbestrittener Höhepunkt orthodoxer Poesie, bieten einen unmittelbaren Zugang zur Geisteswelt der christlichen Spätantike und des frühen Mittelalters. Sie tragen heute dazu bei, die vermeintlich fremde byzantinische Kultur, die für das heutige Europa prägend war, besser zu verstehen. Darüber hinaus spiegeln die Hymnen den Wesenskern eines gesamtkirchlichen Glaubensverständnisses wider und eröffnen Lesern und Hörern einen unmittelbaren, kraftvollen und zugleich dichterischen Zugang zu christlichem Denken aus der Zeit vor Schismen und Glaubensspaltungen. |
|
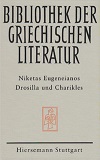 |
Niketas
Eugeneianos Drosilla und Charikles Hiersemann, 2003, 186 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0302-7 134,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 61 Bearbeitung: Karl Plepelits Drosilla und Charikles ist ein spannender Liebesroman mit einer virtuosen Handlungsführung. Zwei junge Leute verlieben sich unsterblich ineinander, aber da das Mädchen bereits einem anderen versprochen ist, entführt sie der Held und flieht mit ihr. Sie erleben aufregende und zum Teil groteske Abenteuer, finden sich aber schließlich wieder zusammen und erleben eine triumphale Hochzeit. Der byzantinische Roman des 12. Jahrhunderts geht auf eine Wiederbelebung des antiken Prosaromans, konkret: der Romane des Achilleus Tatios (Leuklippe und Kleitophon, BGL Band 11) und des Heliodor, zurück. Den Anfang scheint Eustathios Makrembolites mit seinem dem Roman des Achilleus Tatios nachempfundenen Prosaroman Hysmine und Hysminias (BGL Band 29) gemacht zu haben, dem einzigen byzantinischen Prosaroman überhaupt. Ein Prosaroman ist er freilich ausschließlich in formaler Hinsicht; stilistisch gesehen ist seine Sprache das, was man in der Antike als „Poesie in Prosa“ bezeichnete. Makrembolites’ Nachfolger, Theodoros Prodromos, geht daher einen Schritt weiter und schafft konsequenterweise auch formal Poesie, das heißt er schreibt seinen den Aithiopika Heliodors nachempfundenen Roman Rhodanthe und Dosikles (BGL Band 42) zur Gänze in Versen. Und nach dessen Vorbild schreibt nun dessen Zeitgenosse Niketas Eugeneianos seine Erzählung. Die Nachahmung einer Nachahmung also? So ist es in der Tat. Andererseits ist nicht zu bestreiten, daß von wirklicher Nachahmung nur am Anfang und dann wieder am Schluß gesprochen werden kann und dazwischen eine erstaunliche schöpferische Phantasie und eine beachtliche erzählerische Begabung kenntlich werden. Doch Eugeneianos geht noch weiter als Prodromos. Als Inbegriff der Poesie gilt ja eher die Lyrik. Zumindest gleichberechtigt neben dem epischen Element, der Handlung, steht bei ihm die Lyrik und hier wieder vor allem die Liebeslyrik. Mehr noch: Die in Drosilla und Charikles enthaltene Liebeslyrik stellt fürwahr die Gesamtheit der byzantinischen Liebeslyrik bis zu diesem Zeitpunkt dar. Mit dieser ersten deutschen Übersetzung wird dem heutigen Leser ein lyrischer Liebes- und Abenteuerroman vorgelegt, der zwar in heidnischer Antike spielt, aber im christlichen Mittelalter verfaßt worden ist. Die vorliegende Übersetzung versucht, Gedankengang und sprachlichen Ausdruck des Originals möglichst getreu wiederzugeben Sie versucht hingegen nicht¸ das Versmaß des Originals nachzubilden¸ sondern bedient sich freier Rhythmen, die einfacher Prosa nahestehen. Über biographische und literaturhistorische Fragen, Aspekte der sprachlichen und künstlerischen Gestaltung und anderer Einzelfragen handelt eine ausführliche Einleitung. Der Erleichterung des Textverständnisses und der Erhellung der Arbeitsweise des Dichters dienen ein wissenschaftlicher Kommentar. Ein detailliertes Register beschließt den Band. |
|
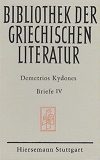 |
Demetrios
Kydones Briefe. Vierter Teil Hiersemann, 2003, 326 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0315-7 176,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 60 Bearbeitung: Franz Tinnefeld Mit Gesamtkonkordanz zu den Bänden I – IV BGL 12, Demetrios Kydones, Briefe. Erster Teil, 1. Halbband , 978-3-7772-8120-9 BGL 16, Demetrios Kydones, Briefe. Erster Teil, 2. Halbband 978-3-7772-8220-6 BGL 33, Demetrios Kydones, Briefe. Zweiter Teil, 978-3-7772-9123-9 BGL 50, Demetrios Kydones, Briefe Dritter Teil 978-3-7772-9911-2 (mit Beschreibung) BGL 60, Demetrios Kydones, Briefe. Vierter Teil 978-3-7772-0315-7 |
|
 |
Nikephoros
Gregoras Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Fünfter Teil: Kapitel XXIV,3 - XXIX Hiersemann, 2003, 469 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0300-3 198,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 59 Übersetzt und erläutert von Jan-Louis van Dieten BGL 4 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Erster Teil: Kapitel I - VII 978-3-7772-7309-9 BGL 8 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 1. Halbband: Kapitel VIII - IX ,6 978-3-7772-7904-6 BGL 9 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 2. Halbband: Kapitel IX,7 - XI 978-3-7772-7919-0 BGL 24 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Dritter Teil: Kapitel XII - XVII 978-3-7772-8805-5 BGL 39 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Vierter Teil: Kapitel XVIII - XXIV,2 978-3-7772-9402-5 BGL 59 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Fünfter Teil: Kapitel XXIV,3 - XXIX 978-3-7772-0300-3 BGL 66 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Sechster Teil: Kapitel XXX - XXXVII 978-3-7772-0707-0 |
|
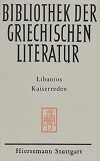 |
Libanios Kaiserreden Hiersemann, 2002, 296 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0233-4 156,00 EUR siehe auch Band 81: Eustathios von Thessalonike, Kaiserreden |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 58 Bearbeitung: Georgios Fatouros; Tilman Krischer; Werner Portmann Libanios war einer der angesehensten griechischen Redner seiner Zeit. Geboren im Jahre 314 in Antiochien, verbrachte er viele Jahre als Lehrer in verschiedenen Städten im Ostteil des Römischen Reiches (Athen, Konstantinopel, Nikomedien), bevor er 354 als Rhetoriklehrer wieder in seine Heimatstadt zurückkehrte, wo er 393 starb. Er war Heide, zählte jedoch auch bedeutende christliche Redner wie Johannes Chrysostomos zu seinen Schülern. In seiner reichen literarischen Hinterlassenschaft finden sich zahlreiche Reden, die entweder unmittelbar an Kaiser gerichtet sind oder, wie im Falle des Kaisers Julian, deren Andenken bewahren wollen. Der vorliegende Band vereinigt erstmals in deutscher Übersetzung die früheste erhaltene Kaiserrede (an die beiden Söhne Konstantins) mit jenen Reden, die Libanios seinem verstorbenen Freund, dem 'Apostaten' Julian, gewidmet hat. Für die gemeinsam regierenden Söhne Konstantins des Großen, Constantius II. und Constans, hat Libanios eine Lobrede (oratio 59) verfasst, die für die Rekonstruktion der zeitgeschichtlichen Vorgänge von grundsätzlicher Bedeutung ist. Ereignisse, die sonst nur durch kurze Einträge in Chroniken bekannt sind, werden durch die Darstellung des Libanios in ihrer Bedeutung und in ihrem historischen Kontext fassbar. Die Rede berücksichtigt nicht nur außenpolitische Vorgänge, sondern widmet sich in einer für die Panegyrik nur selten zu beobachtenden Ausführlichkeit auch den innenpolitischen Maßnahmen der beiden Kaiser. Das Schwergewicht legt Libanios jedoch auf die Auseinandersetzung des Constantius II. mit den persischen Sassaniden. Er bietet dabei eine auf Augenzeugenberichten beruhende Darstellung der sogenannten "Nachtschlacht" bei Singara. Die Rede ist zudem ein wichtiges Zeugnis für die problematischen Beziehungen zwischen den beiden kaiserlichen Brüdern. Kaiser Julian (332-363) war eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der Spätantike; sein Lebenslauf, den Libanios als Freund und Verehrer nachzeichnet (orationes 17, 18, 24), spiegelt die politischen, sozialen und religiösen Verhältnisse der Zeit wider. Nach dem Tod Konstantins verlor er im Alter von fünf Jahren durch Zwistigkeiten in der kaiserlichen Familie seinen Vater, wurde aber gleichwohl zum Mitkaiser ernannt und als Heerführer nach Gallien und an den Rhein geschickt, wo er sich, nicht zuletzt in Köln, während der durch die Kälteperiode ausgelösten Völkerwanderung schwerwiegenden Problemen gegenübergestellt sah. Später haben ihn in Paris seine Truppen zum Augustus - Hauptkaiser - ausgerufen, was neue Gefahren mit sich brachte. Doch sein Rivale Konstantios verstarb, ehe er mit seinen Truppen die Hauptstadt erreichte. Hier angelangt, hat Julian sich als Feind des zur Staatsreligion erhobenen Christentums betätigt. Doch das sollte nicht lange dauern. Wegen wachsender Probleme an der Ostgrenze des Reiches musste er zu einem Feldzug gegen die Perser aufbrechen und fiel in einer der ersten Schlachten. Nach Ansicht des Libanios freilich handelt es sich um einen Mord aus den eigenen Reihen. Die drei Reden liefern ein lebendiges Bild dieser Ereignisse. Die Übersetzungen der Rede 59 bzw. der Reden 17, 18 und 24 werden durch philologische und historiographische Bemerkungen wissenschaftlich aufgearbeitet und mit Hilfe von Namenregistern inhaltlich erschlossen. Eine diesen Einzelteilen des neuen Bandes in der "Bibliothek der griechischen Literatur" vorangestellte allgemeine Einleitung führt in Leben und Werk des Libanios ein. |
|
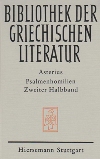 |
Asterius Psalmenhomilien Zweiter Halbband Hiersemann, 2002, 325 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0202-0 98,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 57 Bearbeitung: Wolfram Kinzig, Wilhelm Gessel (Hrsg.) |
|
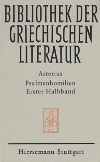 |
Asterius Psalmenhomilien Erster Halbband Hiersemann, 2002, 300 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0201-3 98,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 56 Bearbeitung: Wolfram Kinzig, Wilhelm Gessel (Hrsg.) Die Psalmenhomilien sind zwischen etwa 395 und 410 entstanden. |
|
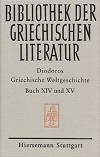 |
Diodoros Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV Hiersemann, 2001, 351 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0125-2 98,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 55 Bearbeitung: Thomas Frigo; Otto Veh; Thomas Nothers Die von Diodor aus Agyrion (Sizilien) im ersten vorchristlichen Jahrhundert in klarer Sprache und kritiklos niedergeschriebene "Weltgeschichte" ist in weiten Teilen erhalten und wird seit jeher von Historikern, Philologen, Archäologen und allen an der Antike Interessierten als überaus wertvolle Quelle geschätzt. Der Horizont jener "Bibliotheke" (wie er seine Weltgeschichte in 40 Büchern nannte) mit universalem Anspruch erstreckt sich von den Anfangszeiten der Götter und Menschen bis in Diodors Gegenwart, die Jahrzehnte der Eroberungen Caesars. Bislang hat der Verlag Anton Hiersemann in seiner Reihe "Bibliothek der griechischen Literatur" mit Bd. 34, 35 und 45 drei Teilbände von Diodors Werk vorgelegt, welche die Mythologie, Ethnographie und Geographie der Oikumene sowie die griechische Historie vom Fall Troias bis zum Ausgang des Peloponnesischen Krieges (404) umfassen. An diesen Endpunkt der klassischen Epoche Griechenlands knüpft der nun vorliegende Band 55 der Reihe mit der Darstellung der spannungsgeladenen viereinhalb Jahrzehnte hellenisch-mediterraner Geschichte bis zum Regierungsantritt König Philipps II. von Makedonien (359) bruchlos an. Angesichts ihrer Turbulenzen und Zerrissenheit muß die betrachtete Periode geradezu als Gegenbild einer ereignisarm 'windstillen' Zwischenzeit gelten. Das im Widerspiel von rigorosem spartanischem Machtstreben, neu erstarkendem athenischem Imperialismus und fortwährenden persischen Interventionen gebildete Spannungsfeld sollte sich als derart instabil erweisen, daß kurzfristig - nach der epochalen Schlacht bei Leuktra (371) - auch eine bislang zweitrangige Polis wie das boiotische Theben hegemonial auftrumpfen konnte. Eine womöglich noch höhere Bedeutung kommt Buch 14 und 15 der "Bibliotheke" als unverzichtbare Ergänzung der "Hellenika" des Xenophon, insbesondere auch als Korrektiv zu deren dezidiert pro-spartanischer Tendenz als Quelle für die Geschichte des Westgriechentums zu. Einzig durch Diodor besitzen wir eine umfängliche und zusammenhängende Schilderung der Tyrannis des Dionysios I. von Syrakus, seiner Herrschaftspraxis, Expansionspolitik und gewaltigen Kriegszüge gegen die Karthager. Die aus dem Nachlaß des Würzburger Philologen Dr. Otto Veh stammende ÜBERSETZUNG ist von Thomas Frigo M.A. (Bonn) bearbeitet und mit einer Einführung sowie einem detaillierten KOMMENTAR zu Sachfragen, Parallelüberlieferung und Sekundärliteratur versehen worden; ZEITTAFEL, BIBLIOGRAPHIE und INDEX vervollständigen diesen vierten Teilband der ersten deutschen Diodor-Gesamtedition seit etwa 1840. BGL Band 34 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9218-2 BGL Band 35 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X 978-3-7772-9220-5 BGL Band 45 Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII 978-3-7772-9739-2 BGL Band 55 Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV 978-3-7772-0125-2 (Beschreibung der Ausgabe) BGL Band 63 Griechische Weltgeschichte. Buch XVIII - XX. BGL Band 63.1 Griechische Weltgeschichte. Buch XVI BGL Band 63.2 Griechische Weltgeschichte. Buch XVII BGL Band 67 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Erster Halbband: Einleitung und Übersetzung BGL Band 68 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Zweiter Halbband: Kommentar |
|
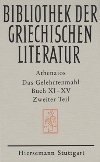 |
Athenaios Das Gelehrtenmahl. Buch XI - XV. Zweiter Teil: Buch XIV und XV Bibliothek der griechischen Literatur Band 54 Hiersemann, 2001, 398 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0118-4 98,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 47
Das Gelehrtenmahl.
Buch I - VI. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9815-3 Bibliothek der griechischen Literatur Band 48 Das Gelehrtenmahl. Buch I - VI. Zweiter Teil: Buch IV - VI 978-3-7772-9816-0 Bibliothek der griechischen Literatur Band 51 Das Gelehrtenmahl. Buch VII - X 978-3-7772-9924-2 Bibliothek der griechischen Literatur Band 53 Das Gelehrtenmahl. Buch XI - XV. Erster Teil: Buch XI - XIII 978-3-7772-0018-7 Bibliothek der griechischen Literatur Band 54 Das Gelehrtenmahl. Buch XI - XV. Zweiter Teil: Buch XIV und XV 978-3-7772-0118-4 Bearbeitung; Claus Friedrich; Thomas Nothers Im Rom des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts lädt der pontifex minor und auch der mit anderen einflussreichen Ämtern betraute Römer Publius Livius Laurensis eine fiktive Gesellschaft von etwa dreißig Gelehrten mit zum Teil berühmten Namen zu einem mehrtätigen Festgelage ein: Philosophen, Philologen, Ärzte, Musiker, Dichter. Athenaios, selbst einer der Teilnehmer an diesem "Gelehrtenmahl", berichtet seinem Freund Timokrates über die Gespräche, die bei dieser Gelegenheit geführt werden. Sie befassen sich mit allem, was zu einem Gastmahl gehört: Vorspeisen, Hauptgerichte, Nachspeisen, Getränke (und hier vornehmlich der Wein, dessen Genuss ausführlich gewürdigt wird); die Gelehrten erörtern die Zusammensetzung der Gerichte und die Ausstattung der Bankette bei Griechen, Makedonen und Persern. Dabei entstehen ganze Kataloge von Brotarten, Fischspezialitäten, Gewürzen, Obst- und Gemüsesorten. Es finden sich außerdem Betrachtungen über das Aufkommen und die Folgen von Verschwendung und Prachtentfaltung (Luxus), über das Sklaven- und Parasitenwesen, die Rolle der Flötenspielerinnen und Hetären, die Knabenliebe, Opfergepflogehnheiten, Anwendung von Duftessenzen und den Gebrauch der verschiedenen Gefäßarten. Aber auch über die Philosophen der Griechen unterhalten sich die Gelehrten beim Gastmahl und stellen fest, dass es unter ihnen nicht nur Befürworter des Genusses, sondern ebenso Apologeten eines Lebens in Bedürfnislosigkeit gibt. Darüber hinaus erhält der Leser einen Einblick in die prunkvolle Ausstattung von Palästen (Speisesälen), Festumzügen und Schiffen zu Ehren der Götter hochrangiger Herrscher. Zu all diesen Äußerungen und zahlreichen Anekdoten werden Passagen aus der griechischen Literatur von 800 v.Chr. bis 200 n.Chr. (Homer bis Oppian) zitiert. Diese Gesprächssammlung interessiert in erster Linie den Literaturwissenschaftler und den Historiker, zumal sie eine Fülle von Werken (besonders Komödien) und Schriftstellern zur Kenntnis bringt, die sonst nirgends überliefert sind und somit verloren wären. Zum anderen aber erschließt das Werk dem kulturell aufgeschlossenen Leser einen umfassenden Eindruck von der Vielfalt des Alltagslebens der gehobenen Schichten im antiken griechisch-makedonischen Sprachbereich und darf mithin als Nachschlagewerk der Kultur dieser Epoche betrachtet werden. Um der Komplexität des Gesamtwerks Rechnung zu tragen, sind dem letzten Teilband über das Register der Eigennamen hinaus zwei Orientierungshilfen beigegeben: Das REGISTER DER BEHANDELTEN AUTOREN UND WERKE enthält sämtliche Stellenangaben zu den von Athenaios aus anderen Werken zitierten oder referierten Ausschnitten; auf durchschnittlich je vier Druckseiten schließlich sind INDEX-ARTIG DIE WESENTLICHEN GESPRÄCHSINHALTE DER 15 BÜCHER ZUSAMMENGEFASST. Dies ermöglicht einen raschen Zugriff auf besonders interessierende Sachgebiete. |
|
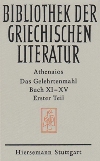 |
Athenaios Das Gelehrtenmahl. Buch XI - XV. Erster Teil: Buch XI - XIII Bibliothek der griechischen Literatur Band 53 Hiersemann, 2000, 366 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0018-7 90,00 EUR |
||
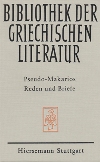 |
Pseudo-Makarios Reden und Briefe Hiersemann, 2000, 549 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-0005-7 122,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 52 Bearbeitung: Klaus Fitschen Unter dem Namen des ägyptischen Mönchsvaters Makarios sind mehrere große Textsammlungen überliefert. Die hier übersetzten Reden und Briefe wurden erst spät entdeckt und 1973 durch Heinz Berthold in den Griechischen Christlichen Schriftstellern ediert. Die Sammlung dokumentiert in noch umfänglicherer Weise als die Geistlichen Homilien den Beitrag dieses Autors zur spätantiken und byzantinischen Spiritualität. In den letzten Jahrzehnten ist die wahre Identität des "Makarios" viel diskutiert worden, denn zweifelsohne ist der Autor nicht der berühmte Ägypter Makarios, sondern ein Anonymus, der in das ausgehende 4. Jahrhundert und geographisch nach Syrien gehört. Die Frage nach der Identität des Autors hat die Forschung auch deshalb beschäftigt, weil sein Werk eine inhaltliche Beziehung zu den Ansichten der Messalianer hat, einer ketzerischen Gruppierung, die im 4. und 5. Jahrhundert in Kleinasien und Syrien viel Aufsehen erregte. So hat sich einem Zweig der Forschung der Name Makarios / Symeon eingebürgert, weil man einen der Gründer des Messalianismus mit Namen Symeon für den Autor hielt. Die Frage der Autorschaft und der Beziehung zum Messalianismus sowie die Probleme der Textüberlieferung werden in der Einleitung zur Übersetzung zusammenfassend dargestellt. Die hier übersetzte Sammlung erbaulicher und belehrender Sentenzen und Abhandlungen des späten 4. Jahrhunderts ist erst im 13. Jahrhundert aus älteren Teilsammlungen komponiert worden. Insofern dokumentiert die Sammlung nicht nur die Gedankenwelt eines spätantiken Asketenvaters, in der visionäre nüchterne Menschenkenntnis, Hochstimmung, ein reicher Bilderschatz aus dem antiken Alltagsleben und erbauliche Betrachtungen ihren Platz haben, sondern auch eine lange Phase christlicher Literatur- und Frömmigkeitsgeschichte, in der das antike Erbe über Jahrhunderte aufgenommen und neu gelesen und meditiert wurde. Gerade der Reichtum an Bildern und Vergleichen, aber auch die Herkunft vieler Texte aus dem mündlichen Lehrvortrag erleichtern einen unmittelbaren Zugang zu dieser Art christlich-spätantiker Literatur. Der Übersetzung ist ein Quellen- und Literaturverzeichnis beigegeben, ebenso ein Verzeichnis der Werke des Pseudo-Makarios. Der Text wird durch Register der Bibelstellen, der biblischen Namen, antiker Personen, Autoren und Schriften sowie von Sachen und Begriffen zusätzlich erschlossen. |
|
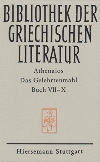 |
Athenaios Das Gelehrtenmahl. Buch VII - X Hiersemann, 1999, 452 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9924-2 98,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 51 Bearbeitung; Claus Friedrich; Thomas Nothers Mit dem dritten Teilband wird die deutsche Übertragung des 15 Bücher umfassenden Werkes "Gelehrte beim Gastmahl" ("Deipnosophistai") des Athenaios aus Naukratis fortgesetzt. Er enthält die Bücher VII-X. Nach einem Überblick über traditionelle Feste, die mit Banketten verbunden waren, behandelt der Autor in gleichsam lexikalischer Abfolge knapp einhundert Fischarten, die in der Antike bei der Zubereitung von Festmahlzeiten Verwendung fanden. Das Thema wird weiter erörtert, indem die Gesprächspartner die Bedeutung des üppigen Genusses für ein angenehmes Leben würdigen. Es schließen sich Anekdoten über notorische Genießer an, wie sie durch die Literatur bekannt geworden sind, sowie Betrachtungen über Schmackhaftigkeit und Bekömmlichkeit von Fischgerichten im Allgemeinen. In ähnlicher Weise werden dann delikate Speisen und die dazu verwendeten Gewürze sowie Gemüsearten behandelt. Ferner beschreiben anwesende Köche die Bedeutung ihres Gewerbes für das gesellschaftliche Leben, legen ihre Fertigkeiten dar und zitieren entsprechende Bemerkungen von Kollegen, wie sie in der Literatur überliefert werden. Herakles und andere mythische Gestalten werden als besonders maßlos beim Essen hingestellt. Im Gegensatz dazu galten die meisten Philosophen als maßvoll. Die Betrachtungen führen schließlich zu einer ausführlichen Würdigung des Weingenusses und seiner Folgen. Bibliothek der griechischen Literatur Band 47 Das Gelehrtenmahl. Buch I - VI. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9815-3 Bibliothek der griechischen Literatur Band 48 Das Gelehrtenmahl. Buch I - VI. Zweiter Teil: Buch IV - VI 978-3-7772-9816-0 Bibliothek der griechischen Literatur Band 51 Das Gelehrtenmahl. Buch VII - X 978-3-7772-9924-2 Bibliothek der griechischen Literatur Band 53 Das Gelehrtenmahl. Buch XI - XV. Erster Teil: Buch XI - XIII 978-3-7772-0018-7 Bibliothek der griechischen Literatur Band 54 Das Gelehrtenmahl. Buch XI - XV. Zweiter Teil: Buch XIV und XV 978-3-7772-0118-4 |
|
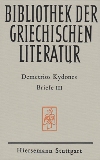 |
Demetrios
Kydones Briefe. Dritter Teil Hiersemann, 1999, 350 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9911-2 98,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 50 Bearbeitung: Franz Tinnefeld Der byzantinische Literat Demetrios Kydones (1323/24-1397/98), Staatsmann unter den Kaisern Johannes VI. Kantakuzenos und Johannes V.Palaiologos, lebte zu einer Zeit, als Byzanz, der fortbestehende östliche Teil des Römischen Reiches, zum politisch unbedeutenden Kleinstaat geworden war und von türkischen Stämmen Kleinasiens, vor allem den Osmanen, in seiner Existenz bedroht wurde. Doch gelangte die byzantinische Kultur seit den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts noch einmal zu einer späten Blüte; die Gebildeten der Epoche fanden in der antiken Literatur und Philosophie Vorbilder für ihre eigenen Schriften; die Theologie orientierte sich an neuen Ansätzen. In dieser Tradition steht das literarische Werk des Kydones, das vor allem theologische und philosophische Arbeiten umfaßt. Kydones hinterließ auch 449 Briefe, wichtige Quellen für seine Biographie wie auch für die Geschichte seiner Zeit, die in der byzantinischen Histiographie nur lückenhaft behandelt wird. Der nun vorgelegte Dritte Teil einer insgesamt vier Teile umfassenden kommentierten deutschen Übersetzung enthält auf der Basis der kritischen Edition von Raymond-Joseph Loenertz (1956/60) weitere 112 Briefe. Die meisten von ihnen sind hier erstmals in eine moderne Sprache übertragen. Wie in den vorausgehenden Teilen werden die Briefe, abweichend von der Edition, in einer annähernd chronologischen Ordnung vorgelegt und wie schon im Zweiten Teil bleiben die Erläuterungen fast gänzlich auf die historisch-sachliche Information beschränkt, während auf die literarischen Aspekte des Textes nur die entsprechenden Kategorien des Index Bezug nehmen. Die Briefe des Bandes entstammen einer Zeit, als die türkischen Eroberer im europäischen Teil des byzantinischen Reichsgebietes nun auch Thessalonike, nach Konstantinopel das zweite bedeutende Zentrum des verbliebenen Restreiches und Heimatstadt des Kydones, zu erobern drohten. Damals, gegen Ende des Jahres 1382, begab sich der Sohn des regierenden Kaisers Johannes V., der Mitkaiser Manuel Palaiologos, in die gefährdete Stadt, um ihre Einnahme zu verhindern. Ein Großteil der hier übersetzten Briefe ist an ihn und an andere Personen in Thessalonike gerichtet. Sie geben Gelegenheit, aus der Sicht des in Konstantinopel weilenden Kydones den dramatischen Kampf um die Stadt mitzuerleben, der im Frühjahr 1387 mit der Eroberung durch die Belagerer endete. BGL 12, Demetrios Kydones, Briefe. Erster Teil, 1. Halbband , 978-3-7772-8120-9 BGL 16, Demetrios Kydones, Briefe. Erster Teil, 2. Halbband 978-3-7772-8220-6 BGL 33, Demetrios Kydones, Briefe. Zweiter Teil, 978-3-7772-9123-9 BGL 50, Demetrios Kydones, Briefe Dritter Teil 978-3-7772-9911-2 (mit Beschreibung) BGL 60, Demetrios Kydones, Briefe. Vierter Teil 978-3-7772-0315-7 |
|
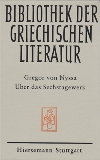 |
Gregor von
Nyssa Über das Sechstagewerk Verteidigungsschrift an seinen Bruder Petrus Hiersemann Verlag, 1999, 276 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9900-6 98,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 49 Bearbeitung: Franz X Risch; Wilhelm Gessel (Hrsg.) Gregor von Nyssa (+ 394) verstand sich zeit seines Lebens als Schüler und geistiger Erbe seines älteren Bruders Basilius von Cäsarea. Dessen literaturgeschichtlich folgenreichen Homilien zum Sechstagewerk fügte Gregor die verhältnismäßig häufig rezipierte Abhandlung de conditione hominis an und schrieb, angeregt durch seinen jüngeren Bruder Petrus, eine weniger bekannte apologia in hexaemeron. Darin verteidigt er das Hexameron des Basilius gegen Kritiker, wagt aber auch den Versuch, den Schöpfungsbericht nach dem Prinzip der Folgerichtigkeit (Akoluthia) selbständig und betont wissenschaftlich auszulegen. Erst in neuerer Zeit erkannte man die Originalität von Gregors Hexameron. In diesem "genialen Werk" (Hans von Balthasar) gelingt es Gregor, die einzelnen Verse des biblischen Berichtes mit erstaunlicher systematischer Geschlossenheit zu deuten. Dabei werden nicht nur die Einwände jener Kritiker an Basilius aufgelöst und der Nachweis der Wissenschaftlichkeit des Schöpfungsberichtes erbracht. Gregor bietet auch eine vollständige Kosmogenie nach griechischem Vorbild, in die zudem, reichlich ausgelegt mit naturkundlichem Material, eine Reihe bemerkenswerter philosophischer Ideen eingeflochten ist. So etwa die Überzeugung von der Einheit von göttlichem Logos und Natur und der damit zusammenhängenden Substanzlosigkeit der Materie, oder die Überzeugung von der logischen und quantitativen Identität der Elemente und damit der physikalischen Unvernichtbarkeit der Welt. Der inhaltlichen Vielfalt entspricht ein mehrfacher Skopos, demzufolge das Werk in einem als Apologie, als philosophisch-theologischer Traktat und als biblischer Kommentar angesehen werden muß. Gregor selbst, der im Schöpfungsbericht eine "Isagoge zur Gotteserkenntnis" erblickte, war offenbar seinerseits bemüht, durch Beachtung der Akoluthia zur Gotteserkenntnis zu führen. Den einleitenden Ausführungen und der um Wörtlichkeit bemühten Übersetzung des griechischen kritischen Textes von G. H. Forbes (1855) sind kommentierende Anmerkungen angefügt. In ihnen werden philologische Fragen behandelt, wird den auslegungsgeschichtlichen ebenso wie den naturphilosophischen Voraussetzungen von Gregors Denken nachgespürt, Gregors exegetische Theorie berücksichtigt und auf seine großen theologischen und philosophischen Überzeugungen eingegangen, soweit sie für das Hexameron bedeutend sind. In einem Anhang ist das Verzeichnis der Werke Gregors, ihrer Ausgaben und deutschen Übersetzungen aktualisiert und ein vierteiliges Register (Bibelstellen, Antike Namen, Moderne Namen, Sachen und Begriffe) beigegeben. Inhaltsverzeichnis |
|
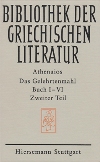 |
Athenaios Das Gelehrtenmahl. Buch I - VI. Zweiter Teil: Buch IV - VI Hiersemann, 1998, 371 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9816-0 98,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 48 Bearbeitung; Claus Friedrich; Thomas Nothers Bibliothek der griechischen Literatur Band 47 Das Gelehrtenmahl. Buch I - VI. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9815-3 Bibliothek der griechischen Literatur Band 48 Das Gelehrtenmahl. Buch I - VI. Zweiter Teil: Buch IV - VI 978-3-7772-9816-0 Bibliothek der griechischen Literatur Band 51 Das Gelehrtenmahl. Buch VII - X 978-3-7772-9924-2 Bibliothek der griechischen Literatur Band 53 Das Gelehrtenmahl. Buch XI - XV. Erster Teil: Buch XI - XIII 978-3-7772-0018-7 Bibliothek der griechischen Literatur Band 54 Das Gelehrtenmahl. Buch XI - XV. Zweiter Teil: Buch XIV und XV 978-3-7772-0118-4 |
|
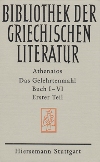 |
Athenaios Das Gelehrtenmahl. Buch I - VI. Erster Teil: Buch I - III Hiersemann, 1998, 296 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9815-3 90,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 47 Bearbeitung; Claus Friedrich; Thomas Nothers Bibliothek der griechischen Literatur Band 47 Das Gelehrtenmahl. Buch I - VI. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9815-3 Bibliothek der griechischen Literatur Band 48 Das Gelehrtenmahl. Buch I - VI. Zweiter Teil: Buch IV - VI 978-3-7772-9816-0 Bibliothek der griechischen Literatur Band 51 Das Gelehrtenmahl. Buch VII - X 978-3-7772-9924-2 Bibliothek der griechischen Literatur Band 53 Das Gelehrtenmahl. Buch XI - XV. Erster Teil: Buch XI - XIII 978-3-7772-0018-7 Bibliothek der griechischen Literatur Band 54 Das Gelehrtenmahl. Buch XI - XV. Zweiter Teil: Buch XIV und XV 978-3-7772-0118-4 |
|
 |
Themistio Staatsreden Hiersemann, 1998, 340 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9809-2 128,00 EUR Bibliothek der griechischen Literatur Band 46 |
Bearbeitung: Hartmut Leppin; Werner Portmann Erstmals ins Deutsche übersetzt und mit einer Einführung und Erläuterungen versehen von Hartmut Leppin und Werner Portmann. Der griechische Rhetor und Philosoph Themistios, geboren ca. 317, gestorben zwischen 385 und 390. stand bei den Kaisern von Constantius II. bis Theodosius I. in hohem Ansehen. Bei zahlreichen öffentlichen Anlässen wie etwa Consulats- oder Siegesfeiern hielt er panegyrische Festreden. Diese in dem vorliegenden Band der Bibliothek der griechischen Literatur als "Staatsreden" bezeichneten Texte sind für die Kenntnis der politischen Geschichte des 4. Jahrhunderts von erstrangiger Bedeutung, da sie eine Reihe von zeitgeschichtlichen Hinweisen bieten, die sich in keiner anderen Quelle finden. Vor allem aber ermöglichen sie es, die offizielle Propaganda an historisch fixierbaren Ereignissen festzumachen. Andererseits vermittelt Themistios in sehr eigenständiger Weise den Lobpreis mit seiner an heidnischen Vorstellungen orientierten staatsphilosophischen Position, die mit dem Konzept der "Philantropia", das heißt der Liebe zum Menschen, die kaiserliche Autokratie begrenzen will. Bedeutsam sind die "Staatsreden" für mehrere Wissenschaftsdisziplinen. Den Altphilologen und Byzantinisten liefern sie ein zentrales Zeugnis der spätantiken heidnischen Literatur, und Religionswissenschaft und Theologie können an ihnen verfolgen, wie sich Heiden mit dem zur Staatsreligion gewordenen Christentum arrangierten. Den Archäologen schließlich werden wichtige Hinweise auf die künstlerischen Ausstattungen Konstantinopels an die Hand gegeben. Auch für die Renaissance- und Barockforschung sind die Reden von Wichtigkeit, denn der Umstand, daß im 16. und 17. Jahrhundert acht Editionen erschienen sind, zeigt, welch hohes Ansehen Themistios damals genoß. Die vorliegende Übersetzung macht die "Staatsreden" zum ersten Mal vollständig in deutscher Sprache zugänglich. Die Einleitung gibt dem Benutzer einen Überblick über das Leben und die philosophischen Konzepte des Themistios. Den Reden ist eine Rekonstruktion des jeweiligen geschichtlichen Anlasses vorangestellt. Die Anmerkungen sollen vor allem die zeitgeschichtlichen Anspielungen entschlüsseln; ergänzt wird der Kommentar durch chronologische Übersichten und einen Namenindex. |
|
| Vorwort Hinweise zu Übersetzung und Erläuterungen. Einleitung. I. Der Heide am christlichen Hof. II. Zum Problem der Panegyrik. III. Die Staatsreden. IV. Leitmotive. 1. Rede: Einleitung. Über die Philanthropia oder Constantius. 2. Rede: Einleitung. An den Kaiser Constantius, daß der Herrscher am ehesten ein Philosoph sei, oder Dankrede. 3. Rede: Einleitung. Gesandtschaftsrede für Konstantinopel. 4. Rede: Einleitung. An den Kaiser Constantius. 5. Rede: Einleitung. Rede zum Consulatsantritt Kaiser Jovians. 6. Rede: Einleitung. Die Geschwisterliebenden oder Über die Philanthropia. 7. Rede: Einleitung. Über die unter Valens ins Unglück Geratenen. 8. Rede: Einleitung. Rede zum fünfjährigen Regierungsjubiläum. 9. Rede: Einleitung. Mahnrede an den jüngeren Valentinian. |
10. Rede: Einleitung. Über den Frieden, an Valens. 11. Rede: Einleitung. Rede zum zehnjährigen Regierungsjubiläum oder Über die Reden, die sich gegenüber dem Kaiser ziemen. (12. An Valens über die Religionen, s. Vorwort, Abschnitt I) 13. Rede: Einleitung. Rede über die Liebe oder Über die königliche Schönheit 14. Rede: Einleitung. Gesandtschaftsrede an den Kaiser Theodosius. 15. Rede: Einleitung. An Theodosius: Welche ist die königlichste der Tugenden?. 16. Rede: Einleitung. Dankrede an den Kaiser für den Frieden und für das Consulat des Feldherrn Saturninus. 17. Rede: Einleitung. Über die Ernennung zum Stadtpräfekten. 18. Rede: Einleitung. Über die Bereitschaft des Kaisers zuzuhören. 19. Rede: Einleitung. Über die Philanthropia des Kaisers Theodosius Redentabelle Zeittafel Literaturverzeichnis Index nominum |
||
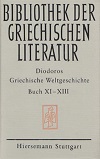 |
Diodoros Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII Hiersemann, 1997, 388 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9739-2 90,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 45 Bearbeitung: Otto Veh; Wolfgang Will; Wolfgang Will BGL Band 34 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9218-2 BGL Band 35 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X 978-3-7772-9220-5 BGL Band 45 Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII 978-3-7772-9739-2 BGL Band 55 Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV 978-3-7772-0125-2 (Beschreibung der Ausgabe) BGL Band 63 Griechische Weltgeschichte. Buch XVIII - XX. BGL Band 63.1 Griechische Weltgeschichte. Buch XVI BGL Band 63.2 Griechische Weltgeschichte. Buch XVII BGL Band 67 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Erster Halbband: Einleitung und Übersetzung BGL Band 68 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Zweiter Halbband: Kommentar |
|
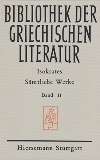 |
Isokrates Sämtliche Werke Band II: Reden IX - XXI. Briefe. Fragmente Hiersemann, 1997, 322 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9711-8 128,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 44 Bearbeitung: Kai Brodersen; Christine Ley-Hutton Aus einer Rezension von Uwe Walter: Nach mehr als 150 Jahren liegen die Schriften des Isokrates mit diesem Band nunmehr wieder in einer vollständigen deutschen Übersetzung vor. Der 1993 erschienene erste Band bot neben der Übersetzung der Reden I-VIII auch eine knappe Einleitung und neben Literaturhinweisen zu den einzelnen Texten auch eine allgemeine Bibliographie. Ihre Fortschreibung im vorliegenden Band zeugt in letzter Zeit gesteigerten wissenschaftlichen Interesse am 'ersten politischen Publizisten der Weltgeschichte'. Der Band enthält u.a. die autobiographisch ergiebige Antidosis-Rede, die im engeren werbenden Schriften des Rhetoriklehrers Isokrates ('Helena', 'Busiris', 'Gegen die Sophisten'), den kurz vor seinem Tod noch vollendeten 'Panathenaikos' und die sechs erhaltenen Prozessreden, die Isokrates etwa vor 390 v.Chr. als Logograph verfasst hatte. Von diesen ist besonders 'Über das Pferdegespann' interessant, weil sie anlässlich einer Klage gegen den Sohn des Alkibiades einen interessanten Einblick in die 'Vergangenheitsbewältigung' der restaurierten athenischen Demokratie bietet. Gegenüber dem ersten Band sind die erläuternden Bemerkungen etwas ausführlicher ausgefallen (269-310); Literaturhinweise und ein (knappes) Register runden den schön gedruckten Band ab. Die Übersetzung ist gut lesbar und dabei doch sehr genau. Isokrates ist ja kein 'schwerer' Autor, aber es kommt bei der Übertragung darauf an, die langen und dabei doch durchsichtigen Perioden nicht zu deutschen Schachtelsätzen werden zu lassen, und zugleich den etwas salbungsvollsämigen Stil des wohlmeinenden athenischen Intellektuellen zu treffen. Die Übersetzung wird dort, wo es nötig ist, sogar ausführlicher als das Original. BGL Band 36 Sämtliche Werke Band I: Reden I - VIII 978-3-7772-9307-3 BGL Band 44 Sämtliche Werke Band II: Reden IX - XXI. Briefe. Fragmente 978-3-7772-9711-8 |
|
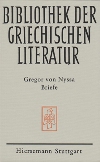 |
Gregor von Nyssa Briefe Hiersemann, 1997, 148 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9701-9 68,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 43 Bearbeitung: Dörte Teske; Wilhelm Gessel (Hrsg.) Das Briefcorpus Gregors von Nyssa bietet durch die Vielfalt der von Gregor angesprochenen Themen einen hochinteressanten Einblick in Wirken und Schaffen des Kirchenvaters (geb. um 334, gest. nach 394). Überlieferungshistorisch hat das Briefcorpus zwei Teile: den ersten bilden die in verschiedensten Handschriften überlief'erten Briefe 1 - 3, den zweiten die in drei Handschriften mit gemeinsamer Quelle überlieferten Briefe 4 - 30, von denen zwei von Gregors Korrespondenten stammen. Die Briefe geben in unterschiedlicher Hinsicht Einblick in Leben und Werk Gregors. Die Briefe 4 - 30 spiegeln eine kurze, bewegte Phase seines Lebens wider. In ihnen lernen wir (Gregor sowohl in seinem Unmut über seine Zeit in Sebaste kennen als auch in seinen verschiedenen Funktionen als Bischof von Nyssa in der Sorge für vertraute Personen, als Schriftsteller, als Streiter für den rechten Glauben, aber auch als Kirchenbauer und als Privatperson. Ebenso legen die späteren Briefe 1 - 3 ein beredtes Zeugnis ab von persönlichen und theologischen Auseinandersetzungen wie von seiner Funktion als Ratgeber in speziellen Fragen. Fast jeder Brief zeigt eine sorgfältige Komposition. Gregor versteht es, die Gestaltung seiner Briefe dem jeweiligen Adressaten anzupassen. Dabei zieht er geschickt alle Register seiner großen klassischen als auch christlichen Bildung und verleiht so jedem Brief ein spezielles Kolorit. Die vorliegende deutsche Übersetzung, die erstmals alle Briefe auf der Grundlage der textkritischen Ausgabe der Gregorii Nysseni Opera umfaßt, ist bemüht, die Eigenheiten des griechischen Originals so weit wie möglich zu bewahren, um auf diese Weise dem des Altgriechischen nicht mächtigen Leser Einblick in die Struktur des Originals zu geben. Die Übersetzung wird erläutert durch eine Einleitung und Anmerkung. Sie bieten dem Leser auf der Grundlage der aktuellen Forschungslage eine schnelle Orientierung zu Sachfragen und in der Forschung kontrovers behandelten Problemen des Briefcorpus. Die Einleitung stellt die einzelnen Briefe thematisch geordnet vor und entwickelt unter Berücksichtigung der handschriftlichen Überlieferung und inhaltlicher Zusammenhänge einen Datierungsansatz für die Briefe. Der Band wird durch vier Register erschlossen und bietet darüber hinaus sowohl ein Verzeichnis der Briefe Gregors als auch ein Gesamtverzeichnis seiner Werke mit Auflistung textkritischer Ausgaben und bereits vorhandener deutscher Übersetzungen. |
|
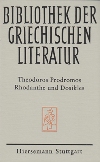 |
Theodoros Prodromos Rhodanthe und Dosikles Hiersemann, 1996, 182 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9612-8 66,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 42 Bearbeitung Karl Plepelits Der byzantinische Literat Theodoros Prodromos (12. Jahrhundert) war ein ungewöhnlich fruchtbarer und vielseitiger Dichter. Die unter seinem Namen überlieferte Erzählung Rhodanthe und Dosikles ist nach heutigem Wissensstand der älteste Versroman in griechischer Sprache. Er hat damit eine Entwicklung zum Abschluss gebracht, die in ihrem Ansatz bereits auf die römische Kaiserzeit zurückgeht. Denn natürlich steht Theodoros Prodromos in der Tradition des antiken Romans, der zu seiner Zeit eine erste Renaissance erlebte. (Eine zweite erfuhr er im 16. Jahrhundert, als er im Westen den europäischen Roman begründete.) Rhodanthe und Dosikles ist ein spannender, durch eine nachgerade virtuose Handlungsführung charakterisierter Liebesroman: zwei junge Leute verlieben sich unsterblich ineinander, und da das Mädchen bereits einem anderen versprochen ist, entführt sie der Held und flieht mit ihr aus der Heimat. Doch auf der Flucht fallen sie räuberischen Barbaren in die Hände, und als diese von einem anderen Barbarenvolk in einer Seeschlacht besiegt werden, werden sie sogar voneinander getrennt. Erst nach vielen Leiden und Abenteuern finden sie wieder zusammen und erleben eine vielbejubelte Rückkehr in ihre Heimatstadt und eine ebenso triumphale Hochzeit. Die hier vorgelegte Übersetzung, die diesen Roman erstmals deutschsprachigem Publikum zugänglich macht – überhaupt ist er bisher lediglich ins Lateinische und Französische übersetzt worden, und die letzte Übersetzung ist bereits 1823 erschienen –, beruht auf einer sehr sorgfältig erarbeiteten Textgrundlage. Über textkritische Probleme sowie biographische, literarhistorische und verschiedene Einzelfragen handelt eine ausführliche Einleitung. Der Erleichterung des Textverständnisses und der Erhellung der Arbeitsweise des Dichters dient ein wissenschaftlicher Kommentar. Ein detailliertes Register beschließt den Band. siehe auch BGL 11, Achilleus Tatio: Leukippe und Kleitophon siehe auch BGL 29 Eustathios Makrembolites: Hysmine und Hysminias siehe auch BGL 42 Theodoros Prodromos: Rhodanthe und Dosikles siehe auch BGL 61, Niketas Eugeneianos: Drosilla und Charikles |
|
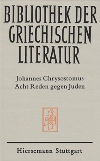 |
Johannes
Chrysostomus Acht Reden gegen Juden Hiersemann, 1995, 342 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9525-1 98,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 41 Bearbeitung: Rudolf Brändle; Wilhelm Gessel (Hrsg.); Verena Jegher-Bucher Nach mehr als 250 Jahren wurden diese Reden des Johannes Chrysostomus (349?-407), der von der Nachwelt die Bezeichnung "Goldmund" erhielt, wieder in die deutsche Sprache übertragen. Das Wagnis war groß, nicht nur wegen des "boshaften" Inhalts der 386/387 gehaltenen Reden, sondern auch im Blick auf den besonderen Schwierigkeitsgrad der harten Ausdrucksweise des Antiocheners. Johannes' acht Reden gegen Juden richten sich in erster Linie gegen "judaisierende" Christen in Antiochien. Äußerungen des Johannes lassen vermuten, daß viele Christen in Antiochien Sympathien für das Judentum hegten. Die Reden wenden sich aber auch gegen Juden und versuchen, diese in den Augen der Christen und "Heiden" schlechtzumachen. Nicht mit Redeschmuck wollte Johannes prunken, sondern die Zuhörer zur "Heiligkeit" führen und die Einheit der Kirche fördern. Dazu bediente er sich des Attischen in asianischer Form. Komplizierte Wortfiguren und Vergleiche waren in ein lesbares Deutsch zu bringen, das die Gefälligkeit in Melodik, Rhythmus und Stil der johanneischen Redeweise widerspiegelt und zugleich seine polemisch-pamphletistische, sympathielose Grundhaltung offensichtlich werden läßt. Rudolf Brändle, der zugleich die Übersetzung sorgfältig überprüfte, bietet in der Einleitung ein auf den neuesten Stand gebrachtes Biogramm des Autors. Alle Fragen, beginnend mit dem Quellenproblem bis zu Absetzung, Exil und Tod des Johannes, sind minutiös dargestellt. Die Reden werden in die Zeitgeschichte integriert, in die Adversus-Judaeos-Literatur eingeordnet und abschließend die Wirkungsgeschichte erörtert. Die Anmerkungen von Rudolf Brändle stellen einen eigenständigen Kommentar dar, der die einschlägigen Fragestellungen aufgreift. Ein erschöpfendes Literaturverzeichnis sowie die Auflistung der Werke des Johannes mit deren Ausgaben und Übersetzungen gestalten diesen Band zu einem vorzüglichen Arbeitsinstrument, das durch ein vierfaches Register (Bibelstellen, antike Namen, moderne Namen, Sachen und Begriffe) detailliert erschlossen wird. siehe dazu: Luthers Judenschriften |
|
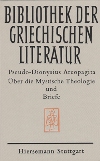 |
Areopagita
Pseudo-Dionysius Über die Mystische Theologie. Briefe Hiersemann, 1994, 228 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9405-6 78,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 40 Bearbeitung: Adolf M Ritter Mit dem hier vorgestellten Band liegt erstmals das gesamte Werk des Areopagiten in deutscher Sprache auf der Grundlage der neuesten kritischen Textgestalt (Berlin 1990 und 1991) vor. 1986 war der erste ( BGL Band 22), 1988 der zweite Band (GL Band 26) erschienen. Alle drei Bände sind in ihrem Übersetzungsteil am Rand mit der Einteilung des Migne-Textes versehen, so daß der Vergleich mit Migne PG 3 leichtfällt. Adolf Martin Ritter hat in seiner Übersetzung bewußt auf die Normalisierung der dunklen Sprache des Areopagiten verzichtet, um den Leser nicht dem allzu leichten Zugriff des augenblicklichen Interesses an der Mystik auszusetzen. Weil Ritter einen mechanischen Anschluß an das griechische Original ebenso vermieden hat wie unnötig freie Abweichungen, ist die Übersetzung gut lesbar geworden. Der Übersetzer hat die oft langen dionysianischen Perioden in kürzere aufgelöst, ohne dabei den Einblick in das logische Verhältnis der vielen Partizipial- und Konjunktionalsätze zueinander zu verschleiern. In einer umfänglichen Gesamteinleitung wird die komplizierte areopagitische Frage einer neuen Gesamtbeurteilung in durchlaufender Diskussion mit den bisherigen wissenschaftlichen Bemühungen unterzogen. Dadurch sollte das Corpus Dionysiacum erneut erschlossen werden. Selbstverständlich wird auch die Wirkungsgeschichte ausführlich behandelt. Demselben Ziel dient das sehr umfangreiche, detailliert strukturierte Literaturverzeichnis, das alle bisherigen wesentlichen Forschungsergebnisse festhält. Vier Register erschließen den Band. Sämtliche drei Bände, in enger Zusammenarbeit der drei Autoren (Heil, Suchla, Ritter) untereinander und mit dem Herausgeber erarbeitet, bieten ein geschlossenes Ganzes, ohne das Profil der Einzelgelehrsamkeit zu verwischen. Zuvor sind erschienen und lieferbar: BGL Band 22: Pseudo-Dionysius Areopagita: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (3-7772-8631-1); BGL Band 26: Pseudo-Dionysius Areopagita: Die Namen Gottes (3-7772-8829-2). |
|
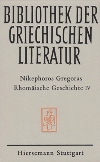 |
Nikephoros Gregoras Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Vierter Teil: Kapitel XVIII - XXIV,2 Hiersemann, 1994, 369 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9402-5 68,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 39 Übersetzt und erläutert von Jan-Louis van Dieten BGL 4 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Erster Teil: Kapitel I - VII 978-3-7772-7309-9 BGL 8 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 1. Halbband: Kapitel VIII - IX ,6 978-3-7772-7904-6 BGL 9 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 2. Halbband: Kapitel IX,7 - XI 978-3-7772-7919-0 BGL 24 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Dritter Teil: Kapitel XII - XVII 978-3-7772-8805-5 BGL 39 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Vierter Teil: Kapitel XVIII - XXIV,2 978-3-7772-9402-5 BGL 59 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Fünfter Teil: Kapitel XXIV,3 - XXIX 978-3-7772-0300-3 BGL 66 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Sechster Teil: Kapitel XXX - XXXVII 978-3-7772-0707-0 |
|
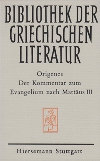 |
Origenes Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus. Dritter Teil: Die Commentariorum Series Band 38 der Reihe Bibliothek der griechischen Literatur Hiersemann, 1993, 417 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9325-7 98,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 38 Bearbeitung Hermann J Vogt Die bedeutendste Leistung des Origenes (etwa 185-253) liegt in der Auslegung fast aller Bücher der hl. Schrift, die er in großen, weitgehend allegorischen Kommentaren (tomoi), knappen Anmerkungen (scholia) oder Predigten (homiliai) hinterlassen hat. Der Mattäus-Kommentar, vor der Dezischen Christenverfolgung (249-251) verfaßt, ist das reifste Werk des Origenes, zugleich sein letztes, manchmal frühere Aussagen korrigierendes, Wort zu zahlreichen theologischen Themen wie Trinitätstheologie, Christologie und Anthropologie. Die Bücher X-XVII zu Mt 11,36 - Mt 22,33 sind griechisch erhalten, eine alte lateinische Übersetzung reicht von Mt 16,13 (im Kommentar also ab XII,9) bis Mt 27,66; zu den ersten zwölf Kapiteln des Mattäusevangeliums und dem letzten, dem achtundzwanzigsten, gibt es nur verstreute Fragmente in späteren byzantinischen Kommentaren. In den beiden ersten Bänden (BGL 18 und 30) wird bei der Übersetzung, der ersten deutschen und der ersten vollständigen in einer modernen Sprache, immer die lateinische Überlieferung berücksichtigt, wo sie ein Textstück bietet, das griechisch nicht erhalten ist, oder wenn sie zur Verbesserung oder Erklärung des griechischen Textes dienen kann; das ist allerdings viel seltener der Fall, als der Herausgeber der Mattäuserklärung in der Reihe der "Griechisch-christlichen Schriftsteller" gemeint hat; der Lateiner verfolgt nämlich recht selbständig asketisch-monastische Interessen. Im dritten, den Mattäuskommentar des Origenes abschließenden Band (BGL 38) wird eine deutsche Übertragung des Teiles der lateinischen Übersetzung des Mattäuskommentars von Origenes vorgelegt, der als "Commentariorum Series" überliefert ist; zu ihr ist das Griechische nicht erhalten. Sie reicht von Mt 22,34 bis Mt 27,66; ihre mittelalterliche Einteilung in 145 Nummern ist zwar nicht immer einleuchtend, wird aber zur Orientierung beibehalten. Im ersten Band wird in einer ausführlichen Einleitung dargestellt, was Origenes über die Entstehung der Bibel und dementsprechend über die Aufgabe des Exegeten in den vor dem Mattäuskommentar verfaßten Werken dargelegt hat; in der Einleitung zum zweiten Band wird hauptsächlich auf das eingegangen, was Origenes zu denselben Fragen in dem großen apologetischen Werk gegen Kelsos gesagt hat., das wohl gleichzeitig mit dem Mattäuskommentar verfaßt ist. Die Einleitung zum dritten Band macht knapp auf die Besonderheiten der "Series" aufmerksam und verweist auf einschlägige Aufsätze des Übersetzers. Jeder Band enthält ein Verzeichnis der Werke des Origenes, das den neuesten Stand der Ausgaben und der deutschen Übersetzungen zeigt. Register der Bibelstellen, der Origeneszitate, antiker Autoren, Sachen (d.h. philosophisch-theologischer Begriffe) und moderner Autoren machen die Bände zu Arbeitsinstrumenten, die nicht nur der Origenes-Forschung nützen werden. BGL Band 18: Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus Erster Teil: Buch X - XIII 978-3-7772-8307-4 BGL Band 30: Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus.Zweiter Teil: Buch XIV - XVII 978-3-7772-9011-9 BGL Band 38 Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus Dritter Teil: Die Commentariorum Series 978-3-7772-9325-7 siehe auch Origenes Werke |
|
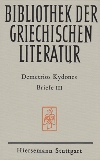 |
Basilius von
Caesarea Briefe Dritter Teil Hiersemann, 1993, 307 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9311-0 68,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 37 Bearbeitung: Wolf D Hauschild BGL32 Basilius von Caesarea Briefe. Erster Teil 978-3-7772-9026-3 BGL 3 Basilius von Caesarea Briefe. Zweiter Teil 978-3-7772-7302-0 BGL 37 Basilius von Caesarea Briefe. Dritter Teil 978-3-7772-9311-0 |
|
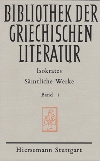 |
Isokrates Sämtliche Werke Band I: Reden I - VIII Hiersemann, 1993, 202 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9307-3 96,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 36 Bearbeitung: Kai Brodersen; Christine Ley-Hutton BGL Band 36 Sämtliche Werke Band I: Reden I - VIII 978-3-7772-9307-3 BGL Band 44 Sämtliche Werke Band II: Reden IX - XXI. Briefe. Fragmente 978-3-7772-9711-8 |
|
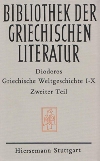 |
Diodoros Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X Hiersemann, 1993, 330 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9220-5 88,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 35 Bearbeitung: Gerhard Wirth; Thomas Nothers BGL Band 34 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9218-2 BGL Band 35 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X 978-3-7772-9220-5 BGL Band 45 Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII 978-3-7772-9739-2 BGL Band 55 Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV 978-3-7772-0125-2 (Beschreibung der Ausgabe) BGL Band 63 Griechische Weltgeschichte. Buch XVIII - XX. BGL Band 63.1 Griechische Weltgeschichte. Buch XVI BGL Band 63.2 Griechische Weltgeschichte. Buch XVII BGL Band 67 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Erster Halbband: Einleitung und Übersetzung BGL Band 68 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Zweiter Halbband: Kommentar |
|
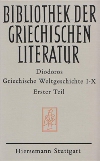 |
Diodoros Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III Hiersemann, 1992, 330 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9218-2 90,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 34 Bearbeitung: Gerhard Wirth; Thomas Nothers BGL Band 34 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Erster Teil: Buch I - III 978-3-7772-9218-2 BGL Band 35 Griechische Weltgeschichte. Buch I - X. Zweiter Teil: Buch IV - X 978-3-7772-9220-5 BGL Band 45 Griechische Weltgeschichte. Buch XI - XIII 978-3-7772-9739-2 BGL Band 55 Griechische Weltgeschichte. Buch XIV - XV 978-3-7772-0125-2 (Beschreibung der Ausgabe) BGL Band 63 Griechische Weltgeschichte. Buch XVIII - XX. BGL Band 63.1 Griechische Weltgeschichte. Buch XVI BGL Band 63.2 Griechische Weltgeschichte. Buch XVII BGL Band 67 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Erster Halbband: Einleitung und Übersetzung BGL Band 68 Griechische Weltgeschichte. Fragmente. Buch XXI - XL. Zweiter Halbband: Kommentar BGL Band 63.2 Griechische Weltgeschichte. Buch XVII |
|
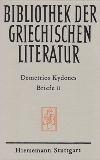 |
Demetrios Kydones Briefe. Zweiter Teil Hiersemann, 1991, 250 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9123-9 48,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 33 Bearbeitung: Franz Tinnefeld BGL 12, Demetrios Kydones, Briefe. Erster Teil, 1. Halbband , 978-3-7772-8120-9 BGL 16, Demetrios Kydones, Briefe. Erster Teil, 2. Halbband 978-3-7772-8220-6 BGL 33, Demetrios Kydones, Briefe. Zweiter Teil, 978-3-7772-9123-9 BGL 50, Demetrios Kydones, Briefe Dritter Teil 978-3-7772-9911-2 (mit Beschreibung) BGL 60, Demetrios Kydones, Briefe. Vierter Teil 978-3-7772-0315-7 |
|
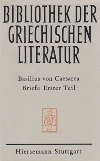 |
Basilius von
Caesarea Briefe Erster Teil Hiersemann, 1990, 261 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9026-3 48,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 32 Bearbeitung: Wolf D Hauschild BGL32 Basilius von Caesarea Briefe. Erster Teil 978-3-7772-9026-3 BGL 3 Basilius von Caesarea Briefe. Zweiter Teil 978-3-7772-7302-0 BGL 37 Basilius von Caesarea Briefe. Dritter Teil 978-3-7772-9311-0 |
|
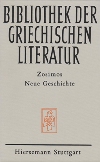 |
Zosimos Neue Geschichte Hiersemann, 1990, 416 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9025-6 nicht mehr lieferbar |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 31 Bearbeitung; Otto Veh, Stefan Rebenich |
|
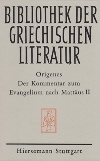 |
Origenes Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus.Zweiter Teil: Buch XIV - XVII Hiersemann, 1990, 380 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-9011-9 98,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 30 Bearbeitung Hermann J Vogt BGL Band 18: Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus Erster Teil: Buch X - XIII 978-3-7772-8307-4 BGL Band 30: Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus.Zweiter Teil: Buch XIV - XVII 978-3-7772-9011-9 BGL Band 38 Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus Dritter Teil: Die Commentariorum Series 978-3-7772-9325-7 siehe auch Origenes Werke |
|
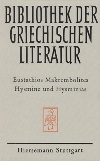 |
Eustathios Makrembolites Hysmine und Hysminias Hiersemann, 1989, 203 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8929-8 39,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 29 Bearbeitung: Karl Plepelits siehe auch BGL 11, Achilleus Tatio: Leukippe und Kleitophon siehe auch BGL 29 Eustathios Makrembolites: Hysmine und Hysminias siehe auch BGL 42 Theodoros Prodromos: Rhodanthe und Dosikles siehe auch BGL 61, Niketas Eugeneianos: Drosilla und Charikles |
|
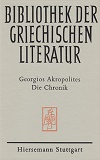 |
Georgios Akropolites Die Chronik Hiersemann, 1989, 294 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8928-1 58,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 28 Bearbeitung: Wilhelm Blum |
|
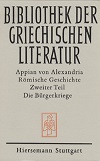 |
Appian von
Alexandria Römische Geschichte. Zweiter Teil. Die Bürgerkriege Hiersemann, 1987, 513 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8915-1 88,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 27 Bearbeitung: Otto Veh; Wolfgang Will BGL Band 23: Appian von Alexandria, Römische Geschichte I I, Die römische Reichsbildung, 1987, 506 Seiten, ISBN 978-3-7772-8723-2 BGL Band 27, Appian von Alexandria, Römische Geschichte II II, Die Bürgerkriege, 1987, 513 Seiten, ISBN 978-3-7772-8915-1 |
|
 |
Areopagita
Pseudo-Dionysius Die Namen Gottes Hiersemann, 1988, 134 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8829-1 60,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 26 Bearbeitung: Beate R Suchla; Die Übersetzung erstellt eine Synthese aus der Wiedergabe des griechischen Textes und seiner Umformung in einen gut lesbaren Text. Der sehr schwierige Stil des Areopagiten erzwang gelegentlich eine freiere Wiedergabe im Deutschen, deren Werktreue an Hand der kommentierenden Anmerkungen, welche die Übersetzung begleiten, mühelos nachgeprüft werden kann. Das Werk "Die Namen Gottes" aus der Feder des Areopagiten stellt eine geschichte Verbindung von Gotteslehre und Schöpfungslehre dar. Durch eine kompromisslos wirkende Verwendung der neuplatonischen Terminologie und durch eine konsequente Einbeziehung und Umdeutung von aristotelischer und neuplatonischer Metaphysik verchristlicht diese Schrift die heidnische Philosophie, vor allem den Neuplatonismus. Der angezeigte Band setzt die mit Band 22 der Bibliothek der griechischen Literatur begonnene Arbeit am Areopagiten fort, die eröffnet wurde mit "Über die himmlische Hierarchie - Über die kirchliche Hierarchie", eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Günter Heil. BGL Band 26 ist ebenso wie BGL Band 22 (ISBN: 3-7772-8631-1) durch eine sachbezogene Einleitung, weiterführende Anmerkungen und ein ausführliches Register für den raschen Zugriff erschlossen. siehe auch BGL 40, Mystische Theologie |
|
 |
Georgios Gemistos Plethon Politik, Philosophie und Rethorik im spätbyzantinischen Reich (1355-1452) Hiersemann, 1988, 218 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8806-2 42,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 25 Bearbeitung: Wilhelm Blum |
|
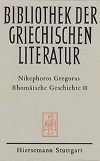 |
Nikephoros Gregoras Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Dritter Teil: Kapitel XII - XVII Hiersemann, 1988, 438 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8805-5 68,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 24 Übersetzt und erläutert von Jan-Louis van Dieten BGL 4 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Erster Teil: Kapitel I - VII 978-3-7772-7309-9 BGL 8 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 1. Halbband: Kapitel VIII - IX ,6 978-3-7772-7904-6 BGL 9 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 2. Halbband: Kapitel IX,7 - XI 978-3-7772-7919-0 BGL 24 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Dritter Teil: Kapitel XII - XVII 978-3-7772-8805-5 BGL 39 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Vierter Teil: Kapitel XVIII - XXIV,2 978-3-7772-9402-5 BGL 59 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Fünfter Teil: Kapitel XXIV,3 - XXIX 978-3-7772-0300-3 BGL 66 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Sechster Teil: Kapitel XXX - XXXVII 978-3-7772-0707-0 |
|
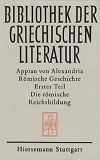 |
Appian von
Alexandria Römische Geschichte. Erster Teil. Die römische Reichsbildung Hiersemann, 1987, 506 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8723-2 88,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 23 Bearbeitung: Otto Veh; Kai Brodersen; Appian von Alexandria verfasste um die Mitte des 2. Jahrhunderts n.Chr. auf Griechisch eine Römische Geschichte von den Anfängen (im 8. Jh. v.Chr.) über das Zeitalter der Reichsbildung und die Bürgerkriege (Emphylia) bis in die trajanische Zeit (2.Jh.n.Chr.). Das Werk ist für manches als unsere einzige historische Quelle von großer Bedeutung, überdies machen Appians bemerkenswerte Darstellungsabsicht und seine rhetorische Stilisierung des Materials auch die Lektüre des Ganzen als historiographisches Opus lohnend. Mit Ausnahme der Emphylia umfasst der vorliegende Band alles von Appian Erhaltene (einschließlich sämtlicher Fragmente und Testimonia), also insbesondere die nach Provinzen (Iberien, Nordafrika, Makedonien, Illyrien, Kleinasien) und Gegnern (Hannibal, Antiochos d.Gr., Mithridates) geordneten Bücher zur Geschichte der römischen Expansion. Die Einleitung informiert über Appians Leben und Werk, über Vorlagen, Darstellungsabsicht und historischen Quellenwert und über die neue Sicht der Textüberlieferung. Das Register identifiziert alle in diesem Band genannten Namen. Erstmals wird somit das Geschichtswerk Appians in einer vollständigen Übersetzung auf dem Stand der Forschung zugänglich; der Band wird für Historiker, klassische Philologen, provinzial-römische Archäologen, Rechtshistoriker und jeden an der römischen Geschichte und Geschichtsschreibung Interessierten von Nutzen sein. BGL Band 23: Appian von Alexandria, Römische Geschichte I I, Die römische Reichsbildung, 1987, 506 Seiten, ISBN 978-3-7772-8723-2 BGL Band 27, Appian von Alexandria, Römische Geschichte II II, Die Bürgerkriege, 1987, 513 Seiten, ISBN 978-3-7772-8915-1 |
|
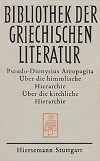 |
Areopagita Pseudo-Dionysius Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie Hiersemann, 1986, 200 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 3-7772-8631-1 978-3-7772-8631-0 82,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 22 Bearbeitung: Wilhelm Gessel; Günter Heil siehe auch BGL Band 26 Die Namen Gottes siehe auch BGL Band 40, Mystische Theologie |
|
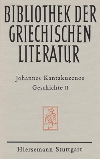 |
Johannes
Kantakuzenos Geschichte. Zeiter Teil (Buch II) B Hiersemann, 1986, 336 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8628-0 64,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 21 Georgios Fatouros; Tilmann Krischer BGL Bd. 17: Johannes Kantakuzenos: Geschichte I Erster Teil: Buch I. 1982. VIII, 336 Seiten. Leinen. ISBN 978-3-7772-8221-3. BGL Bd. 21: Johannes Kantakuzenos: Geschichte II Zweiter Teil: Buch II. 1986. XIV, 291 Seiten. Leinen. ISBN 978-3-7772-8628-0 BGL Bd. 71: : Johannes Kantakuzenos: Geschichte III Dritter Teil: Buch III, 2011, X, 485 Seiten, |
|
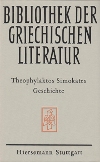 |
Theophylaktos Simokates Geschichte Hiersemann, 1985, 396 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8533-7 vergriffen |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 20 Bearbeitung: Peter Schreiner Theophylaktos Simokates verfasste zwischen 630 und 640 eine Geschichte der Kaiserherrschaft des Maurikios (582-602). Sie schildert die Auseinandersetzung der Byzantiner mit den Persern (Sasaniden) im Osten und den in den Donauraum vordringenden Slaven und Awaren. In einem Exkurs behandelt er auch die Perserkriege zwischen 572 und 582 sowie die Geschichte der Völker Zentralasiens "Skythenexkurs"). Da alle späteren Autoren von ihm abhängig sind, stellt er die einzige Originalquelle für diesen Zeitraum dar und besitzt eigenständigen Wert auch für die spätsasanidische Epoche, die über keine zeitgenössischen Texte verfügt. Das Geschichtswerk, das bisher nur unzlänglich in Lateinische und Russische übertragen war, liegt (auf der Basis einer revidierten Durchsicht der griechischen Teubner-Ausgabe von C. de Boor) erstmals in deutscher Übersetzung vor und wird durch eine Einleitung (25 Seiten), einen vorwiegend historischen Kommentar (130 Seiten), Indices und drei Karten erschlossen. |
|
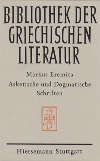 |
Markus Eremita Asketische und dogmatische Schriften Hiersemann, 1985, 374 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8524-5 68,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 19 Bearbeitung: Otmar Hesse Markus Eremita, ein zurückgezogen lebender Mönchsvater des 5. Jahrhunderts (Abt in Ankyra, bei Tarsus oder in der ägyptischen Wüste?), ist bisher von der Fachwelt wenig beachtet worden. Warum? Weil er nicht mit den großen Asketen wie Antonius oder Makarius verglichen wird? Weil sich sein hinterlassenes Werk mit der Gedankentiefe der Kappadokier nicht in jeder Hinsicht messen kann? Weil er kein Interesse an der Kirchenpolitik wie ein Cyrill von Alexandrien oder ein Johannes Chrysostomus hatte? Demgegenüber wird Markus Eremita bis auf den heutigen Tag in den Ostkirchen gelesen und bedacht. In seinen Schriften erscheint Markus (z.B. "Über das geistliche Gesetz", "Über die Buße", "Über die Taufe") als erfahrener Seelsorger und selbständig denkender Theologe. In der Kontroverse mit seinen Gegnern ist er maßvoll und such das Verbindende, wo immer er einen Weg sieht. Er schätzt das "Sowohl" als "Auch". Mönchen und Asketen seiner Zeit und seiner Nachwelt wird das geflügelte Wort "Verkauft alles und kauft Markus" zugeschrieben. Mit vorliegender Übersetzung wird zum ersten Mal ein weitgehend im deutschen Sprachraum unbekannter altchristlicher Schriftsteller vorgestellt. Daher erklärt sich auch die umfängliche Einleitung (S. 3-152), die alle anstehenden Probleme seines Bios und seiner Theologie untersucht und die provozierende Frage stellt: "War Markus ein Antitheologe"? Die Übersetzung seiner als identisch anzuerkennenden Werke arbeitet über den Migne Text hinaus die neuesten Erkenntnisse der Editionsarbeiten mit ein. Der Tatsache, daß sich Markus Eremita selbst als seines geistlichen Auftrages bewußter, biblisch-theologisch gebildeter und pastoral einfühlsamer Mönchslehrer darstellt, versucht die am Wort und am Sinnzusammenhang exakt orientierte Übersetzung gerecht zu werden. Die kommentierenden Anmerkungen möchten u.a. weitere Forschungen zu Markus Eremita anregen. |
|
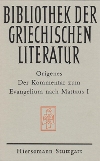 |
Origenes Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus. Erster Teil: Buch X - XIII Hiersemann, 1983, 346 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8307-4 98,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 18 Bearbeitung Hermann J Vogt siehe auch Origenes Werke BGL Band 18: Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus Erster Teil: Buch X - XIII 978-3-7772-8307-4 BGL Band 30: Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus.Zweiter Teil: Buch XIV - XVII 978-3-7772-9011-9 BGL Band 38 Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus Dritter Teil: Die Commentariorum Series 978-3-7772-9325-7 |
|
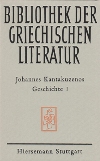 |
Johannes Kantakuzenos Geschichte. Erster Teil (Buch I) Hiersemann, 1982, 336 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8221-3 66,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 17 Georgios Fatouros; Tilmann Krischer Der Kaiser Johannes VI. Kantakuzenos ist neben Michael VIII. die bedeutendste Persönlichkeit der byzantinischen Politik der Palaiologenzeit, und seine in vier Bücher eingeteilte Geschichte, deren erstes Buch hier erstmals in deutscher Übersetzung vorgelegt wird, ist für jene krisenreiche Zeit ein unverzichtbares und ungewöhnlich interessantes Dokument. Mit gewissenhafter Sorgfalt gibt Kantakuzenos aus eigener Anschauung einen detaillierten Bericht über alle wichtigeren innen- und außenpolitischen Ereignisse der Jahre 1320-1356. Der Leser gewinnt daraus tiefe Einblicke in Entwicklungen, die für die Geschichte des gesamten mittleren Ostens von ausschlaggebender Bedeutung sind. Darüber hinaus gibt das Werk Aufschluss über die Mentalität jener Zeit und über die Kräfte, durch die das Reich ein Jahrhundert später zugrunde gehen sollte. BGL Bd. 17: Johannes Kantakuzenos: Geschichte I Erster Teil: Buch I. 1982. VIII, 336 Seiten. Leinen. ISBN 978-3-7772-8221-3. BGL Bd. 21: Johannes Kantakuzenos: Geschichte II Zweiter Teil: Buch II. 1986. XIV, 291 Seiten. Leinen. ISBN 978-3-7772-8628-0 BGL Bd. 71: : Johannes Kantakuzenos: Geschichte III Dritter Teil: Buch III, 2011, X, 485 Seiten, |
|
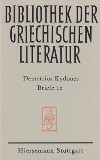 |
Demetrios Kydones Briefe. Erster Teil, 2. Halbband Hiersemann, 1982, 380 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8220-6 58,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 16 Bearbeitung: Franz Tinnefeld BGL 12, Demetrios Kydones, Briefe. Erster Teil, 1. Halbband , 978-3-7772-8120-9 BGL 16, Demetrios Kydones, Briefe. Erster Teil, 2. Halbband 978-3-7772-8220-6 BGL 33, Demetrios Kydones, Briefe. Zweiter Teil, 978-3-7772-9123-9 BGL 50, Demetrios Kydones, Briefe Dritter Teil 978-3-7772-9911-2 (mit Beschreibung) BGL 60, Demetrios Kydones, Briefe. Vierter Teil 978-3-7772-0315-7 |
|
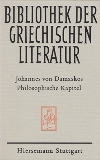 |
Johannes von Damaskos Philosophische Kapitel Hiersemann, 1982, 304 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8203-9 58,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 15 Bearbeitung: Gerhard Richter Mit Johannes von Damaskos (gest. um 750) läuft nach herkömmlicher Meinung die patristische Literatur im Osten aus. Ein Grund mehr, ein wesentliches Stück des geistigen Schaffens des Damaszeners aus dem heute noch bestehenden Mar-Saba Kloster, südöstlich von Jerusalem gelegen, vorzustellen. Die erstmalige Übersetung seiner Philosophischen Kapitel in die deutsche Sprache wird von zwei Schwerpunkten umschlossen: seinem Lebensbild und den philosophiegeschichtlichen Erläuterungen. Alle Notizen zum Leben des Autors wurden zusammengestellt und in einer eigenen Untersuchung zu einem Lebensbild vereinigt. So gewinnt die Persönlichkeit des Johannes von Damaskos erstmals konkrete Züge. Die sehr ausführlichen Erläuterungen überschreiten den üblichen Rahmen von Anmerkungen; denn die Eigenart der Philosophischen Kapitel könnte einem vertieften Eindringen in den Inhalt der Schrift entgegenstehen. Daher wurde in den Erläuterungen der Blick auf zwei Schriften gelenkt, die für das Werk des Damaszeners nach Inhalt und Aufbau im weitesten Sinn maßgebend waren: die Kategorieschrift des Aristoteles und die Eisagoge des Porphyrios. Für die Zeit dazwischen ist eine Auswahl von Kommentaren zu den beiden Schriften herangezogen worden. Dieser historische Aufbau der Erläuterungen stellt die Philosophischen Kapitel in den Kontext ihrer geistesgeschichtlichen Tradition. In einzelnen Ergebnissen kann so ein Beitrag zu einem Abschnitt der Philosophiegeschichte angeboten werden, dessen bisher fehlende Darstellung als Mangel empfunden wird. Diesem Mangel will zusätzlich das umfängliche analytische Register weiter abhelfen, in welchem die dazu einschlägigen Erläuterungen eigens markiert wurden. So entstand in den Erläuterungen zu den Philosophischen Kapiteln des Damaszeners ein vorzügliches Instrument zur Erhellung ihres gedanklichen Umfeldes. Der Text der Philosophischen Kapitel liegt bekanntlich in zwei Rezensionen vor. Sowohl die Kurzform wie die Langform stammen von Johannes von Damaskos. Da die Langform nach der kürzeren verfaßt wurde, bildet die Langform die Grundlage dieser Übersetzung. Diese Textgrundlage gibt so die letzt geäußerten Vorstellungen des Damaszeners wieder. Die Übersetzung ist bemüht, das Werk in seiner unverwechselbaren Form erkennen zu lassen und gleichzeitig das über die schiere Kompilation hinausgehende Denken des Verfassers transparent zu machen. |
|
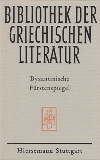 |
Byzantinische Fürstenspiegel Hiersemann, 1981, 205 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8132-2 48,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 14 Agapetos; Theophylakt von Ochrid; Thomas Magister Bearbeitung Wilhelm Blum Die literarische Gattung der Fürstenspiegel wurde in der klassischen Antike von Isokrates geschaffen und fand in der Folgezeit immer wieder neue Vertreter. Das Genus der Fürstenspiegel im lateinischen Abendland ist längst bekannter Gegenstand der Forschung, für Byzanz ist das weit weniger der Fall. Daher wurden in dem vorliegenden Band die Fürstenspiegel des Diakons Agapetos (6. Jh.), des Erzbischofs Theophylakt von Ochrid (11./12. Jh.) und des Thomas Magister (13./14. Jh.) übertragen; hinzu kommt die Übersetzung des Untertanenspiegels des Thomas Magister (mit Ausnahme der Ekthesis des Agapetos sind alle Schriften zum ersten Mal in eine moderne Sprache übertragen worden). Den Übersetzungen vorangestellt ist eine Einführung in das Wesen der Fürstenspiegelliteratur in der Antike, im lateinischen sowie im russischen und böhmischen Mittelalter. Ebenso ist erstmals ein Überblick über alle erhaltenen Fürstenspiegel aus der byzantinischen Zeit (4. - 15. Jh.) gegeben. In den übersetzten Schriften wird man alle Aussagen wiederfinden, die zum Klischee der Fürstenspiegel gehören. Daneben aber trifft man auch auf bemerkenswerte eigenständige Gedanken, so etwa die ungemein modern anmutenden Ausführungen des Thomas Mag. über Krieg und Frieden oder die eindringliche Schilderung der Tyrannenherrschaft bei Theophylakt. In Thomas Magisters Untertanenspiegel beeindrucken die Ausführungen über Bildung, Erziehung und Wissenschaft -als Pflichten der Untertanen! Somit stehen die byzantinischen Fürstenspiegel nicht nur in der Tradition, sondern bergen durchaus den Reiz des Neuen. |
|
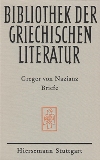 |
Gregor von Nazianz Briefe Hiersemann, 1981, 300 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8127-8 68,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 13 . Zur Zeit nicht lieferbar, wir merken für den Nachdruck vor Bearbeitung: Michael Wittig Herkömmlicherweise werden die beiden Brüder Basilius der Große und Gregor von Nyssa, sowie ihr gemeinsamer Freund Gregor von Nazianz zur Dreiheit der "großen Kappadozier" zusammengefaßt, wobei Basilius als der überragende, seine Freunde führende Kopf gekennzeichnet wird, ein Mann der Tat - Gregor von Nazianz dagegen als derjenige, der zurückgezogen lebte, der zu praktischer Tätigkeit wenig begabt war. Viele Arbeiten über diesen Kirchenvater des vierten Jahrhunderts beziehen ihr Bild von Gregor hauptsächlich aus dessen Predigten. Die Lektüre der Briefe ergibt ein umfassenderes Bild von diesem Mann und seiner Auffassung von einem Theologen. - Es lag nahe, zum besseren Verständnis zusätzlich ein Lebensbild dieses Mannes zu skizzieren. |
|
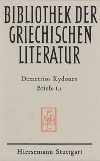 |
Demetrios Kydones Briefe. Erster Teil, 1. Halbband Hiersemann, 1981, 299 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8120-9 vergriffen |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 12 Bearbeitung: Franz Tinnefeld BGL 12, Demetrios Kydones, Briefe. Erster Teil, 1. Halbband , 978-3-7772-8120-9 BGL 16, Demetrios Kydones, Briefe. Erster Teil, 2. Halbband 978-3-7772-8220-6 BGL 33, Demetrios Kydones, Briefe. Zweiter Teil, 978-3-7772-9123-9 BGL 50, Demetrios Kydones, Briefe Dritter Teil 978-3-7772-9911-2 (mit Beschreibung) BGL 60, Demetrios Kydones, Briefe. Vierter Teil 978-3-7772-0315-7 |
|
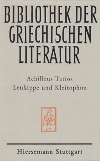 |
Achilleus Tatio Leukippe und Kleitophon Hiersemann, 1980, 264 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8008-0 49,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 11 Bearbeitung: Karl Plepelits Unter allen aus der griechischen Antike überlieferten Romanen dürfte Achilleus Tatios Liebesroman "Leukippe und Kleitophon" derjenige sein, welcher dem modernen Roman am nächste steht. In ihm sind nämlich, wie dann wieder im 18. Jahrhundert in Henry Fieldings "Joseph Andrews", dem Beginn des modernen englischen Romans, die ideale und die pikareske Tradition epischer Erzählweise miteinander verschmolzen worden, wodurch sich die Möglichkeiten der Gattung Roman und ihre Leistungsfähigkeit als künstlerisches Medium zur kritischen Beurteilung oder Interpretation des Lebens in allen seinen Aspekten gewaltig erweitert haben. Nur scheint nach allem, was wir wissen, Achilleus Tatios Veruch - im Gegensatz zu dem von Henry Fielding - ohne Nachfolge geblieben zu sein. Was die Abfassungszeit von Leukippe und Kleitophon betrifft, verweisen die Indizien - zur Person ihres Autors existieren leider kaum irgendwelche sicheren oder unumstrittenen Nachrichten - deutlich auf das dritte Viertel des 2. Jahrhunderts nach Christus. Die Handlung selbst spielt entweder in der Zeit des Verfassers selbst oder - wofür einiges spricht - in der Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus, nicht jedoch im 5. oder 4. Jahrhundert vor Christus, wie meist behauptet wird. Die hier vorgelegte Übersetzung, die diese Liebes- und Reiseliteratur- Geschichte erstmals wieder einem deutschsprachigen Publikum zugänglich macht, beruht auf einer sehr sorgfältig erarbeiteten Textgrundlage. Über textkritische Probleme sowie biographische, literarhistorische und verschiedene Einzelfragen handelt eine ausführliche Einleitung. Der Erleichterung des Textverständnisses und der Erhellung der Arbeitsweise des Autors dient ein wissenschaftlicher Kommentar. Ein detailliertes Register beschließt den Band. siehe auch BGL 11, Achilleus Tatio: Leukippe und Kleitophon siehe auch BGL 29 Eustathios Makrembolites: Hysmine und Hysminias siehe auch BGL 42 Theodoros Prodromos: Rhodanthe und Dosikles siehe auch BGL 61, Niketas Eugeneianos: Drosilla und Charikles |
|
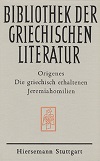 |
Origenes Die griechisch erhaltenen Jeremiahomilien Hiersemann, 1980, 384 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-8007-3 69,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 10 Inhaltsverzeichnis und Vorwort siehe auch Origenes Werke Band 11 Die Homilien zum Buch Jeremia. |
|
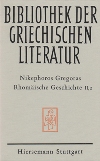 |
Nikephoros Gregoras Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 2. Halbband: Kapitel IX,7 - XI Hiersemann, 1979, 221 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-7919-0 42,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 9 Übersetzt und erläutert von Jan-Louis van Dieten BGL 4 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Erster Teil: Kapitel I - VII 978-3-7772-7309-9 BGL 8 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 1. Halbband: Kapitel VIII - IX ,6 978-3-7772-7904-6 BGL 9 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 2. Halbband: Kapitel IX,7 - XI 978-3-7772-7919-0 BGL 24 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Dritter Teil: Kapitel XII - XVII 978-3-7772-8805-5 BGL 39 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Vierter Teil: Kapitel XVIII - XXIV,2 978-3-7772-9402-5 BGL 59 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Fünfter Teil: Kapitel XXIV,3 - XXIX 978-3-7772-0300-3 BGL 66 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Sechster Teil: Kapitel XXX - XXXVII 978-3-7772-0707-0 |
|
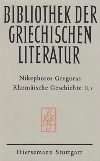 |
Nikephoros Gregoras Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 1. Halbband: Kapitel VIII - IX ,6 Hiersemann, 1979, 219 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-7904-6 42,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 8 Bearbeitung: Jan L van Dieten Der vorliegende erste Teil dieses zweiten Bandes bringt die Einleitung zum ganzen Abschnitt Kap. VIII-XI, das Literaturverzeichnis zu diesem Abschnitt und die Übersetzung von Kap. VIII-IX 6 mit den dazu gehörenden Anmerkungen, der zweite Teil (Band ) enthält die Übersetzung von Kap. IX, 7-XI mit den dazu gehörenden Anmerkungen und das Register zum ganzen Band. Die Trennung nach Kap. IX 6 wurde deshalb gewählt, weil hier der Bericht über den Machtwechsel von Andronikos II. zu Andronikos III. endet und mit Kap. IX 7 die Berichterstattung über die Alleinherrschaft Andronikos' III. beginnt; dieser Einschnitt ist historisch bedeutsamer als der Tod Andronikos' II., womit Gregoras Kap. IX beschließt, und erlaubt außerdem eine Verteilung des Stoffes über zwei etwa gleichstarke Halbbände. BGL 4 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Erster Teil: Kapitel I - VII 978-3-7772-7309-9 BGL 8 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 1. Halbband: Kapitel VIII - IX ,6 978-3-7772-7904-6 BGL 9 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 2. Halbband: Kapitel IX,7 - XI 978-3-7772-7919-0 BGL 24 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Dritter Teil: Kapitel XII - XVII 978-3-7772-8805-5 BGL 39 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Vierter Teil: Kapitel XVIII - XXIV,2 978-3-7772-9402-5 BGL 59 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Fünfter Teil: Kapitel XXIV,3 - XXIX 978-3-7772-0300-3 BGL 66 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Sechster Teil: Kapitel XXX - XXXVII 978-3-7772-0707-0 |
|
 |
Gregor von Nyssa Über das Wesen des christlichen Bekenntnisses. Über die Vollkommenheit. Über die Jungfräulichkeit Hiersemann, 1977, 169 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-7713-4 42,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 7 Bearbeitung: Wilhelm Blum |
|
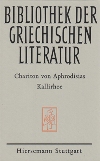 |
Chariton von Aphrodisias Kallirhoe Hiersemann, 1976, 200 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-7626-7 48,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 6 Bearbeitung: Karl Plepelits Charitons Kallirhoe ist nicht nur mit hoher Wahrscheinlichkeit der älteste vollständig erhaltene Roman der Weltliteratur, sondern unter den antiken griechischen Romanen vielleicht auch der lesenswerteste. Er dürfte um die Mitte des 1. Jahrhunderts n.Chr. entstanden sein - über den Autor selbst ist leider kaum mehr bekannt, als dass er in Aphrodisias im westlichen Kleinasien beheimatet war; die Handlung spielt aber in der bereits damals als klassisch empfundenen Epoche des 5. und 4. Jahrhunderts v.Chr. Chariton erzählt, wie er eingangs selbst sagt, die Geschichte "einer leidenschaftlichen Liebe". Im Mittelpunkt steht Kallirhoe, eine junge Frau von bezaubernder Schönheit, deren Schicksal eben diese Schönheit ist; denn durch sie zieht sie alle Männer, denen sie begegnet, unwiderstehlich in ihren Bann. Abgesehen von dem literar- und kulturhistorischen Interesse, das dieses Werk des Chariton für uns hat, spricht es auch den heutigen Leser unmittelbar an durch packende Handlungsführung, kristallkaren Aufbau, menschliche Wärme und einen erfrischenden, gänzlich unprätentiösen Stil. Die in historisches Gewand gekleidete Abenteuer-Geschichte einbezieht im großzügig-kühnen Schwung den ganzen Mittelmeerraum. Die hier vorgelegte Übersetzung, die diesen Roman erstmals seit über 200 Jahren wieder einem deutschsprachigen Publikum zugänglich macht, beruht auf einer sehr sorgfältig erarbeiteten Textgrundlage. Über textkritische Probleme sowie biographische, literarhistorische und verschiedene Einzelfragen wie z.B. zur Titelform - die Erzählung ist bisher bekannt gewesen unter dem Titel Chaireas und Kallirhoe - handelt eine ausführliche Einleitung. Der Erleichterung des Textverständnisses und der Erhellung der Arbeitsweise des Autors dient ein wissenschaftlicher Kommentar. Am Schluss des Bandes steht ein detailliertes Register. |
|
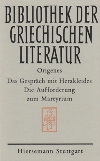 |
Origenes Das Gespräch mit Herakleides und dessen Bischofskollegen über Vater, Sohn und Seele Die Aufforderung zum Martyrium. Hiersemann, 1974, 170 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-7401-0 42,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 5 Bearbeitung: Edgar Früchtel siehe auch Origenes |
|
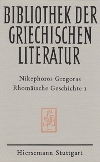 |
Nikephoros Gregoras Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Erster Teil: Kapitel I - VII Hiersemann, 1973, 339 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-7309-9 64,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 4 Übersetzt und erläutert von Jan-Louis van Dieten BGL 4 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Erster Teil: Kapitel I - VII 978-3-7772-7309-9 BGL 8 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 1. Halbband: Kapitel VIII - IX ,6 978-3-7772-7904-6 BGL 9 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Zweiter Teil, 2. Halbband: Kapitel IX,7 - XI 978-3-7772-7919-0 BGL 24 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Dritter Teil: Kapitel XII - XVII 978-3-7772-8805-5 BGL 39 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Vierter Teil: Kapitel XVIII - XXIV,2 978-3-7772-9402-5 BGL 59 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Fünfter Teil: Kapitel XXIV,3 - XXIX 978-3-7772-0300-3 BGL 66 Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. Sechster Teil: Kapitel XXX - XXXVII 978-3-7772-0707-0 |
|
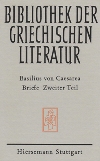 |
Basilius von Caesarea Briefe. Zweiter Teil Hiersemann, 1973, 192 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-7302-0 48,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 3 Bearbeitung: Wolf D Hauschild BGL32 Basilius von Caesarea Briefe. Erster Teil 978-3-7772-9026-3 BGL 3 Basilius von Caesarea Briefe. Zweiter Teil 978-3-7772-7302-0 BGL 37 Basilius von Caesarea Briefe. Dritter Teil 978-3-7772-9311-0 |
|
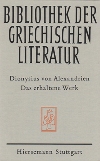 |
Dionysius von Alexandrien Das erhaltene Werk Hiersemann, 1972, 137 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-7215-3 42,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 2 Bearbeitung: Wolfgang A Bienert |
|
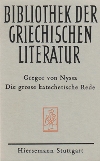 |
Gregor von Nyssa Die grosse katechetische Rede Hiersemann, 1971, 231 Seiten, Leinen, 23,5 x 16 cm 978-3-7772-7119-4 54,00 EUR |
Bibliothek der griechischen Literatur Band 1 Übersetzung: Joseph Barbel Die "Oratio catechetica magna" stellt das wohl bedeutendste dogmatische Werk des Gregor von Nyssa (um 335-394) dar. Sie ist eine nahezu unpolemisch gehaltene Schrift, die eine für die kirchlichen Vorsteher bestimmte Begründung und Verteidigung der christlichen Hauptdogmen gegenüber Heiden und Juden beinhaltet. Die Stärke dieser auch rhetorisch kunstvoll ausgearbeiteten Schrift des Großen Nysseners liegt in der dialektischen Beweisführung. Die bisherigen Übersetzungen von 1874 und 1924 dürfen als in jeder Hinsicht überholt bezeichnet werden. Barbels Übersetzung genügt allen modernen wissenschaftlichen Ansprüchen und erläutert in einem ausführlichen Kommentar insbesondere die theologiegeschichtlichen Gesichtspunkte aus der Lehre Gregors selbst. |
|