| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Emil Brunner | ||
 |
Gotthard Jasper Paul Althaus, Karl Barth, Emil Brunner Briefwechsel 1922–1966 Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, 184 Seiten, gebunden, 978-3-525-55091-5 59,00 EUR |
Gotthard Jasper präsentiert zwei unerwartete und ungleiche
persönliche Briefwechsel zwischen dem konservativen, eher
deutschnationalen, aber aus dem Pietismus stammenden lutherischen
Theologen Paul Althaus und seinen
schweizerischen reformierten Kollegen und Kontrahenten
Emil Brunner und
Karl Barth. Der Briefwechsel mit Emil Brunner ist geprägt durch eine bei persönlichem Treffen entstandene tiefe persönliche Freundschaft, die trotz aller im Briefwechsel dokumentierten wissenschaftlichen und politischen Kontroversen sich das gemeinsame Leben lang erhält. Er liefert ein erhellendes Zeugnis für die politischen und theologischen Positionen von Paul Althaus – z. B. auch für seine differenzierte politische Haltung zum Ansbacher Ratschlag von 1934. Der Briefwechsel mit Karl Barth entsteht eher förmlich aus einer Kontroverse heraus, entwickelt sich dann aber – nach einem persönlichen Treffen – sehr viel persönlicher, ohne die kontroversen Standpunkte zu verschweigen oder zu beseitigen; vielmehr werden sie klar formuliert. Er pausiert – wohl von Karl Barth abgebrochen – während der Herrschaft des NS, wird aber 1950 auf Initiative von Althaus wieder aufgenommen und reflektiert intensiv das persönliche Verhältnis zweier kontroverser Theologen. Inhaltsverzeichnis und Leseprobe |
 |
Karl Barth -
Emil Brunner Briefwechsel 1916 - 1966 Theologischer Verlag Zürich, 2000, 470 Seiten, Leinen, 978-3-290-17202-2 78,00 EUR |
Barth Gesamtausgabe
Band 33 I:n den über 170 Karten und Briefen, die Karl Barth und Emil Brunner zwischen 1916 und 1966 wechselten, spiegeln sich 50 Jahre Theologiegeschichte – und in den Jahren des deutschen Kirchenkampfes und der Selbstbehauptung der Schweiz im Zweiten Weltkrieg auch ein aufregendes Stück europäischer Geschichte. Zugleich zeigt uns der Briefwechsel als Dokument einer zeitweise von heftigen Gegensätzen bewegten Freundschaft zwei eindrucksvolle Charakterköpfe. Immer neu geht die Auseinandersetzung um die Grundfragen: Was ist die Sache der Theologie – im Gegenüber zu Philosophie, Kultur und Gesellschaft? Wie findet die Kirche zu ihrer Sache? Und wie findet sie zu ihrer lebendigen Gestalt? Was ist ihre Verantwortung gegenüber dem Staat? Und wie bewährt sie sich in den gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen? Der Briefwechsel führt so mitten hinein in die Weggemeinschaft und das Spannungsfeld der «Dialektischen Theologie». Die theologischen Themen der Zeit werden hier in lebhafter Unmittelbarkeit diskutiert: der Religiöse Sozialismus, die Kritik am Neuprotestantismus, das Problem von Schrift und Offenbarung, später die Frage der «natürlichen Theologie», die Barmer Theologische Erklärung und die Oxford-Gruppenbewegung, die Stellung zum Hitlerstaat und zum Kalten Krieg. In geradezu dramatischer Weise reden und ringen die Freunde miteinander, sie reiben sich hart aneinander und lassen sich doch nicht los. Der bewegende Schlußpunkt der Beziehung ist der Zuspruch des barmherzigen Ja-Worts Gottes an den sterbenden Brunner. So wirft der Briefband nicht nur neues Licht auf die «Dialektische Theologie», die ein bestimmender Faktor der Theologiegeschichte des 20. Jahrhunderts war. Er führt zugleich an Brennpunkte theologischen Fragens auch in der Gegenwart. |
 |
Emil Brunner Gerechtigkeit Theologischer Verlag Zürich, 2002, 376 Seiten, 444 g, Softcover, 978-3-290-11450-3 48,00 EUR |
Eine Lehre von den Grundsätzen der Gesellschaftsordnung 'In diesem Buch versuchte ich die christlich-theologische Grundlage und Begründung einer Gesellschaftsordnung herauszuarbeiten, wie wir sie für die Nachkriegszeit erhofften. Von Juristen, Ökonomen und Politikern wurde dieses Werk mit ungewöhnlichem Interesse aufgenommen. Hier habe ich die Grundthese meiner sozial-ethischen Konzeption herausgearbeitet und in der Anwendung auf alle Lebensgebiete entfaltet, nämlich die These: Entweder Begründung des Rechtes auf das göttliche Recht oder dann Zwangsordnung des Totalstaates in ihrer faschistischen oder konsequenten kommunistischen Gestalt.' |
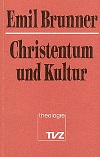 |
Emil Brunner Christentum und Kultur Theologischer Verlag Zürich, 1979, 335 Seiten, Softcover, 978-3-290-11440-4 18,80 EUR |
Emil Brunner hatte 1947/48 an der Universität Edinburgh die sogenannten Gifford Lectures gehalten. In dieser Veröffentlichung in deutscher Sprache entwickelt er eine eigenständige Sicht der Zusammenhänge und Unterschiede zwischen Kultur und christlichem Glauben. |
|
Ivar Pöhl Das Problem des Naturrechtes bei Emil Brunner Zwingli Verlag, 1963, 231 Seiten, kartoniert | Studien zur Dogmengeschichte und Systematischen Theologie Band 17 | |