| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Adolf Schlatter, Arbeiten, Biographien | Adolf Schlatter Bibelkommentare, Theologische Arbeiten | Reihe Erläuterungen zum Neuen Testament |
|
Adolf Schlatter Bibelkommentare |
||
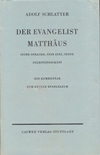 |
Adolf Schlatter Der Evangelist Matthäus Calwer Verlag, 1982, 828 Seiten, Leinen, Schutzumschlag 3-7668-0194-5 978-3-7668-0194-4 8,00 EUR |
Seine Sprache, sein Ziel, seine
Selbstständigkeit. Ein Kommentar zum ersten Evangelium von Professor D. Dr. A. Schlatter Das Buch führt den Nachweis, daß Matthäus der erste Evangelist der Kirche sei, Markus gegenüber selbständig, ein Palästiner, der Semitisch und Griechisch spricht, ein Jünger Jesu; zugleich gibt es ein eindruckvolles Bild der palästinischen Christenheit in ihrer eigenartigen Stärke. Der Verfasser wünscht sich, daß dieses erste und mächtigste der Evangelien dem Studenten und dem Pfarrer nicht ein farbloses, in weiter Entfernung schwankendes Schriftstück bleibe, sondern seine historisch echte Farbe bekomme: »Ich schrieb in der Meinung, wenn irgendein Buch, so sei dieses Evangelium des Lesens wert. Denen, die den Mut zur edlen, aber schweren Kunst des Lesens haben, gilt mein Gruß; ich verspreche ihnen, wenn sie nicht nur mich, sondern Matthäus lesen, reichen Gewinn.« Leseprobe |
 |
Adolf Schlatter Markus. Der Evangelist für die Griechen Calwer Verlag, 1984, XVI, 280 Seiten, Leinen, Schutzumschlag 3-7668-0585-1 978-3-7668-0585-0 6,00 EUR |
Mit einem
Geleitwort von Karl Heinrich Rengstorf Dieser Kommentar ist so etwas wie eine Aufforderung zu einer unkonventionellen Bergbesteigung. Hat man einen Berg mehrfach erklettert, dabei jedoch stets die gleiche Route benützt, so kann man im allgemeinen nicht behaupten, man kenne diesen Berg. Steigt man dagegen auf einem sonst nicht begangenen Wege auf, so eröffnen sich Blicke in unbekannte Schönheiten. Wer unter Schlatters Führung das zweite Evangelium studiert, dem ergeben sich originelle Einsichten in die Arbeit der Männer, die uns die Evangelien schenkten. Den "normalen Einstieg" in das alte Problem, wie Markus und Matthäus aneinanderhängen, wird der neugierige Leser sicherlich kennen. Auch wenn man schließlich eine von Schlatter abweichende Lösung bevorzugt, wird man es nicht bereuen, mit ihm einmal »alternativ- gewandert zu sein. Schlatters Name bürgt nicht nur für Originalität, sondern auch für Qualität. Er beobachtet genau, was Markus seinem Leserkreis vermitteln wollte und vor welchem Christentum er warnt. Der Kommentar läßt tief in die Theologie des Markus sehen. Er ist auch für den wertvoll, der in Bibelarbeit und Predigt den zweiten Evangelisten genau zu hören versucht. Inhaltsverzeichnis Leseprobe zur Seite Evangelisten |
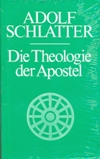 |
Adolf Schlatter Die Theologie der Apostel Calwer Verlag, 1984, 578 Seiten, Leinen, Schutzumschlag 3-7668-0543-6 978-3-7668-0543-0 9,00 EUR |
Adolf Schlatters
Theologie der Apostel ist ein
geschlossener Entwurf und gehorcht einer faszinierenden Konzeption: Die
gesamte Verküdigung der ersten Kirche folgt der Wirkung und dem Willen
des gekreuzigten und auferstandenen Christus. Die Darstellung geht aus
von dem österlichen Glaubensstand der Apostel, stellt dann zuerst die
Botschaft jener Männer dar, die Schlatter für angehörige des
Apostelkreises hält, läßt nun erst die Theologie des
Paulus folgen, geht schließlich über zu
den Zeugen, die nur Helfer und Schüler der Apostel waren, und kommt zum
Ziel in einer Skizze jener dogmatischen Erkenntnisse, welche die erste
Kirche einen. Diese Gesamtdarstellung bleibt wegweisend auch dann, wenn
heute in virelem geschichtlich stärker differenziert werden muß; denn
sie macht einsichtig, wie sich der christliche Glaube von Jerusalem aus
in einer missionarischen Bewegung entfaltete, die schließlich die
gesamte antike Welt ergriff. Mit einem Vorwort von Hans Stroh und Peter Stuhlmacher. Inhaltsverzeichnis Leseprobe |
 |
Gottfried Egg Adolf Schlatters kritische Position Calwer Verlag, 1968, 264 Seiten, Leinen, 3-7668-0035-3 978-3-7668-0035-0 8,00 EUR |
Arbeiten zur
Theologie 2. Reihe Band 14 Gezeigt an seiner Matthäusinterpretation Der Verfasser weist nach: Wer Schlatter verstehen will, muß ihn von seiner Methodologie her begreifen. Die zahlreichen Übereinstimmungen Schlatters mit der heutigen historisch-kritischen Wissenschaft, etwa im Bilde von der Kirche des Matthäus oder in der redaktionsgeschichtlichen Forschung, machen ihn noch nicht zum modernen Neutestamentler. Noch weniger beweist Schlatters Stellung in der christologischen Frage, seine Zurückhaltung in der Entmythologisierungsdebatte oder seine Beschränkung der form- und traditionsgeschichtlichen Fragestellung schon eine veraltete, konservative Haltung. Schlatter steht grundsätzlich in den Reihen der historisch-kritischen Wissenschaft und ist Vertreter einer Existenztheologie. Seine Denkvoraussetzung im Gottesbegriff aber und seine allein von daher zu verstehenden Methoden sind nicht die der historisch-kritischen Forschung allgemein. Seine Aktualität ruht in der Vorwegnahme vieler moderner Fragestellungen, sein Spezifikum in ihrer selbständig methodischen Verarbeitung. Inhaltsverzeichnis Leseprobe |
 |
Adolf Schlatter Gottes Gerechtigkeit Ein Kommentar zum Römerbrief Calwer Verlag, 1991, 412 Seiten, kartoniert, 21,5 x 13,5 cm 3-7668-3112-7 978-3-7668-3112-5 6,00 EUR |
"Die erste Herausforderung ist die, daß sich
Schlatter einen von Jesus und Jerusalern losgelösten Paulus nicht
denken kann und will. So sehr wir heute an diese Art isolierter
Paulusbetrachtung gewöhnt sind, so deutlich gibt Schlatter zu erkennen,
daß es sich seiner Meinung nach dabei um eine bloße kritische Konjektur
von Exegeten handelt, die mutwillig von den uns vorliegenden Quellen und
der historischen Wahrscheinlichkeit abweichen. Nach Schlatter ist Paulus
theologisch als der Bote Jesu zu begreifen ... Der nächste Anstoß, den
Schlatters Paulusauslegung uns bereitet, greift noch tiefer und rührt in
mehrfaeher Hinsicht an den Nerv aller theologisch orientierten
Paulusauslegung. Er ist vierfacher Art, weil Schlatter den Apostel nicht
konfessionalistisch eng, sondern in ökumenischer Weite versteht; weil er
das Zentrum der paulinischen Evangeliumsverkündigung in der Botschaft
von der Gottesgerechtigkeit in Christus sieht; weil er die
Unterscheidung von Gesetz und Evangelium als untauglich für die
Erfassung der paulinischen Lehre vom Gesetz erachtet; und weil er die
Glaubensgerechtigkeit, die Paulus lehrt, unlösbar mit dem christlichen
Handeln in Gerechtigkeit und Liebe verbunden sieht. Adolf Schlatter wurde in seiner Zeit von allen Seiten angefochten. Doch sein Paulusverständnis hat sich - insgesamt gesehen - als das historisch bessere und wegweisendere herausgestellt." Aus dem Vorwort von Peter Stuhlmacher Inhaltsverzeichnis Leseprobe |
 |
Adolf Schlatter Paulus, der Bote Jesu Calwer Verlag, 1985, 692 Seiten, Leinen, Schutzumschlag 3-7668-0198-8 978-3-7668-0198-2 15,00 EUR |
Eine Deutung seiner
Briefe an die Korinther » Dieses Werk ist der einzige Kommentar zu den Korintherbriefen, der eine ausführliche theologische Interpretation gibt und deshalb für uns schlechterdings unentbehrlich geblieben ist.« Prof. D. Ernst Käsemann Inhaltsverzeichnis Leseprobe |
 |
Adolf Schlatter Der Brief des Jakobus Calwer Verlag, 1985, XII, 304 Seiten, Leinen, Schutzumschlag 978-3-7668-0761-8 6,00 EUR |
Mit einem Geleitwort von Franz Mussner Für Luther war nach semem bekannten Ausspruch der Jakobusbrief eine stroherne Epistel. Die heutige Exegese sieht den Brief im wesentlichen von seiner jüdischen und griechischen Umwelt her und versteht ihn als eine ziemlich bunte Sammlung von lose aneinandergereihten Weisheitssprüchen aus dem jüdischen, hellenistischen und christlichen Gedankenkreis. Dabei erhebt sich freilich die Frage, was für ein Gegenüber der Verfasser vor sich hatte und zu welchem Zweck sein Schreiben dienen sollte. Schlatters Kommentar tritt zu dieser Auffassung in völligen Gegensatz. Er nimmt den Brief als ein Schreiben des Jakobus, des Bruders Jesu, den Paulus, Lukas und Johannes das Haupt der jüdischen Christen nannten, in dem uns also »eine Stimme aus der nächsten Nähe Jesu und dem engsten Kreis der ersten Jünger erreicht « , Angeredet ist Israel, dessen Merkmal es ist, daß es in der Zerstreuung lebt, das aber Kraft seiner Berufung trotz der durch Jesus bewirkten Scheidung ein Ganzes darstellt. Beide, der an Jesus glaubende und der ihm den Glauben versagende Teil der Judenschaft, stehen unter der gleichen Gnade Gottes und unter derselben Versuchung. Diese Zuordnung begründet Schlatter durch eine reiche Fülle sachlicher Beobachtungen; sie betreffen den Anschluß des Jakobus an Jesus, die Gemeinschaft des Jakobus mit Matthäus, das Leben in der Zukunft, die Offenbarung des Geistes in der Gemeinde, die Gemeinschaft des Jakobus mit Paulus, die Gemeinsamkeit zwischen dem Brief des Jakobus und dem 1. Petrusbrief, die Verbundenheit des Jakobus mit Johannes. Schlatter erreicht durch seine Deutung, daß der Brief in seinen wechselnden Inhalten einen überzeugenden Sinnzusammenhang gewinnt. Die Frage, wie es möglich war, daß im jüdischen Jerusalem eine zu Jesus sich bekennende Gemeinde durch Jahrzehnte sich halten konnte, ohne entweder ihren Herrn zu verleugnen oder die Juden zu hemmungslosen Vernichtungs akten zu reizen, erhält eine überaus lehrreiche Antwort. Sie bestätigt vollauf Schlatters Urteil, daß »unsere Kirchen sich dadurch, daß sie Jakobus nur ganz oberflächlich Gehör gewährten, ernsthaft geschädigt haben «, Inhaltsverzeichnis Leseprobe |
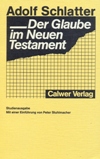 |
Adolf Schlatter Der Glaube im Neuen Testament Studienausgabe Calwer Verlag, 1982, kartoniert 617 Seiten, 11,7 x 19 cm 3-7668-0710-2 978-3-7668-0710-6 4,00 EUR |
Mit einer Einführung von Peter Stuhlmacher. Ausgangspunkt zu seinem Werk "Der Glaube im Neuen Testament", das ihn in der wissenschaftlichen Welt bekannt gemacht hat, war für Adolf Schlatter der Gedanke, daß "eine Theologie und Christenheit, die nicht mehr wisse, was das Neue Testament Glaube nenne, tot wäre". Genau 100 Jahre nach dem ersten Entwurf (1882) wird - als preiswerte Studienausgabe - die 6. Auflage vorgelegt. Der Text folgt der letzten, von Schlatter selbst besorgten Ausgabe von 1927. Daß Schlatters Darstellung nach wie vor wegweisend und keineswegs "veraltet" ist, wird der sorgsame Leser von heute immer wieder feststellen: in exakter Exegese wird ans Licht gebracht, - was in der Synagoge vor Jesus unter "Glaube" verstanden wurde, - was Jesus selbst (nach den verschiedenen Evangelien) meinte, wenn er vom "Glauben" sprach, und schließlich, - was "Glaube" für Paulus und die junge Christenheit bedeutete. So stellt diese Studienausgabe nicht nur einen Beitrag zur Theologiegeschichte dar, sie ist angesichts der neueren Diskussion um das Phänomen des Glaubens im Neuen Testament von erstaunlicher Aktualität. Inhaltsverzeichnis / Sachregister Leseprobe |
 |
Adolf Schlatter Das Evangelium des Lukas Aus seinen Quellen erklärt Calwer Verlag, 1975, 724 Seiten, Leinen, 3-7668-0456-1 978-3-7668-0456-3 |
Das Lukasevangelium
stellt unmittelbar die Frage nach seinen Quelle ; darum gibt A.
Schlatter eine Erklärung des Evangeliums »aus den Quellen« und bespricht
nacheinander in durchgehendem Zusammenhang 1. die neugefaßten Stücke aus
Markus, 2. das Evangelium des »neuen Erzählers «, jene Quellenschrift,
die dem Lukasevangelium in besonderer Weise seine Eigenart gibt, 3. die
aus Matthäus aufgenommenen Stücke. Schlatter geht auch in diesem Werk eigene Wege; er tut es mit der ihm eigenen Bescheidung, die um die Grenze der Forschung weiß, und zugleich mit größter Sorgfalt in der Beobachtung und Erwägung des, Textes nach seiner Sprache und nach seinem Gehalt. Wie hier die Quellen miteinander verglichen sind und die Eigenart des »neuen Erzählers« eindrucks voll herausgearbeitet ist, das erschließt eine Fülle biblischer Erkenntnisse und vermittelt einen reichen Einblick in die Fragen, die die erste Christenheit bewegten und in die Aufgaben, die ihr gestellt waren. Inhaltsverzeichnis Leseprobe |
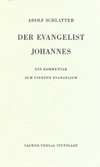 |
Adolf Schlatter Der Evangelist Johannes Calwer Verlag, 1975, 410 Seiten, Leinen, Schutzumschlag 3-7668-0195-3 978-3-7668-0195-1 |
Wie erspricht, denkt und glaubt. Ein Kommentar zum
vierten Evangelium. Dieses Werk, eine willkommene Ergänzung zu dem gleichartigen Matthäuskommentar, zeigt in dem vierten Evangelisten einen Palästiner, der in seiner Sprache und Denkweise das palästinische Erbe unverfälscht bewahrte, den Jünger Jesu, der, aller Gnosis fern, vielmehr in engster Verhindung mit palästinischer Frömmigkeit - das Wort und Werk Jesu in der Tiefe erfaßte und darstellte, und den Apostel, der zur Kirche auch in den Briefen und in der Offenharung Johannis spricht. Leseprobe zur Seite Evangelisten |
 |
Adolf Schlatter Die Kirche der Griechen im Urteil des Paulus Calwer Verlag, 1983, 284 Seiten, Leinen,Schutzumschlag 3-7668-0199-6 978-3-7668-0199-9 |
Eine Auslegung seiner Briefe an
Timotheus und
Titus Ist es Paulus selbst, der in den sogenannten Pastoralbriefen zu seinen Gefährten Timotheus und Titus über die Kirche der zweiten Generation spricht, in der Griechen und hellenisierte Juden zusammengeschlossen sind, ohne daß noch ein innerer Gegensatz zwischen beiden zu erkennen wäre? Schlatter bejaht diese weithin verneinte Frage. Er begründet sein Urteil durch eine eingehende Untersuchung der Sprache in ihren oft bezeichnenden Ähnlichkeiten mit den früheren Briefen des Paulus wie in ihrer Verwendung neuer Begriffe, die durch die neuen Zustände und Bestrebungen in der Kirche ver anlaßt waren. Den Vergleich zwischen der ursprünglichen Botschaft des Paulus und dem Zeugnis unserer Briefe vollzieht Schlatter vor allem unter den großen Gesichtspunkten: Wie verhalten sich in beiden Glaube und Erkenntnis zueinander - Glaube, Liebe und Werk - Gesetz, Evangelium und Lehre - Geist, Gemeinschaft und Freiheit? Wie gestaltet sich die Hoffnung - und wie das Verhältnis der Kirche zum Staat? Welche Beurteilung finden die natürlichen Ordnungen und welche Benützung die natürlichen Güter? Damit führt die Weise, wie Schlatter die paulinische Herkunft der Briefe begründet, nicht nur hinein in die neue Lage und die damit gegebenen Aufgaben und Versuchungen, in denen »die Kirche der Griechen« sich zu bewähren hat, sondern auch in den bei aller Wandlungsfähigkeit der Ausdrucksweise grundlegenden Inhalt der paulinischen Verkündigung. |
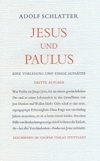 |
Adolf Schlatter Jesus und Paulus Calwer Verlag, 1961, 144 Seiten, Leinen, 3-7668-0205-4 978-3-7668-0205-7 |
Eine Vorlesung und einige Aufsätze War Paulus ein Jünger Jesu, der an seinem geschichtlichen Ort und in seiner Lebensarbeit in den Grundlinien von Jesu Denken und Wollen blieb? Oder schuf er eine neue, eigengeprägte Frömmigkeit? Diese Frage war vor fünfzig Jahren umstritten, sie ist es heute erneut wieder. Aus einer Fülle von Beobachtungen zeigt Adolf Schlatter die Einheit, die - bei aller Verschiedenheit - Paulus mit Jesus verbindet. Inhaltsverzeichnis Leseprobe |