| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
|
Orientalische Religionen in der Antike (ORA) |
|
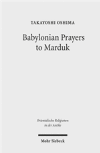 |
Die Reihe möchte dem Rechnung tragen, dass
die interdisziplinäre Zusammenarbeit wie auch die Einzelforschung
der Bereiche Altes Testament/Palästinawissenschaft, Assyriologie und
Ägyptologie in den letzten Jahrzehnten einen großen Aufschwung
erfahren haben. Sie hat zum Ziel, den religionsgeschichtlichen
Fragestellungen der genannten Bereiche ein eigenes Forum
verschaffen. Es geht dabei sowohl darum, die Verbreitung bereits
anerkannter Ergebnisse zu fördern als auch innovativen Entwicklungen
und Forschungsansätzen Raum zu geben. ORA möchte spezialisierte
Einzelstudien, wie auch breiter angelegte Aufsatz- und Kongressbände
zu einzelnen religionsgeschichtlichen Themen an die
wissenschaftliche und interessierte Öffentlichkeit bringen Reihenverzeichnis Februar 2018 Angelika Berlejung ist Professorin für Alttestamentliche Wissenschaft an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig. Joachim Quack ist Professor für Ägyptologie an der Universität Heidelberg. Annette Zgoll ist Professorin für Altorientalistik an der Universität Göttingen. |
 |
Zsuzsanna Végh Feste der Ewigkeit Untersuchungen zu den abydenischen Kulten während des Alten und Mittleren Reiches Mohr Siebeck, 2021, 480 Seiten, Leinen, 978-3-16-159638-4 179,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 43 Die jährlich gefeierten Feste zu Ehren des Gottes Osiris, des Herrschers des Totenreiches, in der Stadt Abydos, Begräbnisort der frühesten Könige Ägyptens, zählten zu den wichtigsten religiösen Feierlichkeiten im alten Ägypten. Menschen aus dem ganzen Land reisten dorthin, um an den Feiern teilzunehmen und durch die Aufstellung einer Stele ihre ewige Festteilnahme zu sichern. In ihrer Studie bietet Zsuzsanna Végh eine systematische Untersuchung der Inschriften dieser Stelen und schafft dadurch eine umfassende Studie über Ursprung, Entwicklung und Gestaltung der Osirisfeste vom Alten (ca. 2686–2160 v. Chr.) bis ins Mittlere Reich (2055–1650 v. Chr.). Die Rekonstruktion, wie landesweit verbreitete religiöse Konzepte in die lokalen Kulte integriert wurden und dann die neu geschaffenen Vorstellungen überregional übernommen wurden, bietet ein faszinierendes Fallbeispiel für die Entstehung und Tradierung religiösen Wissens im Alten Ägypten. |
 |
Judith E. Filitz Gott unterwegs Die traditions- und religionsgeschichtlichen Hintergründe des Habakukliedes Mohr Siebeck, 2020, 560 Seiten, Leinen, 978-3-16-159265-2 169,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 36 Die Aufdeckung der traditions- und religionsgeschichtlichen Hintergründe des Habakukliedes eröffnet den Blick auf eine innovative Theologie, die es ermöglichte, auch in der Exilszeit an der Gegenwart Gottes festzuhalten. Judith E. Filitz stellt in diesem Werk die Frage nach dem literarischen Wachstum von Habakuklied und -buch. Eine umfangreiche Analyse offenbart 3,*3–12 als ältesten Kern, den vier spätere Redaktionen bearbeitet haben. Sie legt die Motive ausführlich dar und erklärt sie aus den alttestamentlichen, syrischen und mesopotamischen Kontexten, wobei Hab 3* sich als ein poetischer Theophanietext zu erkennen gibt. Zugleich verweisen einige Motive des Liedes auf die neubabylonische akitu-Prozession, die detailreich beschrieben wird. Hab 3* erscheint so als ein Mischgebilde aus Theophanietext und Prozessionserfahrung. Dies hat eine facettenreiche Theologie der praesentia dei zur Folge, welche die Möglichkeit einer Gottesbegegnung in spätexilisch-frühnachexilische Zeit entwirft. |
 |
Joachim F. Quack Altägyptische Amulette und ihre Handhabung Mohr Siebeck, 2020, 490 Seiten, Broschur, 978-3-16-156385-0 159,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 31 Obgleich es aus dem alten Ägypten sowohl zahlreiche erhaltene Amulette als auch Texte mit Hinweisen für ihre Anwendung gibt, fehlt bislang eine angemessene übergreifende Untersuchung dazu. Joachim Friedrich Quack bietet eine detaillierte Behandlung dieser Artefakte und (Meta)texte von der Vorgeschichte (4. Jtsd. v. Chr.) bis in die römische Kaiserzeit (ca. 3.-4. Jhd. n. Chr.). Die Darstellung erfolgt einerseits chronologisch, andererseits thematisch, indem zusammengehörige Sachgruppen übergreifend vorgestellt werden. Bei der Behandlung der Amulette wird ein besonderes Gewicht auf archäologisch gut dokumentierte Gräberfelder gelegt, um chronologische Entwicklungen besser zu fassen. Dadurch kann z.B. eine sehr diesseitsorientierte Amulettausstattung der Dritten Zwischenzeit klar von einer am Vorbild des Osiris orientierten, spezifisch funerären ab der 26. Dynastie differenziert werden. |
 |
Erhard S. Gerstenberger Theologie des Lobens in sumerischen Hymnen Zur Ideengeschichte der Eulogie Mohr Siebeck, 2018, 350 Seiten, Leinen, 978-3-16-155658-6 139,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 28 Die sumerische Literatur des 3. und 2. Jahrtausends v.u.Z. bietet auch zahlreiche hymnische Texte, die überwiegend der kultischen Tradition entstammen. Sie feiern Macht, Ansehen und Fürsorge von Gottheiten, Königen, Tempeln, usw. Erhard S. Gerstenberger analysiert, ausgehend von dem formelhaften, archaischen Heilsruf: »[Name] sei Preis!« = »[dGN] zà-mí« (vergleichbar dem biblischen »Halleluja«), die mannigfachen Aussagen des Lobpreisens (zà-mí). Er zeigt, dass es im sumerischen Lob nicht nur um die untertänige, pflichtgemäße Anerkennung von Übermächten geht, sondern um eine effektive Kraftübertragung von Seiten der Lobenden auf die Rezipienten der Huldigung. Stärkendes oder Existenz begründendes Lob kann also nicht nur von Machtträgern ausgehen. Auch das Geschöpf Mensch nimmt am Welt gestaltenden, erhaltenden, heilsamen Preisen teil, vor allem durch Bitten und Loben. Es übernimmt damit seine Verantwortung inmitten der geheimnisvollen Interaktionen aller kosmischen Wirkkräfte personhafter sowie unpersönlicher Art. |
 |
Angelika Berlejung The Physicality of the Other Masks from the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean Mohr Siebeck, 2018, 570 Seiten, Leinen, 978-3-16-155513-8 174,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 27 Published in English. This volume comprises the conference proceedings of the international and interdisciplinary meeting held in Leipzig from November 9 to 11, 2015. Scholars from different research areas present masks from Egypt, Israel/Palestine, Syria, Mesopotamia, Phoenicia, Cyprus, and Greece, mainly from the third to the first millennium BCE. The masks are analyzed from archaeological, iconographical, anthropological, philological, and theological perspectives. In many cases, the masks refer to gods, ancestors, spirits, and are used as a means to communicate between human beings and supernatural powers. Masks belong to the human condition and seem to be the international and intercultural answer to one of the most existential questions of human life. In addition, the volume includes an archaeological catalogue of the masks from Israel/Palestine of the Neolithic Age until the Persian Period. Content pdf - Flyer |
 |
Izaak J. de Hulster Figurines in Achaemenid Period Yehud Jerusalem's History of Religion and Coroplastics in the Monotheism Debate Mohr Siebeck, 2017, 225 Seiten, Cloth, 978-3-16-155550-3 114,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 26 Published in English. Were there figurines in Yehud during the Achaemenid period, and in particular in Jerusalem? A positive answer to this question disproves the general consensus about the absence of figurines in Yehud, which is built on the assumption that the figurines excavated in Judah/Yehud are chronologically indicative for Iron Age II in this area (aside from a few typological exceptions). Ephraim Stern and others have taken this alleged absence of figurines as indicative of Jewish monotheism’s rise. Izaak J. de Hulster refutes this ‘no figurines ? monotheism’ paradigm by detailed study of the figurines from Yigal Shiloh’s excavation in the ‘City of David’ (especially their contexts in Stratum 9), providing ample evidence for the presence of figurines in post-587/586 Jerusalem. The author further reflects on the paradigm’s premises in archaeology, history, the history of religion, theology, and biblical studies, and particularly in coroplastics (figurine studies). |
 |
Reettakaisa Sofia Salo Die judäische Königsideologie im Kontext der Nachbarkulturen Untersuchungen zu den Königspsalmen 2, 18, 20, 21, 45 und 72 Mohr Siebeck, 2017, 400 Seiten, Leinen, 978-3-16-155338-7 149,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 25 Die judäische Königsideologie ist tief verwurzelt in der altorientalischen Kulturkoine und teilt ihre Hauptgedanken mit den benachbarten Königreichen. Weil der König in einem besonderen Verhältnis zur göttlichen Welt steht, kann er für seine Untertanen sorgen: Er zieht in den Kampf mit göttlicher Ausrüstung, kämpft für Recht und Gerechtigkeit und trägt verschiedene Insignien als Zeichen seiner Macht. Der König wird als Kultakteur, Segensmittler und Gottessohn dargestellt. Reettakaisa Sofia Salo untersucht die alttestamentlichen Königspsalmen Ps 2; Ps 18; Ps 20; Ps 21; Ps 45und Ps 72 in religionsgeschichtlicher Perspektive. Im Licht der Nachbarkulturen erweist sich die vorexilische Königsideologie als integraler Bestandteil des Alten Orients. Die redaktionsgeschichtliche Analyse zeigt, dass die alttestamentlichen Spezifika dieser Psalmen sich erst in der königslosen Zeit ausgebildet haben. Reettakaisa Sofia Salo Geboren 1984; 2003–08 Studium der Ev. Theologie; 2007 Bachelor of Theology; 2008 Master of Theology; 2011 Ordination; 2013 Master of Arts (Antike Kulturen des östlichen Mittelmeerraums, Schwerpunkt Altorientalistik); seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Alttestamentlichen Seminar der Evangelisch-Theologischen Fakultät an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster; 2017 Promotion. |
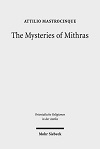 |
Attilio Mastrocinque The Mysteries of Mithras A Different Account Mohr Siebeck, 2017, 380 Seiten, Leinen, 978-3-16-155112-3 100,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA) Veröffentlicht auf Englisch. Attilio Mastrocinque warnt in dieser Arbeit vor einer Annäherung an den Mithraismus basierend auf der Vorstellung, dass dieser mystische Kult dem Christentum ähnelt. Obwohl sowohl christliche als auch heidnische Autoren bezeugten, dass es mithrische Elemente übernommen hat, taten dies laut Attilio Mastrocinque nur einige gnostische Christen. Er wendet ein, dass die Ideologie und die Religion der Römischen Reichs bessere Hinweise darauf geben, wie man diese Frage angehen sollte, und behauptet auch, dass Virgil sich als wichtiger für das Verständnis der mithrischen Ikonographie herausstellt, als das Avesta. Die Bedeutung der zentralen Szene – der Tauroktonie – wird deutlich, wenn sie, als der zentrale Akt des römischen Triumphs, der des Bullenopfers, betrachtet wird, mit Mithras, dem Urheber dieses Erfolgs, in der Rolle des Siegers. Die Geschehnisse, die auf vielen Reliefs abgebildet werden, beziehen sich auf eine Prophezeiung, die Firmicus Maternus und anderen christlichen Polemikern bekannt war, und welche die Ankunft eines Erlösers, d.h. des ersten Kaisers, vorhersagt, wenn Saturn zurückkehrt und Apollo-Mithras regiert. |
 |
Joachim F. Quack Schrift und Material Praktische Verwendung religiöser Text- und Bildträger als Artefakte im Alten Ägypten Mohr Siebeck, 2017, 350 Seiten, Leinen, 978-3-16-155129-1 120,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA) Texte und Bilder existieren nicht losgelöst von ihrem Trägerobjekt: Es ermöglicht ihre Verbreitung und Verwendung. Aber die Eigenschaften des Trägers waren auf den Gebrauch abgestimmt, ebenso die Auswahl der Inhalte von Texten und Bildern. Dieses Zusammenspiel gegenseitiger Abhängigkeiten wird in diesem Band für Quellen aus dem Alten Ägypten theoretisch und anhand konkreter Beispiele betrachtet, was neue Zugänge zu zwei alten Fragen bietet: Ihre Konsequenzen für Möglichkeiten und Grenzen archäologischer Rekonstruktion der vergangenen Kontexte führen die methodische Eigenreflektion im Fach Ägyptologie voran. Daneben werden Chancen aufgedeckt, einstige komplexe Handlungszusammenhänge zu beschreiben. Schnell drängt sich die Relativität der Ansprache von Objekten in verschiedenen Kontexten und ein Bedeutungspluralismus auf, der konsequenterweise wieder hin zu mehr Individualismus des Einzelobjektes führt. |
 |
Christoph Levin / Reinhard
Müller Herrschaftslegitimation in vorderorientalischen Reichen der Eisenzeit Mohr Siebeck, 2016, 300 Seiten, Leinen, 978-3-16-154858-1 110,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA) Der Sammelband behandelt Formen und Strategien von Herrschaftslegitimation, die in eisenzeitlichen Königtümern der Levante sowie in Mesopotamien und Ägypten ausgeprägt wurden. Anhand von ikonographischen, textlichen und archäologischen Zeugnissen werden die Grundmuster herausgearbeitet, mit denen in diesen Reichen königliche Herrschaft legitimiert wurde. Besondere Aufmerksamkeit gilt den kulturellen Wechselwirkungen, die zwischen den Regionen bestanden, sowie den Eigenheiten der einzelnen Königtümer. Schwerpunkte liegen auf Babylon und Assur, den phönizischen Königtümern, Kinalua/Tell Tayinat, den Inschriften von Bukan, Tell Fekheriye und Sfire, den Bildwerken von Balu'a, Yarih-‘ezer und Askalon, den Königtümern Israel, Juda und Moab, ägyptischen Einflüssen auf die levantinischen Reiche sowie der Königsmotivik im Hohenlied. Inhaltsübersicht Joachim Friedrich Quack: Ägyptische Einflüsse auf nordwestsemitische Königspräsentationen? – Claus Ambos: Rituale der Herrschaftslegitimation babylonischer und assyrischer Könige – Karen Radner: Assur's »Second Temple Period«. The restoration of the cult of Aššur, c. 538 BC – Paolo Xella: Self-depiction and Legitimation: Aspects of Phoenician Royal Ideology– William Morrow: Famine as the Curse of Kings: Royal Ideology in Old Aramaic Futility Curse Series – Bob Becking: A Voice from Across the Jordan: Royal Ideology as Implied in the Moabite Stela – Angelika Berlejung: Dimensionen der Herrschaftslegitimität: Ikonographische Aspekte königlicher Selbstdarstellung in den Kulturen der südlichen Levante der Eisenzeit anhand der Bildwerke von Balu‘a, Yarih-‘ezer und Askalon – Reinhard Müller: Herrschaftslegitimation im israelitisch-judäischen Königtum. Eine Spurensuche im Alten Testament – Christoph Levin: Das Königsritual in Israel und Juda – Udo Rüterswörden: Das Königtum im Hohenlied – Timothy Harrison: Royal self-depiction and legitimation of authority in the Levantine monarchies of the Iron Age in light of newly excavated royal sculptures at Tell Tayinat |
 |
Jan Dietrich Der Tod von eigener Hand Studien zum Suizid im Alten Testament, Alten Ägypten und Alten Orient Mohr Siebeck, 2016, 360 Seiten, Leinen 978-3-16-154055-4 149,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA) Viele Fragen zur Selbsttötung und zum gesellschaftlichen Umgang mit Selbsttötung werden aktuell in der Öffentlichkeit und auf verschiedenen Forschungsfeldern diskutiert. Eine umfassende Behandlung des Themas mit Blick auf das Alte Testament und die Kulturen des Alten Orients, einschließlich des Alten Ägypten, stand bislang jedoch aus. Mit dem vorliegenden Band schließt Jan Dietrich diese Forschungslücke. Er grenzt Suizid und Suizidgedanken vom allgemeinen Sterbens- und Todeswunsch ab und wählt einen kulturgeschichtlichen und soziologischen Zugriff auf die Quellen. Die Selbsttötung wird dabei aus der Perspektive des Suizidanten und aus der Perspektive der Kulturen des Altertums verständlich gemacht und es wird gezeigt, dass sie fernab von dem Stigma Krankheit oder Sünde ihren Platz in der Wiege unserer Kultur hatte. Entsprechend wird die Selbsttötung als »Sinngeschichte«, als ein mit Sinn besetzter Versuch zur Lösung eines lebensrelevanten Problems begriffen. Der Autor unterscheidet zwischen eskapistischen Formen des Suizids in unterschiedlichen Kontexten sowie zwischen aggressiven und oblativen Formen und macht die Selbsttötung besonders vor dem Hintergrund vorherrschender Ehr- und Schamvorstellungen verständlich. Jan Dietrich 1996–2003 Studium der Ev. Theologie, Geschichte, Philosophie und Pädagogik in Tübingen und Cambridge, weiterhin Studien der akkadischen, ugaritischen und altägyptischen Sprachen; 2004–09 wissenschaftlicher Mitarbeiter am alttestamentlichen Institut der Universität Leipzig; 2009 Promotion; seit 2012 Associate Professor für Altes Testament an der Universität Aarhus, Dänemark. |
 |
Daniela Luft Osiris-Hymnen Wechselnde Materialisierungen und Kontexte. Untersuchungen anhand der Texte »C 30« / Tb 181, Tb 183, »BM 447« / Tb 128 und der »Athribis«-Hymne Mohr Siebeck, 2016, 1060 Seiten, Leinen 978-3-16-153574-1 15900 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA) Osiris – ein Gott der Toten und ein toter Gott; von den Alten Ägyptern wurde er in zahlreichen Hymnen gepriesen und beschrieben. Diese Hymnen waren jedoch immer Gebrauchstexte, erschaffen mit der Absicht der Verwendung, erhalten aufgrund intentioneller Niederschrift. In dieser Studie spürt Daniela C. Luft die ehemaligen Verwendungsarten und Kontexte von vier Hymnenfamilien auf und zeichnet deren wechselvolle Geschichte in Form von Textbiographien nach. Dabei zeigt sie, wie Inhalte der Texte und deren Anbringung auf verschiedenen Materialien abhängig sind von den vorgesehenen Verwendungen und Funktionen. In Texteditionen und Synopsen werden die Hymnen mit ihren Varianten präsentiert. Der Nachweis, wie diese Hymnen zudem aus bereits bestehendem Textmaterial neu erschaffen wurden, macht sie zu faszinierenden Fallbeispielen für die Mechanismen religiöser Textproduktion der Alten Ägypter. Daniela C. Luft Geboren 1982; Studium der Ägyptologie, Assyriologie und Ur- und Frühgeschichte; 2007 Magistra Artium; 2008–11 Stipendiatin der Landesgraduiertenförderung Baden-Württemberg und der Graduiertenakademie Heidelberg; 2011 Promotion in Ägyptologie; seit 2011 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am SFB 933 »Materiale Textkulturen« in Heidelberg. |
 |
Reinhard Hillmann Brautpreis und Mitgift Gedanken zum Eherecht in Ugarit und seiner Umwelt mit einer Rekonstruktion des im Ritual verankerten »Schlangentext«-Mythos Mohr Siebeck, 2016, 140 Seiten, Leinen, 978-3-16-153561-1 70,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA) Ausgehend von den eherechtlichen Klauseln in altbabylonischen und mittelassyrischen Rechtstexten und einem Blick auf die Alalah-Texte, Texte aus der Euphratschleife (Emar) und die Amarnabriefe untersucht Reinhard Hillmann das Eherecht in Ugarit, wobei er auch im Alten Testament der Eisenzeit eine eherechtliche Verbindung mit der vorhergehenden babylonisch-mittelassyrischen Tradition nachzuweisen sucht. Genesis 34:11b-12 erfährt eine neue Behandlung. Der Autor entkräftet die Meinung, dass in Ugarit der Brautpreis vom Vater der Braut an die Familie des Ehemanns zurückgegeben wird. Daneben ergeben sich durch seine Analyse verschiedene Aspekte ugaritischer Ehebräuche, wobei der Nikkal-Text (CAT 1.24) sowie CAT 1.100 im Mittelpunkt stehen. Hillmann deutet CAT 1.100 als Libretto zu einem mythologischen Spiel bei akuter Schlangengefahr, die durch die Vermählung von Horon mit der Beschützerin des Weideviehs beseitigt wird. Reinhard Hillmann Geboren 1932; Studium der Theologie und Orientalistik; 1965 Promotion; ab 1959 Gemeindepfarrer; ab 1979 Schulpfarrer und Mitarbeiter am Ugarit-Institut Heidelberg; emeritiert. |
 |
Manuel Ceccarelli Enki und Ninmah Eine mythische Erzählung in sumerischer Sprache Mohr Siebeck, 2016, 240 Seiten, Leinen, 978-3-16-154278-7 85,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA) Enki und Ninma? ist die moderne Bezeichnung einer mythischen Erzählung in sumerischer Sprache, deren Hauptakteure Enki, der Gott der Kunstfertigkeit und der Weisheit, und Ninma?, die Muttergöttin, sind. Der Text schildert zuerst die Erschaffung des Menschen als Ersatzarbeiter für die Götter und berichtet dann von einem Wettstreit zwischen Enki und Ninma? um die Fähigkeit, das Schicksal der Menschen zu bestimmen. Ninma? erschafft sieben kranke Wesen, Enki ist jedoch in der Lage, ihnen eine passende Arbeit zuzuweisen. Damit erklärt der Text die Existenz von kranken Menschen und bestätigt Enkis Überlegenheit. Manuel Ceccarelli liefert eine neue kritische Textausgabe von Enki und Ninma?. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der philologischen Analyse und der religionsgeschichtlichen Deutung. Besondere Aufmerksamkeit wird auch den humoristischen und satirischen Aspekten des Wettstreites gewidmet. Manuel Ceccarelli Geboren 1975; Studium der Altorientalischen Philologie, der Vorderasiatischen Archäologie und der Religionswissenschaft; Promotion im Fach Altorientalische Philologie; seit 2014 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt »Streitliteratur im Alten Orient: Ein Editionsprojekt« an den Universitäten Bern und Genf. |
 |
Christoffer Theis Magie und Raum Der magische Schutz ausgewählter Räume im Alten Ägypten nebst einem Vergleich zu angrenzenden Kulturbereichen Mohr Siebeck, 2014, 1032 Seiten, Leinen 978-3-16-153556-7 139,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 13 War das Individuum im alten Ägypten Dämonen, Krankheiten oder anderen Bedrohungen schutzlos ausgeliefert oder konnte sich der Mensch verschiedener Praktiken bedienen, um diese fernzuhalten? Christoffer Theis untersucht schriftliche und archäologische Hinterlassenschaften, die den magischen Schutz verschiedener Räume im alten Ägypten nachweisen. Er legt eine ausführliche Analyse und einen Kommentar der vorliegenden Zeugnisse für den Schutz des Landes Ägypten, der Stadt, des Tempels, des Hauses, des Schlafgemachs wie des Grabes vor und geht auf Hinterlassenschaften aus anderen kontemporären Kulturbereichen wie Mesopotamien, Altanatolien und dem Raum Syrien-Palästina ein. Außerdem vergleicht er diese in einem weiteren Schritt mit griechischem, koptischem, arabischem und hebräischem Material. Die derzeit vorhandenen Quellen bezeugen deutlich inter- sowie transkulturelle Homogenitäten und Identifikationsmerkmale durch die lokalen und temporalen Räume. Christoffer Theis Geboren 1984; Studium der Ägyptologie und der Altorientalistik; 2008 MA; 2013 Promotion; Zweitstudium der Theologie; 2013 Master of Arts; seit 2010 Lehrbeauftragter und seit 2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. |
 |
Gösta Gabriel enuma elis – Weg zu einer globalen Weltordnung Pragmatik, Struktur und Semantik des babylonischen »Lieds auf Marduk« Mohr Siebeck, 2014, 524 Seiten, Leinen, 978-3-16-152872-9 129,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 12 Das Lied auf Marduk ( enuma eliš) ist der vermutlich bedeutsamste mythische Text der babylonischen Kultur und berichtet vom Aufstieg des Gottes Marduk zum absoluten Herrscher über alle Götter und die Welt. Gösta Gabriel liefert die erste umfassende Gesamtinterpretation des Textes, wobei er ihn aus sich selbst heraus analysiert. Dabei wird zwischen der außertextlichen Wirkdimension (Pragmatik) und seiner inneren Verfasstheit (Struktur) und Bedeutung (Semantik) unterschieden. Zentral für das Verständnis des Werkes ist zudem die Festsprechung ( šimtu) und die Namensgebung, die mit Blick auf ihre textinterne Funktion beleuchtet werden. Abschließend führt die Untersuchung die verschiedenen Betrachtungsstränge zusammen, wodurch sich der Text in seiner Außen- und Binnenwirkung als Weg und Schlüssel zu einer ewigen friedlichen Weltordnung offenbart, die durch und in Marduk begründet ist – die Pax Mardukiana . Gösta Gabriel Geboren 1979; Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre, Philosophie, Alten Geschichte, Altorientalistik und Design Thinking in Malente, Chelmsford, Leipzig und Potsdam; 2013 Promotion im Fach Altorientalistik; seit August 2013 Postdoktorand an der Graduiertenschule für Geisteswissenschaften Göttingen. |
 |
Heinz-Günther Nesselrath Gut und Böse in Mensch und Welt Philosophische und religiöse Konzeptionen vom Alten Orient bis zum frühen Islam Mohr Siebeck, 2013, 237 Seiten, Leinen, 978-3-16-152574-2 104,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 10 Die Frage nach Herkunft und Wirklichkeit des Guten und des Bösen sowie nach ihrem Verhältnis zueinander hat in der Philosophie- und Religionsgeschichte von Anfang an eine zentrale Rolle gespielt. Ihre Beantwortung hatte entscheidenden Einfluss darauf, wie man Welt und Kultur, Mensch und Ethik in der Beziehung zu Gott bzw. den Göttern wahrnahm. Die Beiträge des Konferenzbandes stellen dar, welche Auffassungen hierzu in Altertum und Antike entwickelt wurden. Dabei reicht der Bogen von den frühen Literaturen aus Ägypten und Mesopotamien, Iran und Griechenland über biblische, qumranische und antik-christliche Texte bis zu dem Werk Manis und dem Koran. So vermittelt der Band einen repräsentativen Eindruck von den Antworten der alten Welt auf eine Lebensfrage der Menschheit. Inhaltsübersicht Heinz-Günther Nesselrath / Florian Wilk : Einleitung – Bernd Schipper : 'Gut und Böse' im Alten Ägypten – Catherine Mittermayer : Gut und Böse – Anforderungen an menschliches Handeln im Beziehungsgefüge zwischen Göttern und Menschen in den mesopotamischen Mythen – Philip Kreyenbroek : Good and Evil in Zoroastrianism – Wilhelm Blümer : Gutes und Böses aus Götterhand? Zum Verhältnis von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung des Menschen in der frühgriechischen Dichtung – Konrad Schmid : Genealogien der Moral – Prozesse fortschreitender ethischer Qualifizierung von Mensch und Welt im Alten Testament – Devorah Dimant : The Demonic Realm in Qumran Sectarian Literature – Jan Dochhorn : Das Böse und Gott im Römerbrief – eine Skizze – Ulrich Volp : Der Schöpfergott und die Ambivalenzen seiner Welt – Das Bild vom Schöpfergott als ethisches Leitbild im frühen Christentum in seiner Auseinandersetzung mit der philosophischen Kritik – Markus Stein : Der Dualismus bei den Manichäern und der freie Wille – Therese Fuhrer : Kann der Mensch ohne Fehler sein? Augustin über die 'Sünde' – Angelika Neuwirth : Die Entdeckung des Bösen im Koran – Überlegungen zu den koranischen Versionen des Dekalogs – Martin Tamcke : 'Das reine Leben des Glaubens will ich nach deinem Vorbild erwerben' – Der Kampf um das Gute und wider das Böse nach einer ostsyrischen Heiligenlegende |
 |
Angelika Berlejung Menschenbilder und Körperkonzepte im Alten Israel, in Ägypten und im Alten Orient Philosophische und religiöse Konzeptionen vom Alten Orient bis zum frühen Islam Mohr Siebeck, 2012, 695 Seiten, Leinen, 978-3-16-151828-7 119,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 9 Hrsg. v. Angelika Berlejung, Jan Dietrich u. Joachim F. Quack Menschenbilder und Körperkonzepte gehören eng zusammen und bestimmen maßgeblich anthropologische Lehren und Fragestellungen. Sie sind zudem eng mit der Sozialstruktur des jeweiligen Kulturraums verflochten, wobei dieselbe zwar ununterbrochen konditionierenden Einfluss auf menschliche Handlungen und Haltungen hat, sie aber zugleich auch das Ergebnis menschlicher Handlungen und Haltungen ist. Auf diesen Grundlagen haben sich Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen zusammengefunden, um aus der Perspektive ihres jeweiligen methodischen Ansatzes dem Thema in ihrem jeweiligen Kulturbereich (Altes Testament/Palästina, Ägypten und Alter Orient) nachzugehen. Dabei werden Textquellen ebenso in die Untersuchungen mit einbezogen wie Bildquellen. Gemeinsames Ziel ist, zeit- und kulturgebundene Spezialentwicklungen präzise zu profilieren und Grundfragen der conditio humana in den Blick zu nehmen. Inhaltsübersicht I. Theoretische und übergreifende Beiträge Anne Koch: Reasons for the Boom of Body Discourses in the Humanities and the Social Sciences since the 1980s. A Chapter in European History of Religion – Bruce J. Malina: The Idea of Man and Concepts of the »Body« in the Ancient Near East – John J. Pilch: The Idea of Man and Concepts of the Body. Anthropological Studies on the Ancient Cultures of Israel, Egypt, and the Near East – Jan Dietrich: Individualität im Alten Testament, Alten Ägypten und Alten Orient – Alexandra Grund: Homo donans. Kulturanthropologische und exegetische Erkundungen zur Gabe im alten Israel – Philip F. Esler: Ancient Mediterranean Monomachia in the Light of Cultural Anthropology. The Case of David and Goliath. II. Altes Testament Thomas Staubli: Wieviel ist ein Menschenleben wert? Biblisches und Ikonographisches zu Würde und Wert des Menschen – Christl M. Maier: Körper und Geschlecht im Alten Testament. Überlegungen zur Geschlechterdifferenz – Dorothea Erbele-Küster: Die Körperbestimmungen in Leviticus 11–15 – Bernhard Lang: Die Leviten. Ihre Anthropologie und die Folgen für Ahnenkult und Bilderverehrung im alten Israel – Silvia Schroer: Old Testament Resistance against Sport and the Cult of the Body – Jürgen Van Oorschot: Beredte Sprachlosigkeit im Ijobbuch. Körpererfahrung an den Grenzen von Weisheit und Wissen – Ute Neumann-Gorsolke: »Aber Abraham und Sarah waren alt, hochbetagt ...« (Gen 18:11). Altersdarstellungen und Funktionen von Altersaussagen im Alten Testament – Martin Leuenberger: Bestattungskultur und Vorstellungen postmortaler Existenz im Alten Israel – Annette Krüger: Salbungsrituale im Begräbniskontext. III. Alter Orient und Ägypten III.1. Alter Orient |
| Michael Blömer Iuppiter Dolichenus Vom Lokalkult zur Reichsreligion Mohr Siebeck, 2012, 300 Seiten, Leinen, 978-3-16-151797-6 99,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 8 Der Kult des Iuppiter Dolichenus, des lokalen Gottes der Kleinstadt Doliche in der heutigen Südosttürkei, verbreitete sich im 2. Jahrhundert n. Chr. mit großer Geschwindigkeit in weiten Teilen des Imperium Romanum. Die Debatte um orientalische Kulte im römischen Reich, aber auch die Ergebnisse der Ausgrabungen im Hauptheiligtum von Doliche haben Anlass geboten, verschiedene Facetten des Kultes erneut in den Blick zu nehmen. Aus historischer wie archäologischer Perspektive beleuchten die Beiträge ein breites Spektrum von Fragen, das von der Bedeutung Doliches für den Kult im Westen, den Wegen seiner Verbreitung, seinem Status im römischen Heer bis zur Rolle von Frauen im Kult reicht. Außerdem wird die differenzierte Auswertung der bekannten Dolichenus-Heiligtümer und die Darstellung der Funde aus der Donauregion sowie eine ausführliche Vorlage des neu entdeckten Dolichenus-Heiligtums von Vindolanda thematisiert. |
|
| Takayoshi Oshima Babylonian Prayers to Marduk Mohr Siebeck, 2011, 560 Seiten, Leinen, 978-3-16-150831-8 119,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 7 Takayoshi Oshima präsentiert die erste umfassende Studie der akkadischen Gebete an den babylonischen Gott Marduk seit J. Hehns Essay “Hymnen und Gebete an Marduk” (1905). Der Autor untersucht die vielfältigen Aspekte der akkadischen Gebete zu verschiedenen Göttern und den Glauben an Marduk als den göttlichen Erlöser der Menschen. Das Buch enthält sowohl einen aktuellen Katalog aller babylonischen Gebete an Marduk als auch eine Textedition von 31 antiken Dichtungen. |
|
 |
Joachim F. Quack Ägyptische Rituale der griechisch-römischen Zeit Mohr Siebeck, 2011, 360 Seiten, Leinen, 978-3-16-150418-1 104,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA)
Band 6 Unter den Hinterlassenschaften der ägyptischen Kultur nehmen Zeugnisse für Rituale einen hervorragenden Platz ein. Sie können sowohl monumental auf den Wänden von Tempeln und Gräbern verewigt sein als auch auf Papyri und Ostraka als Referenzwerke zur konkreten Anwendung erscheinen. Gerade aus dem Ägypten der griechisch-römischen Zeit (ca. 330 v. Chr.-200 n. Chr.) gibt es eine Fülle erhaltener Rituale, die sich durch thematische Vielfalt (Tempelkult, private Nutzung für Lebende und Verstorbene) ebenso wie durch ein breites Spektrum der Sprachstufen und Schriftsysteme auszeichnen. Gleichzeitig herrschen in dieser Zeit dadurch spezielle Bedingungen, daß der König als offizieller oberster Ritualherr ein Fremder ist. Die Beiträge dieses Bandes widmen sich verschiedenen Aspekten dieser Thematik und werden durch eine Studie zu zeitgleichen Phänomenen in Mesopotamien abgerundet. |
| Peter Gemeinhardt Weltkonstruktionen Mohr Siebeck, 2010, 242 Seiten, Leinen, 978-3-16-150582-9 79,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA) Band 5: Religiöse Weltdeutung zwischen Chaos und Kosmos vom Alten Orient bis zum Islam Religion hat mit Gott und der Welt zu tun. Wie Religionen im Alten Orient, in der griechischen und ägyptischen Antike, im Alten und Neuen Testament, im spätantiken Christentum und im Islam die Welt deuten, wird in dem vorliegenden Band im interdisziplinären Gespräch erörtert. Grundlegende Kategorien der Welterklärung sind Chaos und Kosmos, Schöpfung und Weltende, himmlische und irdische Welt bzw. die Welt der Lebenden und die Unterwelt. In zehn Fallstudien fragen die Autoren nach der Topographie solcher Weltkonstruktionen, wobei sowohl die Unterschiede zwischen den Deutungsmustern der einzelnen Religionen als auch die Analogien zu Tage treten. Klar ist: Wer zwischen dem zweiten Jahrtausend vor und dem ersten Jahrtausend nach Christus nach der Welt und den in ihr waltenden Mächten fragt, fragt auch nach der Macht Gottes - und damit nach Ziel und Sinn der Welt. Mit Beiträgen von:Friederike Herklotz, Wayne Horowitz, Paul A. Kruger, Todd Lawson, Daniel Ogden, Henrik Pfeiffer, Maria E. Subtelny, Claus Wilcke, Oda Wischmeyer, Frances Young Hrsg. v. Peter Gemeinhardt u. Annette Zgoll |
|
| Jan Dietrich Kollektive Schuld und Haftung Mohr Siebeck, 2010, 462 Seiten, Leinen, 978-3-16-150353-5 99,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA) Band 4: Religions- und rechtsgeschichtliche Studien zum Sündenkuhritus des Deuteronomiums und zu verwandten Texten Die exegetische und kulturanthropologische Diskussion um Sündenbockriten nimmt von Lev 16 ihren Ausgangspunkt, obwohl der â??Sündenkuhritusâ?? von Dtn 21,1-9 ebenso Anspruch auf Auslegung im Rahmen dieser Diskussion verdient, enthält doch Dtn 21,1-9 alle Momente, die für einen klassischen Sündenbockritus wesentlich sind: die kollektive Schuldproblematik durch den Totschlag von unbekannter Hand, die ersatzweise Elimination und Tötung der jungen Kuh sowie nicht zuletzt die mehrfache Verwendung der Begriffe â??Blut(schuld)â?? und â??Sühneâ??. Deshalb unternimmt Jan Dietrich in der vorliegenden Studie eine religions- und rechtsgeschichtliche Untersuchung zu Dtn 21,1-9 und verwandten Quellen, die den Text sowohl im Licht der exegetischen und kulturanthropologischen Deutung von Sündenbockriten interpretiert als auch in den größeren Zusammenhang kollektiver Schuldproblematik stellt. |
|
| Franziska Naether Die Sorte Astrampsychi Problemlösungsstrategien durch Orakel im römischen Ägypten Mohr Siebeck, 2010, 550 Seiten, Leinen, 978-3-16-150250-7 110,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA) Band 3: "Du wirst deine Geliebte heiraten, aber es wird dir leid tun"; "Du wirst von deiner Frau erben, aber nicht als Alleinerbe". So spricht ein dem Pythagoras zugeschriebenes Orakel, das schon Alexander zur Weltherrschaft verholfen haben soll. Das Losbuch "Sortes Astrampsychi" ist auf römerzeitlichen Papyri und mittelalterlichen Handschriften in griechischer Sprache überliefert. Mit 92 vorformulierten Fragen und 1030 Antworten aus fast allen Lebensbereichen liegt eine ergiebige Quelle zur Sozialgeschichte Ägyptens vor - vom Überleben von Krankheiten über Geschäftsbeteiligungen hin zu Verhandlungstaktiken vor Gericht. Wichtige Fragestellungen dieses Kommentars zu den Sortes Astrampsychi zielen auf den Anwendungskontext und die Einordnung des Werks innerhalb der religiösen, divinatorischen und magischen Praktiken Ägyptens unter besonderer Berücksichtigung der "Ticket-Orakel" in demotischer, griechischer und koptischer Sprache. |
|
| Ernst-Joachim Waschke Reformen im Alten Orient und der Antike Mohr Siebeck, 2009, 250 Seiten, Leinen, 978-3-16-149869-5 70,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA) Band 2: Programme, Darstellungen und Deutungen In den Beiträgen dieses Bandes werden die in der Wissenschaft schlägigen, unter dem Begriff der Reform erfassten historischen Ereignisse und Prozesse einer kritisch Analyse unterzogen, indem sowohl der Begriff selbst problematisiet als auch die Hintergründe ausgewählter antiker Reformen, ihre Stilisierung und Wirkungsgeschichte dargestellt werden. Beginnend mit der Restauration Tutanchamuns als Gegenreaktion auf die Reform Echnatons werden Reformprozesse der griechisch-römschen Antike und Transformationsprozesse vorderorientalischer Gesellschaften am Beispiel von Uruk und Jehud in persischer Zeit untersucht. Die spezifisch alttestamentlichen Beiträge führen der Frage nach dem Deuteronomium als Reformprogramm zur Darstellung der Reformen Hiskias, Esras und Nehemias. Abschließend wird die Gestalt Esras als Reforrner in der klassischen Literatur des Judentums thematisiert. |
|
| Martin A. Stadler Weiser und Wesir Mohr Siebeck, 2009, 560 Seiten, Leinen, 978-3-16-149854-1 100,00 EUR |
Orientalische Religionen in der Antike (ORA) Band 1: Studien zu Vorkommen, Rolle und Wesen des Gottes Thot im ägyptischen Totenbuch In der Ägyptologie sind Göttermonographien ein wichtiges Genre, in dem wesentliche Erkenntnisse zu einzelnen Gottheiten zusammengefaßt werden. Doch sind Göttermonographien auch ein recht heikles Feld, da gerade für die bedeutenderen Gottheiten solche Studien in einem Katalog zu ersticken drohen, der die Quellen additiv nebeneinander stellt. Eingrenzungen sind daher nötig, die konventionell nach Epochen vorgenommen werden. Dies ist ein durchaus problematisches Vorgehen, da so Entwicklungslinien abgeschnitten werden. Ein prominenter altägyptischer Gott wie Thot, der gern vereinfachend als Schreiber- und Weisheitsgott charakterisiert wird, ist deshalb in jüngerer Zeit nicht mehr umfassend untersucht worden. Martin A. Stadler zeichnet ein differenzierteres Bild von Thots vielfältigerem Wesen und schlägt dazu einen neuen methodischen Weg ein. Gegenüber den konventionellen ägyptologischen Göttermonographien möchte er nicht nur eine der wichtigsten Gottheiten Ägyptens untersuchen, sondern auch mit einem totenbuchexegetischen Ansatz zahlreiche Sprüche eines zentralen ägyptischen religiösen Textcorpus als kohärente Kompositionen erklären, worauf in der Ägyptologie allzu häufig unter Verweis auf die andersgeartete Logik im ägyptischen religiösen Denken verzichtet worden ist. Die spezifische Stellung des Totenbuchs innerhalb des religiösen Schrifttums Ägyptens ermöglicht darüber hinaus, das Wesen Thots nicht nur auf einen Ausschnitt beschränkt, sondern über die gesamte altägyptische Religionsgeschichte hinweg zu untersuchen. |
|