| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Theologische Bibliothek Töpelmann | ||
 |
Dr. Knud Henrik Boysen Christus und sein dreifaches Amt. Multiperspektivische Annäherungen an eine zentrale Figur christologischen Denkens de Gruyter, 2019, 707 Seiten, Gebunden, 978-3-11-061112-0 144,95 EUR |
Theologische
Bibliothek Töpelmann Band 183 Die Arbeit unternimmt den Versuch, die klassische Lehre vom dreifachen Amt Christi multiperspektivisch zu untersuchen. Neben lehrgeschichtlichen Fallstudien (Calvin, Schleiermacher, Pannenberg, M. Welker) stehen interdisziplinäre Annäherungen aus Sicht der Exegese und der politischen Theorie. In dogmatischer Hinsicht ergibt sich die aktuelle Aussagekraft der Ämterlehre aus der Gegenwendigkeit einer offenbarungs- und erfahrungstheologischen Perspektive, die an M. Luther und K. Barth entfaltet wird. So zeigt sich: Die Ämterlehre ist Chiffre spezifisch christlicher Freiheitserfahrungen, die sich aus der unverfügbaren Anteilgabe an der Freiheit Jesu Christi verdankt. Die Ämterlehre ist damit keine überholte metaphysische Lehrform, sondern genuiner Ausdruck christlichen Selbstverständnisses. Dr. Knud Henrik Boysen Promovend Bogislaw-Stipendium der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald Promotionsthema: „Christus und sein dreifaches Amt. Multiperspektivische Annäherungen an eine zentrale Figur christologischen Denkens“ |
 |
Juliane Schüz Glaube in Karl Barths Kirchlicher Dogmatik Die anthropologische Gestalt des Glaubens zwischen Exzentrizität und Deutung De Gruyter, 2018, 426 Seiten, 747 g, Gebunden, 978-3-11-056759-5 119,95 EUR |
Theologische
Bibliothek Töpelmann Band 182 In dieser Studie wird zum ersten Mal eine systematische Analyse des menschlichen Glaubens in Karl Barths Kirchlicher Dogmatik vorgelegt. Barths Theologie wurde häufig vorgeworfen, dass sie diesen Topos marginalisiere. Demgegenüber weist Juliane Schüz die zentrale Rolle des Glaubens in Barths dogmatischer Methodologie sowie in dessen eigentümlicher Verschränkung von Christologie und Anthropologie nach. So wird im Querschnitt durch Barths Dogmatik ein vielseitiges Bild des Glaubensvollzugs gezeichnet. Einerseits birgt der Glaube als menschliche Tat die irreduzible Dimension von Geschichtlichkeit und Freiheit sowie die Möglichkeit seiner Verkehrung in der "Religion". Andererseits ist der Glaube ebenso göttliche Tat ‚extra nos‘ und nur ‚analogisch‘ als eine dem Menschen zukommende Partizipation in Christus zu verstehen. Die Studie zeigt unter Aufnahme der dialektischen Grundentscheidung Barths, wie Barth die ‚exzentrische‘ Konstitution und Bestimmung des Glaubens mit dessen aktiver, subjektiver Aneignung durch Deutungen vermittelt. In der Weiterführung der Barthschen Konzeption entwickelt Schüz eine jenseits der etablierten Alternativen stehende, neue Perspektive in der religionsphilosophischen Debatte um den Deutungsbegriff. Bllick ins Buch |
 |
Jeremias Gollnau Abwendung von der Gottesgemeinschaft de Gruyter, 2016, 355 Seiten, Gebunden, 978-3-11-049456-3 99,95 EUR |
Theologische
Bibliothek Töpelmann Band 177 Luthers Sündenbegriff in der Großen Genesisvorlesung (1535-1545) [siehe WA 43 und WA 44] Die Studie wählt den Zugang zu Luthers Hamartiologie über die wenig erschlossene Große Genesisvorlesung. Das so entwickelte und verschiedene Forschungspositionen integrierende Sündenverständnis leuchtet die Abwendung des Menschen im Kontext von Gottes trinitarisch verfasster Zuwendung aus. Der Blick auf Gottes sich in Schöpfung, Versöhnung und Vollendung worthaft verwirklichenden Gemeinschaftswillen erschließt die Sünde als Abkehr vom Wort. Inhaltsverzeichnis |
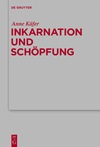 |
Anne Käfer Inkarnation und Schöpfung Schöpfungstheologische Voraussetzungen und Implikationen der Christologie bei Luther, Schleiermacher und Karl Barth de Gruyter, 2010, 400 Seiten, Gebunden, 978-3-11-022633-1 189,95 EUR |
Theologische
Bibliothek Töpelmann Band 151 In ihrem Buch „Inkarnation und Schöpfung“ untersucht Anne Käfer das Verhältnis von Gottes Menschwerdung und seiner Schöpfung, wie es die drei einflussreichen Theologen Martin Luther, Friedrich Schleiermacher und Karl Barth beschreiben. Der Vergleich der drei Positionen macht deutlich, dass das Thema für zahlreiche theologische Fragestellungen von grundlegender Bedeutung ist. Das jeweilige Verständnis von Gottes Liebe, von seiner Treue, seiner Allmacht und seiner Freiheit ist bedingt durch das Verständnis der Inkarnation. Deren Deutung und vor allem die Weise, in der die Autoren Jesus Christus als wahren Gott und wahren Menschen fassen, sind gebunden an bestimmte anthropologische Überzeugungen. Die Anthropologie und vor allem die jeweilige Sündenlehre der drei protestantischen Klassiker sind in der Interpretation von Anne Käfer entscheidend für ihre Verhältnisbestimmung von Menschwerdung und (Menschen-)Schöpfung Gottes. Insbesondere an der unterschiedlichen Beschreibung von Sünde und menschlicher Freiheit im Gegenüber zum dreieinigen Gott wird die grundsätzliche Differenz zwischen der lutherischen Position und den beiden reformierten Positionen deutlich, die das Thema Inkarnation und Schöpfung prägt. Inhaltsverzeichnis |
 |
Matthias Mikoteit Theologie und Gebet bei Luther de Gruyter, 2004, 335 Seiten, Gebunden, 978-3-11-017979-8 149,95 EUR |
Theologische
Bibliothek Töpelmann Band 124 Untersuchungen zur Psalmenvorlesung 1532-1535 [siehe dazu Luthers Psalmenauslegungen] Die grundlegende Monographie über das Gebet bei Luther hat als Quellenbasis Luthers bislang in der Forschung als Ganze wenig beachtete dritte Psalmenvorlesung. Sie wird als ein gleichsam interaktiver, rechtfertigungstheologisch verankerter Dank- und Bittgebetsvollzug erfasst. Ihre Pointe erhält die Arbeit durch die thematische Fokussierung auf die von Luther im programmatischen ersten Satz benannten Gebetsakte des Lobens und Dankens. Es wird plausibel, dass die Vorrangstellung des Lob- und Dankgebets vor dem Bittgebet rechtfertigungstheologisch begründet ist. Die Arbeit eröffnet mit ihrer speziellen Verfahrenstechnik einen neuen Zugang zur Theologie Luthers und beansprucht nicht weniger als gesamttheologische Relevanz. |